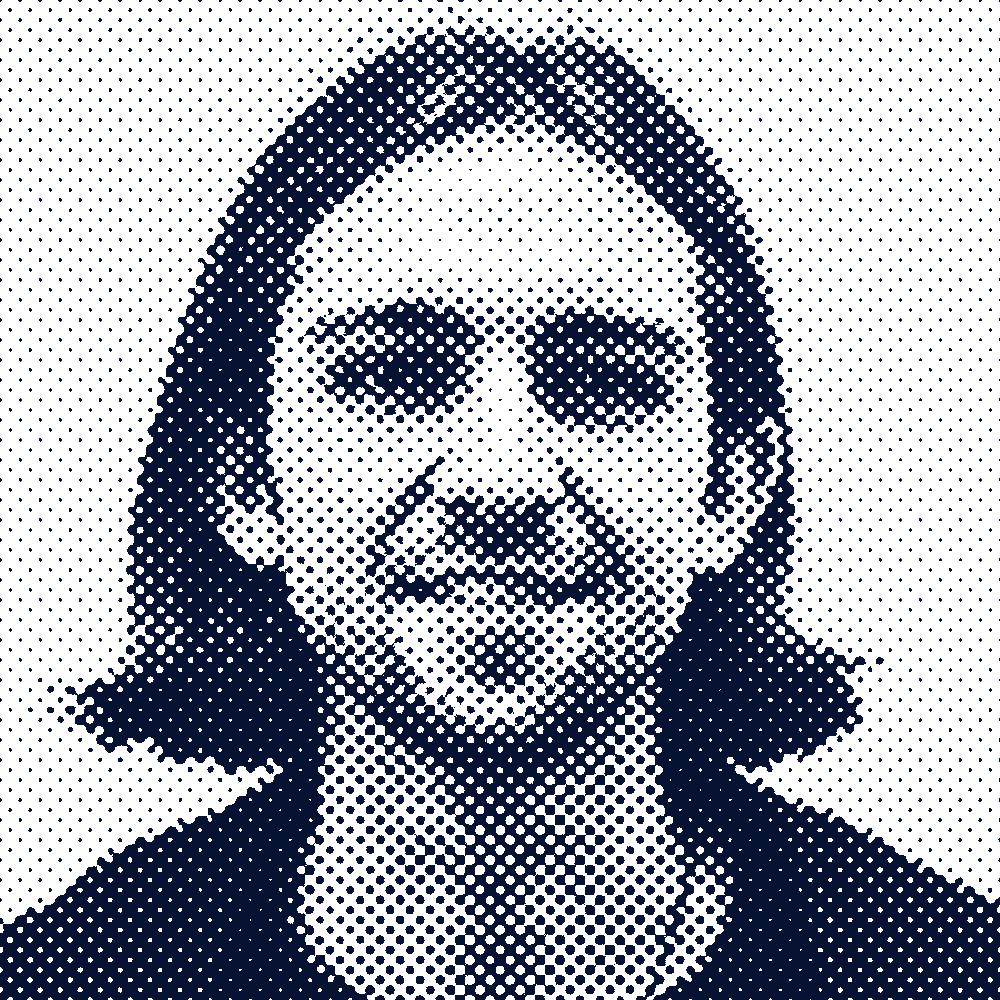Mirjam Zadoff ist Leiterin des NS-Dokumentationszentrums München. Am 17. November 2025 erschien ihr neues Buch „Wie wir überwintern: Den Lebensmut durch die harten Zeiten retten“.
Frau Zadoff, wir verlieren unser Vertrauen in Medien, Politik und Mitmenschen. Gleichzeitig nehmen die Krisen der Welt zu. Schon verständlich, dass sich da immer mehr Leute raushalten wollen, oder?
Wer keine Nachrichten liest, sollte wissen, dass das ein Privileg ist. Diejenigen, die weniger Nachrichten lesen, sind häufig jene, die von diesen Nachrichten nicht unmittelbar betroffen sind, nicht vom Krieg, nicht von den geänderten Bestimmungen beim Bürgergeld. Diejenigen, die so betroffen sind, dass sie Angst haben, auf die Straße oder in ein Amt zu gehen, können sich das gar nicht leisten, sie nicht zu lesen. Aber wenn ich zwei Wochen in den Urlaub fahre und abschalte, ist das okay. Es ist wichtig, dass wir Atem holen. Das brauchen wir, um gleichzeitig ganz genau hinschauen zu können, auf das, was passiert.
Abschalten und Atemholen sollte mit großer Wachheit und Aufmerksamkeit zusammenkommen. Wenn Rechte oder Freiheiten erst einmal verloren sind, bleiben sie das in der Regel auch. Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass schon alles gut wird, während wir uns ins Private zurückziehen. Die Vorstellung, dass die Gewalt und der Extremismus einen selbst nicht betreffen, ist eine grandiose Illusion. Faschismus trifft am Ende fast alle – auf unterschiedliche Art und Weise natürlich.
Aktuell sieht es aus, als seien Autokraten dieser Welt unaufhaltbar. Wie bewahren wir in solchen Zeiten den Lebensmut?
Wir müssen einerseits weniger erschöpft und andererseits politischer werden. Und das auf eine Art und Weise, die nicht nur meine Freunde und Freundinnen erreicht. Sondern auch Leute, die politisch anders denken als ich, aber ähnliche Sorgen haben.
.jpg?compress=true&format=auto)
Mirjam Zadoff | NS Doku Pressekit
Wie gelingt das?
Andersdenkende umgeben uns überall, und wir haben Angst vor der Auseinandersetzung, davor zu streiten, am gleichen Tisch zu sitzen. Aber wir sitzen nun mal am selben Tisch und leben in derselben Welt.
In der amerikanischen Kleinstadt Thetford (Vermont) treffen sich Menschen seit 60 Jahren jeden Freitagabend, jeder bringt was zu Essen mit, dann werden Bilder gezeigt, von Menschen, die neu zugezogen oder gestorben sind, die sich verändert haben, neugeborene Kinder und so weiter. Es geht darum, wieder Vertrauen in die Nachbarn zu haben – selbst, wenn man politisch anderer Meinung ist. Wir brauchen diese Nähe und das Gespräch. Viel zu häufig beschwören wir die Demokratie, aber wir denken so selten darüber nach, was das eigentlich bedeutet.
Für viele ist das im Alltag eine sehr abstrakte Debatte.
Natürlich ist es ein Luxus, darüber nachdenken zu können. Viele Menschen können sich das im Alltag nicht leisten. Für viele Menschen hat sich in ihrem Leben schon lange nichts mehr zum Besseren verändert, und sie erleben keine Politik, die das versucht. Eine derart große Schere zwischen Arm und Reich, wie wir sie jetzt erleben, kann keine Demokratie verkraften. Wir müssen uns überlegen: Wie können wir dafür sorgen, dass es Menschen nicht nur wirtschaftlich besser geht, sondern dass sie auch ein Netzwerk haben, das sich umeinander kümmert?
Was meinen Sie damit?
Wenn man in Umfragen Leute fragt, wie es ihnen geht, sagen sie oft: Mir persönlich geht es gut, aber dem Land geht es schlecht. Diese Düsternis, die uns heute umgibt, ist nicht immer der eigenen Lebenssituation geschuldet, sondern hat auch andere Gründe. Damit will ich natürlich nicht relativieren, dass es mehr und mehr Menschen wirklich schlechter geht. Aber unsere Wahrnehmung der Realität ist inzwischen auch von Technologien geprägt, die ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr versteht.
Es entsteht eine Form der Öffentlichkeit, die gesteuert ist von Firmen und nicht von Menschen – und die haben eine andere Vorstellung von Glück. Ich will damit nicht eine Retro-Nostalgie predigen, aber ich glaube, wir müssen wirklich mehr in den analogen Raum gehen, um den Lebensmut zu bewahren.
Müssen wir also einfach öfter das Handy abschalten, um durchzuhalten?
Wir vereinsamen digital. Also geht es darum, Wege zu finden, wie wir wieder analog zusammenkommen. Für die Philosophin Hannah Arendt war die „Verlassenheit“, wenn Menschen vereinsamen, die Basis für Extremismus. Wenn sie das Gefühl haben, sie sind einsam und politisch unsichtbar. Und in Deutschland ist es je nach Region sehr unterschiedlich, wie viel Sichtbarkeit und Öffentlichkeit Menschen erfahren.
Wenn ich in der Großstadt lebe, dann habe ich, zumindest theoretisch, Zugang zu ganz vielen unterschiedlichen öffentlichen Räumen. Aber je nachdem, wo ich auf dem Land lebe, habe ich das nicht. Kein Kino, kein Bus, keine Bank vorm Haus, gar nichts. Das ist ein Riesenproblem.
Dann gibt es noch die andere Seite: Für viele Menschen ist die Öffentlichkeit bedrohlich, weil sie von Rassismus oder Antisemitismus betroffen sind. Und sie gehen nur raus, wenn sie unbedingt müssen, weil sie Angst haben.
Beides ist sehr bedenklich, weil wir den vertrauensvollen, positiv besetzten Kontakt einfach brauchen. Wir brauchen es, uns immer wieder Menschen auszusetzen, die anders aussehen, die anders sprechen, die vielleicht einen anderen Akzent haben, die völlig andere Schlüsse ziehen aus ähnlichen Problemen.
Heißt das, wir müssen uns wieder mehr mit Andersdenkenden streiten?
Ja, aber wir brauchen Alternativen zu einer Talkshowkultur, die Leute aufeinander losgehen lässt, als wären sie in einem Boxring. Am Ende sind alle geschlagen. Vor allem die, die differenziert oder wissensbasiert argumentieren. Solche Formate bringen uns nicht weiter.
Ich glaube sogar, dass Reden nicht immer gut ist. Manchmal geht es einfach darum, dass man gemeinsam in einem Raum sitzt und irgendwas macht, was gar nichts mit Politik zu tun hat. Fußball spielen, basteln, stricken, was auch immer. An einem Tisch sitzen. Zusammen essen. Das klingt so banal, aber das ist wichtig.
Muss ich wirklich mit Leuten an einem Tisch sitzen und essen, mit denen ich nicht über Politik reden kann?
Der World Happiness Report zeigt, dass US-Amerikaner immer unglücklicher werden. Und die Autoren sehen einen der Gründe darin, dass die Menschen nicht mehr zusammen essen. Weil es diese Nähe und den Austausch nicht mehr gibt. Ein Viertel der US-Amerikaner isst inzwischen jede Mahlzeit alleine. Das ist eine völlig irre Zahl. Durch die extrem hohe Bildschirmzeit, die viele Menschen inzwischen haben, kommt es weniger und weniger zu diesen geteilten Momenten mit Andersdenkenden.
Andersherum gefragt: Hilft gemeinsames Essen gegen die großen Konflikte unserer Zeit?
Diese Frage stelle ich mir natürlich oft. Diese kleinen Dinge werden den Gang der Welt nicht ändern, aber vielleicht unseren Alltag und damit auch unsere Haltung. Ich glaube, es hat viel mit Vertrauen zu tun. Wenn wir keinen Kontakt mehr zu den Menschen um uns herum haben, verlieren wir das Vertrauen in unser unmittelbares Umfeld. Das ist der erste Schritt. Anschließend verlieren wir das Vertrauen in die Gesellschaft, in die Medien, in die Politik. Unsere Vereinsamung mündet in einem allgemeinen Vertrauensverlust gegenüber anderen Menschen.
Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns wieder stärker miteinander verbinden. Es macht mir Hoffnung, dass aktuell viele analoge Protestformen des 20. Jahrhunderts zurückkommen.
Welche?
Mein Lieblingsbeispiel sind die sogenannten Zines. Das Wort kommt von „Magazine“. Das sind ganz kleine, billig produzierte Booklets. Ein paar Seiten, die einfach gefaltet und geklammert werden. Darin kommuniziert man politische Inhalte. Und die werden dann einfach auf der Straße ausgeteilt. Die Zines entstanden in den 1920er und 1930er Jahren im New Yorker Stadtteil Harlem, in der afroamerikanischen Protestbewegung. Es ist eine ganz banale Protestform des frühen 20. Jahrhunderts, die jetzt wieder zurück ist.
Es gibt aber auch andere Beispiele: Die Omas gegen Rechts stricken gemeinsam – eine feministische Protestform, die es ähnlich in den 1970ern schon gab. Das Red Lipstick Movement in den USA benutzt Lippenstift, um gegen die Trump-Regierung zu protestieren, so wie es vor 100 Jahren bereits die Suffragetten taten, um für Frauenrechte zu protestieren. Und in den USA machen Menschen vor Abschiebegefängnissen gemeinsam Aerobic, um zu protestieren.
Hilft das wirklich?
Klar kann man sich darüber einfach lustig machen, weil das altmodisch wirkt, vielleicht auch hilflos. Aber das ist wichtig. Wir sind in einer Situation, in der viele Leute Angst haben, dass sie selber ins Kreuzfeuer geraten. Deswegen suchen sie vermeintlich nicht politisch wirkende Protestformen. Auf diese Art und Weise holen wir uns die Straße zurück. Wir brauchen diese Sichtbarkeit von gemeinschaftlichen Aktivitäten. Denn politische Radikalisierung geht immer damit einher, dass die Zivilgesellschaft zersplittert wird und sich nicht mehr organisieren kann. Wir müssen uns wieder mehr einander ausliefern.
Redaktion: Lea Schönborn, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Gabriel Schäfer, Audioversion: Christian Melchert und Iris Hochberger