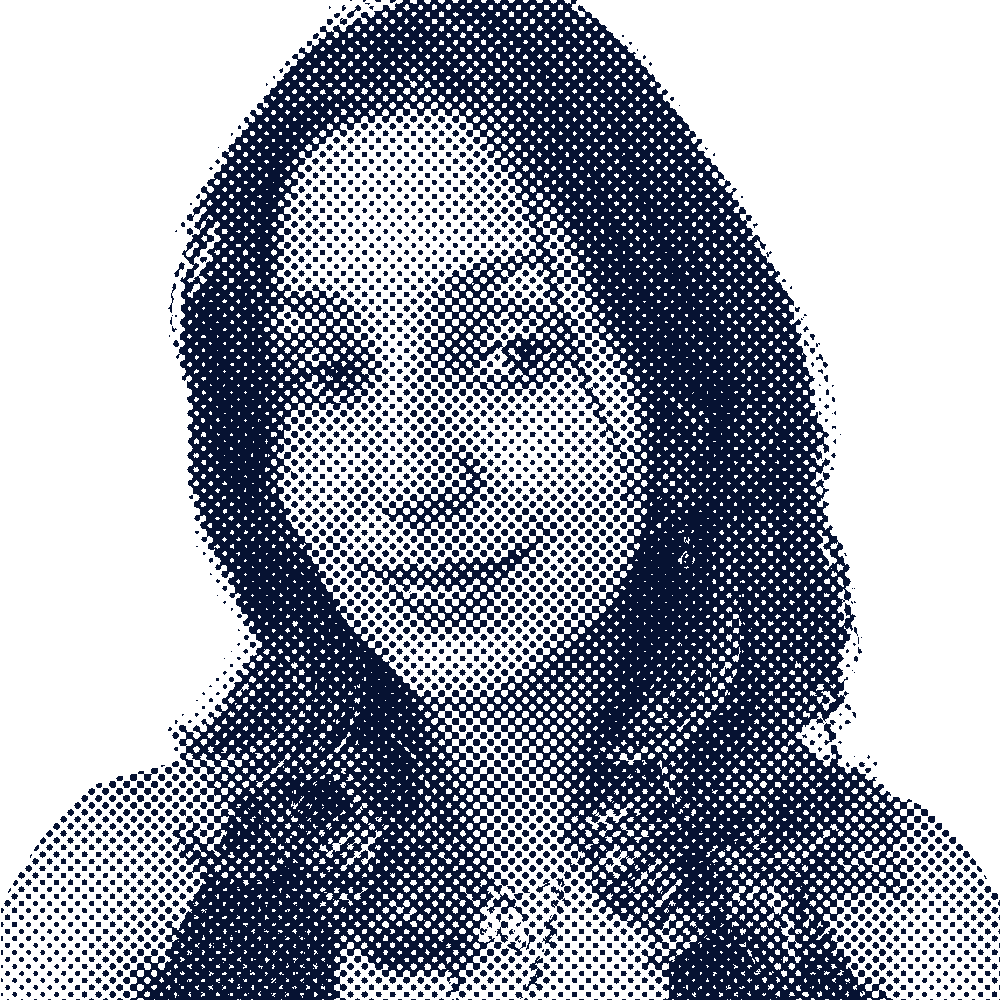„Dann überkommt mich ganz plötzlich Panik. Nichts ist sicher, flüstert es in mir. Alles, was du liebst, kannst du verlieren.“
Im grellen Licht der Krankenhausflure hört KR-Leserin Kerstin die Ärzte dumpf etwas rufen. Ihr Kind ist schwer krank. Monatelang stand der Desinfektionsmittelgeruch in der Wohnung. Während sie mit allen Kräften versuchte durchzuhalten, verliebte sich ihr Mann heimlich in eine andere.
Kerstins Leben hat sich seither gewendet. Ihr Kind ist wieder gesund, sie hat einen Traumjob, die Beziehung ist sinnlicher denn je und für Freundinnen findet sie regelmäßig Zeit. Aber all das reicht nicht. Es scheint etwas zu fehlen und sie zu verunsichern, wenn ihr Mann abwesend ins Handy grinst oder ihr Sohn müde aus dem Zimmer kommt. Sie fragt sich: Was brauche ich, um mich sicher zu fühlen? Auch, wenn eigentlich alles gut scheint?
Ich wandte mich an die KR‑Community: Kennst du diesen Moment, in dem du dich plötzlich unsicher fühlst, obwohl „alles da“ ist? 133 KR-Mitglieder erzählen von einschneidenden Lebensveränderungen, aber auch von unerwarteten Momenten.
„Als die ersten KIs erfunden wurden.“
„Als mein Sohn seine erste Freundin mit nach Hause brachte.“
„Als ich vorletzte Woche zu viel Geld auf einmal ausgegeben habe.“
„Wenn ich hormonell aus dem Gleichgewicht komme, kurz vor der Menstruation.“
„Als mein Auto kaputt ging.“
Kerstin spricht ein Gefühl an, das viele kennen: Ist Sicherheit überhaupt etwas Festes und Dauerhaftes? Und wie lässt sie sich wiederherstellen, wenn sie verloren ging? Um eine Antwort darauf zu finden, habe ich mit einem Professor für Sozialpsychologie, einem Politiker der Grünen, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und einer Traumatherapeutin gesprochen. Dabei habe ich gelernt, die Zeit der Aufklärung hat uns neue Unsicherheiten gebracht, Lokalpolitik hat direkten Einfluss auf Sicherheit – und erstmal tief durchatmen ist kein so schlechter Anfang.
Unsicherheit ist eine Folge des Zerfalls sozialer Bindungen⬆ nach oben
Ich stoße auf einen Forschungsband mit dem Titel „The Psychology of Insecurity: Seeking Certainty Where None Can Be Found“ (dt.: Nach Sicherheit suchen, wo man keine finden kann). Ich schreibe dem Herausgeber und Soziologen Joseph Forgas, und ein paar Tage später antwortet er. Menschen suchen oft nach Sicherheit, wo sie Stabilität vermuten, schreibt er. „Aber Sicherheit entsteht nicht durch Kontrolle, sondern durch Vertrauen.“
Das Sicherheitsgefühl habe sich seit der Zeit der Aufklärung von einer reinen Überlebensfrage zu einem komplexen Gefühl entwickelt, schreibt Forgas. Wer genug zu essen und ein Dach über dem Kopf hatte, war damals sicher. Der materielle Fortschritt hat uns unabhängiger gemacht. Damit lösten sich aber auch die traditionellen Gemeinschaften auf. Heute bedeutet unabhängig sein oft auch einsam und auf sich allein gestellt sein.
Was also tun? Forgas’ Antwort ist einfach: mehr echte Begegnung und Beziehungen pflegen, all das stärke nachweislich das Gefühl von Sicherheit, mache zufriedener und sogar gesünder. Auch in der Umfrage in der KR-Community beschreiben fast alle Teilnehmer:innen, dass Bindungen mit Menschen ihnen im Alltag den größten Halt geben. Ein langes Gespräch, gemeinsames Lachen mit Freund:innen oder die Nähe der Familie beruhigt und lässt aufatmen. Manche erzählen auch davon, wie hilfreich es sei, mit Kolleg:innen zu reden, sich mit einer Therapeut:in auszutauschen oder in einer Kirchengruppe aktiv zu sein.
Politik muss Sicherheit aus allen Perspektiven denken⬆ nach oben
Wenn das Sicherheitsgefühl so stark von unserem sozialen Umfeld abhängt, welche Rolle kann dann die Politik spielen? Kurz nachdem ich eine Anfrage an Jörn Pohl, Innenpolitiker der Grünen, schicke, ruft er zurück. „Politik muss darauf eingehen, dass das Sicherheitsempfinden etwas hochgradig Persönliches ist“, sagt er und bezieht sich auf die Stadtbild-Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz, in der der Migration als Problem im Stadtbild beschreibt. Pohl erzählt von einem Mann mit Migrationsgeschichte, der bestimmte Viertel meide, weil er sich unwohl fühle. Von einem jüdischen Mann, der seine Kippa nur zu Familienfeiern trage, weil er sich auf der Straße damit nicht sicher fühle. Pohl möchte unsichere Alltagssituationen politisch angehen. Maßnahmen müssten so gestaltet werden, dass sich alle gesellschaftlichen Gruppen geschützt fühlen und erzählt von Frauen, die nachts nicht mehr durch Parks gingen. Pohl sagt: „Genau hier beginnt Sicherheitspolitik. Wenn Wege schlecht beleuchtet sind oder man sich verfolgt fühlt, muss die Politik handeln, Laternen aufstellen und Teams des Ordnungsamts sichtbar im Park zeigen.“
Auch international beschäftigt sich die Sicherheitspolitik mit Bedrohungen. Pohl beobachtet, wie Staaten wie Russland oder China Druck ausüben. Deutschland diskutiert eine stärker aufgestellte Bundeswehr, neue Gesetze zum Schutz kritischer Infrastruktur und die Rolle einer verlässlichen NATO. Solche Entscheidungen spüren Menschen direkt im Alltag und sie beeinflussen, wie sicher sie sich fühlen. Trotzdem leben wir, sagt Pohl, „in einem der sichersten Länder der Welt“. Dass sich viele Menschen trotzdem unsicherer fühlen, liege vor allem an Stimmungsmache durch populistische Kräfte. Wer sich unsicher fühle und mehr Ängste habe, wähle eher populistische Parteien.
Resilienz und Selbstwirksamkeit⬆ nach oben
Politik kann Straßen beleuchten oder Polizeistreifen losschicken. Trotzdem bleibt immer ein Gefühl der Unruhe in der Gesellschaft. Marianne Suntrup vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) befasst sich damit, wo Verunsicherung entsteht und wie sie sich lösen lässt.
„Wenn wir über Sicherheit sprechen, meinen wir meist Resilienz, das heißt, wir bleiben widerstandsfähig und können handeln.“ Unser Sicherheitsgefühl hänge nicht nur von äußeren Strukturen ab, sondern davon, wie wir die Situation beurteilen. Wer meint, einer Bedrohung nicht gewachsen zu sein, fühlt sich unsicher. Fehlendes Wissen und fehlendes Vertrauen in staatliche Institutionen verstärken dieses Gefühl. Auch Medien beeinflussen uns. „Negative Informationen bleiben länger im Gedächtnis. Wenn Nachrichten und soziale Medien ständig von Krisen berichten, prägt das unser Empfinden“, sagt Suntrup.
Sie rät, sich vorzubereiten, zu schauen, welche Strukturen im Krisenfall greifen und zu üben, wie man selbst handeln kann. So baue man Vertrauen in sich selbst auf. Ein weiterer Tipp: Manchmal einfach weniger Nachrichten schauen und bewusst Pausen einlegen.
Sicherheit beginnt im Nervensystem⬆ nach oben
Sicherheit ist nicht nur ein Gedanke, sondern ein körperliches Empfinden. Ich schreibe Susanne Altmeyer, Chefärztin der Traumaklinik Gezeiten Haus. Sie erklärt, was im Körper passiert, wenn wir uns sicher fühlen: Wir spüren ein leichtes Aufsteigen der Brust, einen gleichmäßigen Herzschlag, das Geräusch des eigenen Atems, das beruhigend im Ohr klingt.
Dieser Zustand ist zerbrechlich. „Selbst wenn das Leben äußerlich stabil scheint, kann der Körper auf Alarm stehen“, betont Altmeyer. „Denn Sicherheit lernt unser Nervensystem nicht über Logik, sondern über Erlebtes.“ Ein Geräusch wie das Quietschen einer Tür, das dich in deinen ersten Schultag zurückkatapultiert. Der Geruch von verschmortem Plastik, der dich an einen Brand erinnert und plötzlich kann ein altes Unsicherheitsgefühl wieder hochkommen. Sicherheit ist also kein fixer Zustand, sondern ein Zusammenspiel von Körpergedächtnis, Umwelt und inneren Mustern.
Wie lässt sich Sicherheit zurückgewinnen? „Indem wir unser eigenes Tempo respektieren“, sagt Altmeyer. „Sicherheit lässt sich nicht erzwingen. Sie entsteht, wenn wir wiederholt neue, korrigierende Erfahrungen machen.“ Dazu helfen Methoden, die Körper und Emotion miteinander verbinden: Achtsamkeit, Atemübungen, Qigong oder sanftes Yoga. Auch kleine Rituale können Halt geben, der Duft eines Lavendelkissens oder der vertraute Klang des Lieblingssongs im Ohr. Eine Teilnehmerin der KR-Community beschreibt, wie sie ihren Körper beruhigt: „Ich tanze, schüttele mich, stampfe oder umarme mich selbst.“ Für andere aus der KR-Community wirken Kuscheln, Sport und Schlafen regulierend. Altmeyer betont aber auch: „Keine Methode wirkt bei allen gleich. Manchmal muss zuerst an zwischenmenschlichen Beziehungen und äußerer Stabilität gearbeitet werden, bevor der Körper wieder als sicherer Ort erlebt wird.“
Vertrauen ist das, was uns Sicherheit gibt⬆ nach oben
Kerstins Geschichte zeigt, wie tief unser Körper alte Erfahrungen speichert und selbst auf scheinbar harmlose Situationen mit Unsicherheit reagiert. Was brauchen wir also, um uns sicher zu fühlen? Stabile Beziehungen geben Halt, selbst wenn äußere Umstände unsicher sind. Es lohnt sich, in Bindungen zu anderen, aber auch in die Beziehung zu sich selbst zu investieren. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wirkt als entscheidender Schutzfaktor, ebenso wie das Vertrauen in die Strukturen unserer Umgebung. Dazu gehört auch die Bereitschaft, unsere Umwelt als wandelbar und gestaltbar zu sehen. Sicherheit entsteht im Nervensystem: Achtsamkeit, Atemübungen, sanftes Yoga oder kleine Rituale helfen, den eigenen Körper als sicheren Ort wahrzunehmen. Schritt für Schritt lässt sich Sicherheit wieder aufbauen, indem wir neue, positive Erfahrungen sammeln, die alten Unsicherheitsgefühle korrigieren und bewusst Vertrauen entwickeln, das uns Halt gibt, wenn die Welt unsicher erscheint.
Ganz lieben Dank an alle KR-Mitglieder, die sich an meiner Umfrage beteiligt haben!
Redaktion: Astrid Probst, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Gabriel Schäfer, Audioversion: Iris Hochberger und Christian Melchert