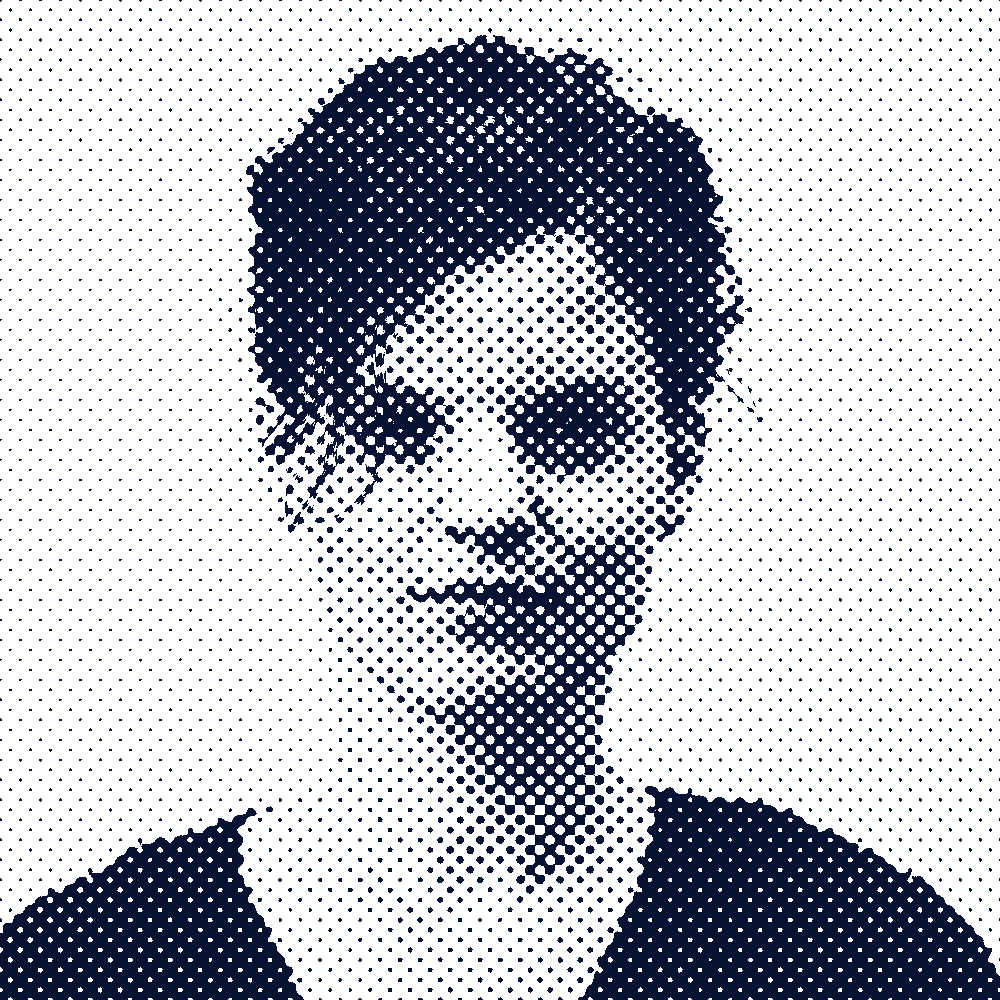Was haben Richard von Weizsäcker, Jürgen Habermas und Helmut Schmidt miteinander gemeinsam?
Sie haben alle in einem wesentlichen Punkt missverstanden, wie Demokratie funktioniert.
Damit sind sie nicht allein. Ich zum Beispiel habe mich auch geirrt. Und wahrscheinlich fast alle Menschen, die in Demokratien leben, von den alten Griechen bis heute.
Der Irrtum, um den es geht, gehört so sehr zu unserer politischen Erziehung, dass ihn kaum jemand infrage stellt: Demokratie, heißt es, lebt vom Gespräch, vom Austausch von Argumenten. In Athen stritten freie Bürger auf der Agora. Reden und Gegenreden, so die Überzeugung, sollten Macht bändigen und Weisheit ans Licht bringen. Das Motto von Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt lautete: „Demokratie besteht aus Debatte und anschließender Entscheidung aufgrund der Debatte.“ Der Philosoph Jürgen Habermas schwärmte vom Aufstieg einer bürgerlichen Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert, die in Kaffeehäusern und Tischgesellschaften des Bürgertums begann: Menschen sollten nicht länger mit Waffen oder blindem Gehorsam ihre Konflikte austragen, sondern mit Worten. Und liberale Intellektuelle glauben noch immer an einen Markplatz der Ideen, auf dem sich die besten Argumente durchsetzen.
Nun ja. 2025 kam eine junge Frau daher und veröffentlichte ein Buch, das diese Idee ins Wanken bringt. „Don’t Talk About Politics“ heißt es. Sarah Stein Lubrano erforscht seit Jahren die Schnittstelle zwischen Psychologie und Politik. Sie sagt: Worte werden überschätzt. Debatten werden die Demokratie nicht retten. Sie sind sogar Teil des Problems. Sie kosten Energie, verstärken Fronten und spielen am Ende vor allem den Mächtigen in die Hände.
Frech? Ja, das ist es. Aber Sarah Stein Lubrano hat verdammt gute Argumente.
Ihr Buch bietet eine neue Erklärung dafür, warum politische Gespräche sich in den vergangenen Jahren zunehmend anfühlen wie ein chaotischer Kindergeburtstag: Alle schreien durcheinander, jede:r will recht haben und am Ende ist etwas kaputt.
Das klingt auf den ersten Blick hoffnungslos. Auf den zweiten ist es eine enorme Erleichterung. Denn wir können aufhören, den Onkel beim Familienessen mit top Argumenten überzeugen zu wollen, dass es den Klimawandel wirklich gibt. Wir müssen uns nicht mehr auf sozialen Medien anbrüllen. Es gibt einen besseren Weg. Und der hat damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert.
Der Job unseres Gehirns ist nicht, nüchtern nach Wahrheit zu suchen⬆ nach oben
Studien über Studien haben gezeigt, dass Menschen, die von einer Sache wirklich überzeugt sind, ihre Meinung nicht ändern, nur weil man ihnen Fakten präsentiert. Das gilt besonders bei politischen Themen. Eine Studie konnte zeigen, wie eigensinnig unser Denken ist: Forschende ermittelten die Meinungen der Teilnehmenden zu bestimmten Themen. Anschließend konfrontierten sie sie mit Fakten. Wenn es um neutrale Fragen ging, etwa, wer die Glühbirne erfunden hat, waren Menschen durchaus bereit, ihre Ansichten an neue Informationen anzupassen. Wurden sie jedoch mit politischen Themen konfrontiert, wie Waffengesetzen, blieb ihr Denken erstaunlich unbeweglich. Selbst wenn Fakten klar gegen ihre Position sprachen, hielten sie an ihr fest.
Menschen sind durchaus offen für neue Sichtweisen. Nur darf es nicht um Themen gehen, die unsere Selbstbestimmung, unser Gefühl von Zugehörigkeit oder unsere Identität betreffen. Aber genau das tun politische Überzeugungen fast immer. Und dann wird es viel schwerer, Menschen zu erreichen.
Wir können uns darüber die Haare raufen, wie es Wissenschaftler:innen in den vergangenen Jahren taten und wie es eigentlich alle tun, die hoffen, dass Menschen zu vernünftigem Denken fähig sind. Aber der Punkt ist: An den eigenen Ansichten festzuhalten, obwohl die Fakten dagegen sprechen, ist nicht irrational, sondern psychologisch sinnvoll.
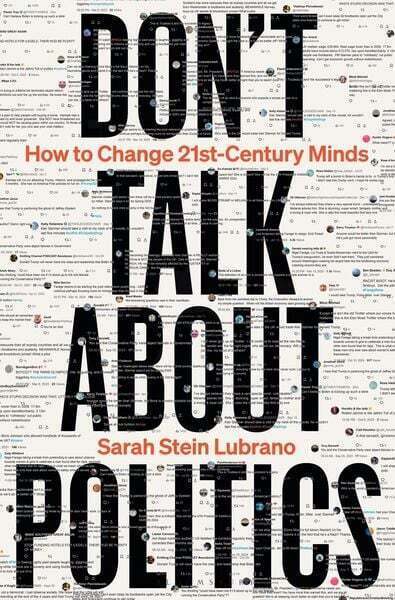
Das Buch
Sarah Stein Lubrano: “Don’t Talk About Politics (And What To Do Instead)” / Bloomsbury Academic, 2025 / ISBN: 978-1-399-41392-3
Der Job unseres Gehirns ist nicht, nüchtern nach Wahrheit zu suchen. Sondern uns zu helfen, in der Welt zurechtzukommen. Besonders im Zusammensein mit anderen. Unsere Meinungen entstehen deshalb nicht wirklich durch Diskussionen und indem wir die Welt nüchtern analysieren. Sie entwickeln sich eher dadurch, dass wir uns an den Menschen um uns herum orientieren.
„Uns ist sehr wichtig, wie wir uns selbst sehen. Ob als ‚Feministin‘ oder ‚Antifeministin‘, als ‚engagierte Bürgerin‘ oder ‚Sozialschmarotzer‘. Gerade weil diese Selbstbilder so wichtig sind, verzerren sie systematisch, wie wir politische Themen wahrnehmen“, schreibt Stein Lubrano.
Politische Debatten sind Wähler:innen ziemlich egal⬆ nach oben
Verknüpft mit unserem Selbstbild ist die Frage, zu welcher Gruppe wir gehören. Sagen wir, du bist Landwirt und alle anderen um dich herum glauben, dass der Klimawandel ein Märchen ist. Du auch. Weil aber deine Felder die letzten drei Sommer ausgetrocknet sind oder überschwemmt wurden, änderst du deine Meinung. Deine Kolleg:innen aber nicht. Auf einmal stehst du allein da. Das ist schwer zu ertragen. Menschen erleben Ausgrenzung als schmerzhaft und bedrohlich, nicht zuletzt, weil wir uns entwickelt haben, um in Gruppen zusammenzuleben. So verteidigt das Gehirn lieber die Perspektive, die uns ein Gefühl von Beständigkeit gibt – selbst angesichts starker Gegenbeweise.
Ich habe in den USA live erlebt, wie demokratische Wähler:innen nach dem Fiasko der Debatte von Joe Biden gegen Donald Trump im Sommer 2024 verzweifelten und die Hände rangen. Heute wissen wir, dass diese Debatte die Wahl kaum beeinflusst hat. Das ist kein Zufall. Politische Debatten im Fernsehen sind eigentlich Zeitverschwendung. Für eine 2023 veröffentlichte Studie analysierten Forschende 56 Fernsehdebatten zu 31 Wahlen in den USA, Kanada, Neuseeland und Europa von 1952 bis 2017. Sie wollten herausfinden, ob Debatten unentschlossenen oder entschlossenen Wähler:innen dabei halfen, sich zu entscheiden oder ihre Meinung zu ändern. Die Forschenden fanden keine Hinweise darauf, dass die Debatten einen Einfluss hatten.
Du lieferst keine Argumente, du lieferst Waffen⬆ nach oben
Eine verbreitete Theorie in den Neurowissenschaften heißt Predictive Processing. Diese geht davon aus, dass das Gehirn ständig Voraussagen erstellt. Was wir für Wahrnehmung halten, ist demnach eigentlich Korrekturarbeit: Das Gehirn vergleicht laufend seine Prognosen mit den eintreffenden Reizen. Wenn in diesem Prognosesystem Widersprüche auftauchen, erleben wir das als schmerzhaft. Dieses unangenehme Gefühl nennt man in der Psychologie kognitive Dissonanz. Sie sorgt dafür, dass wir ständig rationalisieren, was eigentlich nicht zusammenpasst.
Sagen wir, du hältst dich für einen offenen Menschen ohne rassistische Vorurteile. Dann betrittst du den Großraumwagen eines ICE und siehst eine Gruppe Frauen mit Kopftüchern. Du trägst in diesem Beispiel selbst kein Kopftuch und hast keine Lust, dich dazuzusetzen. Statt dich nüchtern zu fragen, ob du vielleicht doch ein paar Vorurteile hast, suchst du Gründe, warum dein Verhalten in diesem Fall Sinn ergibt („Die hat mich komisch angeguckt“, „der Platz am Fenster ist eh besser“). Das Gehirn ist erstaunlich kreativ darin, Ausreden zu finden, die unser Selbstbild schützen.
Stein Lubrano betont, dass solche Denkprozesse eigentlich keine „Fehler“ sind. Sie erfüllen eine Funktion, auch wenn sie zu falschen Schlüssen führen.
Debatten tun nichts, um diese kognitiven Besonderheiten auszuschalten. Im Gegenteil. Ein blutloser Ersatz für Krieg ist immer noch ein Kampf. Nicht zufällig sprechen wir von „schlagenden“ Argumenten und davon, Debatten zu „gewinnen“. Wie in einer Schlacht soll sich in einer Demokratie das bessere Argument durchsetzen. Doch in der Realität gewinnt oft nicht die klügste Idee, sondern wer am lautesten schreit, am dreistesten lügt oder einfach die meiste Macht hat.
Der „Marktplatz der Ideen“ war schon immer mehr Ideal als Wirklichkeit. Politische Überzeugungen sind keine Produkte, die fair gehandelt werden. Der Marktplatz war immer einer, auf dem die Mächtigen in einer Gesellschaft mehr Chancen hatten. Viele Stimmen blieben ausgeschlossen. Aber in einer Zeit, als Menschen sich noch regelmäßig in Vereinen, Kirchen und auf Dorfplätzen trafen, als noch gemeinsame Erfahrungsräume existierten, funktionierte sie zumindest teilweise.
Heute ist die Gesellschaft zunehmend fragmentiert. Wir treffen uns immer weniger im echten Leben an öffentlichen Orten, um Ideen auszutauschen, wir bleiben unter Gleichgesinnten. Digitale Räume sind kein Ersatz. Die Corona-Pandemie hat das brutal deutlich gemacht. Während Menschen isoliert in ihren Wohnungen saßen, eskalierte die Debatte in den sozialen Medien. Jeder hatte eine Meinung, niemand hörte zu. Die Gesellschaft spaltete sich in Blasen, die einander nicht mehr verstanden. Es fehlte, was echte Gespräche ausmacht: der Blick in die Augen des anderen, das gemeinsame Schweigen, der Moment des Zögerns. Unser Gehirn ist für diese Art von Austausch verdrahtet, nicht für endlose Twitter-Threads und Whatsapp-Streitereien.
Online-Debatten eignen sich nicht, um Beziehungen zu stiften. Im Gegenteil, sie untergraben oft die Solidarität, die wir in Krisen brauchen. Wenn Milliardäre wie Elon Musk Plattformen kaufen, geht es nicht um Meinungsfreiheit. Sondern darum, die kommunikative Infrastruktur zu kontrollieren. Wer den Marktplatz besitzt, bestimmt die Regeln des Handels.
So viel geredet, so wenig bewegt⬆ nach oben
Politische Debatten sind eigentlich eine Falle. Sie überzeugen kaum jemanden, fressen aber massiv Zeit und Energie. Noch schlimmer, sie gaukeln uns vor, wir würden aktiv an der Demokratie teilnehmen. Populist:innen lieben deshalb Scheindebatten über Gendersprache oder „Meinungsfreiheit“. Der Lärm dieser Scheingefechte übertönt das leise Geräusch im Hintergrund, wo sie systematisch die Stützen der Demokratie ansägen. Die deutsche Debattenkultur hat in den letzten Jahren so viel Energie in die Frage gesteckt, ob man „noch alles sagen darf“, dass man eine Tesla-Fabrik damit hätte betreiben können. Tatsache ist, die Demokratie braucht diese Gespräche nicht.
Wenn Debatten wirklich das Herz der Demokratie wären, dann hätte das britische Referendum über den Brexit ein Triumph der Aufklärung werden müssen. Wochenlang stritten Politiker:innen im Fernsehen, Faktenchecks überschwemmten die Zeitungen, jede These wurde von der Gegenseite mit Argumenten bekämpft. Doch am Ende zeigte sich: Kaum jemand änderte seine Meinung. Die „Leave“-Wähler:innen, schreibt Stein Lubrano, entschieden sich nicht, weil sie in einer Talkshow vom besseren Argument überzeugt wurden. Sondern weil ihre sozialen Lebenswelten geprägt waren von Unsicherheit, Isolation, wirtschaftlicher Prekarität und dem Gefühl, abgehängt zu sein. Der Brexit war also nicht der Beweis für die Kraft der Debatte, sondern der Beweis für deren Grenzen. So viel geredet, so wenig bewegt.
Es gibt eine recht eng begrenzte Gruppe von Menschen, deren Meinung wir durch Argumente wirklich beeinflussen können. Sie finden sich fast ausschließlich am Rand des eigenen Lagers im sogenannten Spectrum of allies. Menschen, die dem eigenen Argument schon nahestehen, lassen sich mitunter etwas weiter in die gewünschte Richtung bewegen.
Selbst soziale Medien haben dabei kaum einen Einfluss. Nur 17 Prozent der Menschen in den USA haben laut einer neuen Studie ihre Meinung wegen etwas geändert, das sie in den sozialen Medien gesehen haben. Dein Post mag viral gehen, Tausende Menschen mögen dir zustimmen. Aber die Fans des Posts waren ohnehin schon deiner Meinung.
Lieber Food-Coop statt Fernsehduell⬆ nach oben
Wenn wir Menschen wirklich beeinflussen wollen, müssen wir mit dem arbeiten, wie unser Gehirn funktioniert, nicht dagegen. Das funktioniert zum einen, sagt Stein Lubrano, über unsere sozialen Beziehungen.
Unsere Freunde beeinflussen unsere Überzeugungen und unser Verhalten tatsächlich. Dafür gibt es in der Wissenschaft unzählige Belege. Nicht, weil wir endlos mit ihnen diskutieren, das ist eher ein netter Zeitvertreib (und stärkt das Gruppengefühl). Sondern, weil Beziehungen Vertrauen schaffen und uns Lebenswelten und Probleme zeigen können, die wir selbst nicht erleben. Erst als meine Freundinnen Kinder bekamen, wurde mir klar, wie traumatisch Geburten sein können oder dass Stillen furchtbar schmerzhaft sein kann.
Noch interessanter wird es, wenn wir Menschen außerhalb unseres gewohnten Umfelds kennenlernen. Stein Lubrano nennt als Beispiel eine Food-Coop in London, in der sich nicht nur Hipster treffen, um Biomilch zu kaufen, sondern Menschen aller Schichten, die bezahlbare Lebensmittel haben wollen. Eine solche Food-Coop kann vielleicht mehr politische Energie freisetzen als ein Fernsehduell zur besten Sendezeit.
Die Sozialkontakt-Theorie nämlich zeigt: Wenn Menschen Freundschaften über Gruppengrenzen hinweg schließen, schwinden ihre Vorurteile. Beziehungen schaffen Vertrauen, Empathie und Offenheit. Ohne diese Grundlage prallen selbst die klügsten Argumente ab. Menschen wiederum, die ihren Nachbarn vertrauen und Zeit mit ihnen verbringen, sind nicht nur politisch aktiver, sondern auch gesünder und glücklicher.
Die Geschichte der LGBTQ+-Rechte zeigt, wie stark dieser Effekt sein kann. Als Menschen sich outeten, änderten ihre Freunde ihre Ansichten über Homosexualität. Eine der schnellsten Veränderungen der öffentlichen Meinung, die je gemessen wurde. Ähnliches beobachtet man beim Klimaschutz. Menschen installieren viel eher eine Wärmepumpe, wenn Freunde es vormachen, als wenn man ihnen Geldprämien oder andere Anreize bietet.
Der zweite entscheidende Faktor, der die Meinungen von Menschen ändern kann, sind tatsächlich gelebte Erfahrungen. Eine Umfrage in der KR-Community hat das für mich bestätigt. Ich habe die KR-Leser:innen gefragt, ob sie schon einmal bei einem politischen Thema ihre Meinung grundlegend geändert haben. Viele schrieben mir, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine habe ihre Meinung in Bezug auf die Nato und die Bundeswehr geändert. Stein Lubrano nennt ein Beispiel aus der Forschung: Manche Frauen, denen eine Abtreibung verweigert wurde, setzen sich später weniger für Abtreibungsrechte ein als Frauen, die abtreiben konnten. Man würde erwarten, dass das Gegenteil passiert. Aber unser Gehirn funktioniert anders. Es passt unsere Überzeugungen an unsere Handlungen an, selbst wenn diese uns aufgezwungen wurden.
Ein anderes Beispiel liefert eine Untersuchung aus San Francisco. Dort beschloss die Stadt, den Verkauf von Einweg-Plastikflaschen zu verbieten. Vor Inkrafttreten des Gesetzes sprachen sich viele Bürgerinnen und Bürger dagegen aus. Doch schon einen Tag nach Beginn des Verbots zeigte sich ein verblüffender Effekt. Ein signifikanter Teil derjenigen, die noch kurz zuvor heftig gegen das Verbot waren, änderte seine Meinung. Einfach, weil die Stadt Tatsachen geschaffen hatte.
Proteste beinflussen Regierungen fast gar nicht⬆ nach oben
Zugegeben, dieser Effekt ist ein bisschen gruselig. Man kann die Meinungen von Menschen manipulieren, indem man ihre Lebensumstände verändert. Genau darin liegt aber auch eine Kraft.
„Wir können eine Idee nur wirklich verstehen, wenn wir ihr begegnen und sie verkörpern. Was bedeutet Feminismus im Abstrakten? Für mich bedeutet es praktisch nichts“, sagt Stein Lubrano mir in einem Videogespräch. „Erst, wenn du danach handelst, wird die Idee bedeutsam.“
Im progressiven Lager, dem Stein Lubrano eigentlich angehört, macht sie sich regelmäßig unbeliebt, weil für sie Demonstrationen kein politisches Handeln sind. Einfach, weil sie ziemlich wenig bringen. Die Forschung zeigt, dass selbst große und häufige Demonstrationen kaum messbare Effekte auf Regierungen haben. Sie entfalten nur dann eine Wirkung, wenn sie eine glaubwürdige Drohung transportieren, etwa dass Arbeit niedergelegt wird, dass Wahlen kippen oder dass das öffentliche Leben zum Stillstand kommt.
Proteste verändern die öffentliche Meinung kaum, und wenn dann meist wieder nur im eigenen Lager. Black Lives Matter gilt als Ausnahme, denn die Bewegung hat zeitweise Einstellungen in Teilen der US-Bevölkerung verschoben. Aber selbst hier zeigen die Daten, dass die Zustimmung für die Bewegung nach einem Höhepunkt 2020 zurückging und sich wieder den niedrigeren Zustimmungswerten der Jahre 2016 bis 2018 annährten, als mehr Amerikaner:innen sie ablehnten, als unterstützten.
Viele der spektakulären „Netzwerkproteste“ der letzten Jahre, wie Occupy Wall Street oder der Arabische Frühling, wuchsen schnell, verschwanden aber ebenso schnell, weil sie keine dauerhaften Strukturen aufbauten.
„Es ist wunderbar, zu einer Demo zu gehen und Gleichgesinnte zu treffen. Aber wenn Menschen ihre Zeit auf Demos verbringen und coole Schilder basteln, statt sich zu organisieren, um die eigentlichen Probleme zu lösen, dann sind wir am Arsch“, meint Stein Lubrano.
Sie sieht Proteste weniger als Druckmittel gegen die Mächtigen, sondern als Ausbildungsstätten für Aktivist:innen. Die bekannte Soziologin Zeynep Tufekci hat einmal gesagt: „Proteste funktionieren, weil sie oft die Einstiegsdroge zwischen gelegentlicher Teilnahme und lebenslangem Aktivismus sind.“
Für das Gehirn ist Handeln gleich Denken⬆ nach oben
Das Gehirn versteht Handeln nicht als nachgelagerte Konsequenz von Denken, sondern als dessen Fortsetzung. Neurowissenschaftler:innen sprechen von „Embodied Cognition“: Wir „denken“ mit unserem Körper. Wer gemeinsam Plakate malt oder eine Demonstration organisiert, verändert damit seine Sicht auf die Welt. Der Protest wirkt nicht, weil die Regierung zuhört, sondern weil die Teilnehmenden selbst durch das Handeln politisch werden. Anders gesagt, du handelst nicht, weil du politisch bist, sondern du bist politisch, weil du handelst.
Es waren nie die großen Reden allein, die Bewegungen vorangebracht haben, meint Stein Lubrano. Fortschritt entstand, weil Menschen bereit waren, jahrelang unspektakuläre Arbeit zu leisten, von Tür zu Tür zu gehen, Nachbarn zu überzeugen, Listen zu führen, Sandwiches zu schmieren. Diese Beharrlichkeit, dieses geduldige Schaffen von Strukturen und Beziehungen, machte Bewegungen stark.
„Die Leute sagen oft zu mir: Das klingt nach viel Arbeit“, sagt Stein Lubrano. „Sie hoffen auf eine beruhigende Antwort. Dass es gar nicht so schwer ist, dass kleine Schritte reichen. Aber das wäre gelogen. Die Wahrheit ist: Wir haben verdammt schwierige Probleme, für die es schwierige Lösungen gibt. Aber die Arbeit lohnt sich. Sie macht uns nicht nur reicher an Beziehungen, sondern auch zu anderen Menschen. Wir können darin eine Art von Reichtum finden, die viel besser ist als Geld.“
Redaktion: Rico Grimm, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Iris Hochberger