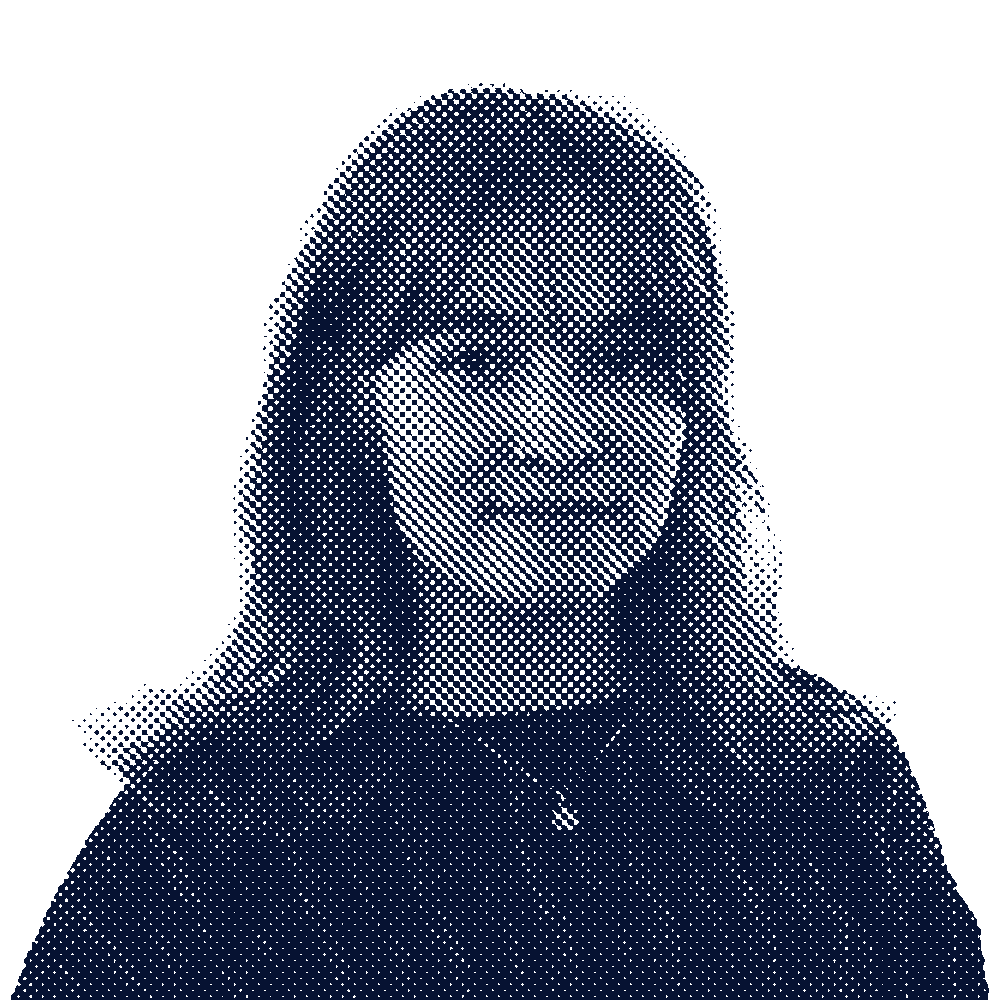Schon nach der Grundschule ahnte ich, dass ich später obdachlos werden würde.
Ich bin in Duisburg geboren und mit Hartz IV groß geworden. Es war nie ein sicheres Heim. Mein Vater und meine Mutter stritten sich. Die Wohnung war zu klein und so unordentlich, dass man den Boden nicht mehr sah. Überall lagen Wäsche, Müll, Essensreste und Pfandflaschen rum. Das Geschirr stapelte sich in der Küche, beim Baden blätterte der Schimmel an der Wand ab und fiel in die Wanne. Ich teilte mir ein Zimmer mit meiner Schwester, die vier Jahre jünger ist.
Ich war als Kind sehr hibbelig, von allem überfordert und tat mich mit anderen Kindern schwer. Ich habe ein Jahr lang nicht gesprochen, weil ich dachte, alle Menschen können meine Gedanken lesen. In der ersten Klasse wollte man mich eigentlich auf eine Sonderschule schicken. Eine Lehrerin widersprach und meinte, sie sehe Potenzial in mir und wolle mich in ihrer Klasse aufnehmen. Als ich sechs Jahre alt war, wurden ein MRT und verschiedene psychologische Tests bei mir durchgeführt, die auf das ADS (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom) wiesen. Sie wollten mich im Krankenhaus behalten und weitere Tests machen. Das wollten meine Eltern aber nicht, und ich habe bis heute keine Diagnosen.
Ich wurde in der Schule ständig vorgeführt, ausgelacht und von einer Lehrerin so hart am Arm gepackt und zum Direktor gebracht, dass ich mit blauen Flecken nach Hause kam. Manchmal wurde ich geprügelt. Als ich nach der dritten Klasse das zweite Mal sitzen blieb, wollte niemand mehr mit mir reden. Meine Projekte aus dem Kunstunterricht (das Einzige, was mir Spaß machte) wurden zerstört.
Ich wurde als hässlich, dumm, stinkig und „Mannsweib“ bezeichnet. Ich habe mich eigentlich immer männlich verhalten und konnte mit anderen Mädchen wenig anfangen. Es dauerte Jahre, bis ich auf das Konzept „transsein“ stieß und mich damit identifizierte. Plötzlich ergab so vieles in meinem Leben Sinn.
Du kannst nichts, du wirst nichts⬆ nach oben
Die Lehrerin, die seit dem Kindergarten an mich glaubte, gab nicht auf, und ich schaffte es auf die Realschule. Dort warteten meine Grundschulmobber auf mich. Auf Facebook kommentierten sie unter meinen Bildern, dass es besser wäre, wenn ich tot sei. Ich wurde wochenlang so stark ignoriert, dass ich tatsächlich dachte, ich sei gestorben. In der fünften Klasse konnte ich das Mobbing nicht mehr ertragen und fing an zu schwänzen.
Meine Klassenlehrerin auf der Realschule konnte mich überhaupt nicht leiden. Irgendwann rief sie meine Mutter an. Es hieß, ich hätte sieben Fünfen auf dem Zeugnis, meine Mutter solle sich umgehend um eine neue Schule für mich kümmern. Also wechselte ich auf eine Waldorfschule. Kaum war ich da, rief der Schulleiter der Realschule an und fragte meine Mutter, wo ich denn sei und warum ich nicht im Unterricht sitze. Sie sagte, es habe geheißen, dass ich nicht mehr auf die Realschule gehen dürfe und dass sie mich abgemeldet habe. Der Schulleiter erklärte, das stimme nicht. Ich hätte in allen Fächern mindestens eine Drei, nur in zwei Nebenfächern eine Fünf. Alles sei in Ordnung.
Eigentlich gefiel mir die Waldorfschule besser. Dort gab es keine Noten, was mir sehr viel Druck nahm. Meine Klassenlehrerin war streng, aber ich hatte Respekt vor ihr. Wenn ich Probleme hatte, zeigte sie Empathie und kümmerte sich. Sie war meine letzte Hoffnung im Schulsystem. Als ich in der achten Klasse war, verließ sie die Schule. Da war ich gerade zwei Jahre dort. Danach hatte ich keine Kraft mehr und sagte mir: Entweder breche ich jetzt ab oder ich beende mein Leben.
Mit 11 Jahren wusste ich eigentlich schon: Ich schaffe niemals den Abschluss. Mir wurde eingetrichtert: Ohne guten Abschluss hat man keine Zukunft. Du kannst nichts und du wirst nichts. Genauso ist es gekommen.
Stell dich nicht so an⬆ nach oben
Ich landete ohne Abschluss und psychisch krank im Jobcenter. Da war ich gerade 15 Jahre alt. Nicht durch Faulheit, sondern durch das, was ich in meiner Jugend durchmachen musste.
Mit 16 schickte man mich zum Ärztlichen Dienst des Jobcenters. Damals war ich stark suizidal und hatte mich an dem Tag an den Armen und Beinen geritzt. Als ich zum Termin kam, war es Sommer. Ich trug ein T-Shirt, die frischen Narben waren sichtbar. Nach zehn Minuten Smalltalk sagten sie: Ich soll mich nicht so anstellen und ihnen nichts vormachen. Ich wäre jung, ich hätte zwei gesunde Beine, ich könne arbeiten.
Vor und nach Terminen beim Jobcenter habe ich immer geweint und an den Tagen mindestens eine Panikattacke gehabt, mit rasendem Herzen und dem Gefühl, zu ersticken.
Zwei Jahre später habe ich es an einer Berufsschule versucht. Ich hatte Schwierigkeiten, ein Praktikum zu bekommen, vielleicht wegen meines Nachnamens, sehr wahrscheinlich wegen der schlechten Noten und des fehlenden Abschlusses. Schließlich nahm mich ein Friedhof als Grabpfleger, obwohl ich beim dazugehörenden Blumenladen angefragt hatte. Die Arbeit auf dem Feld in der prallen Sonne war anstrengend. Psychisch war ich dafür sowieso nicht stabil genug. Ich brach es ab.
Als Nächstes sollte ich eine Maßnahme antreten. Das sind Qualifizierungen, Weiterbildungen und andere Programme, zu denen Bürgergeldempfänger von Jobcentern verpflichtet werden. Als ich es krankheitsbedingt nicht mehr dorthin schaffte, standen die Mitarbeiter sogar vor meiner Haustür, um das zu überprüfen und mit Sanktionen zu drohen. Das hat den Druck nur noch verstärkt.
Komplett in Schwebe⬆ nach oben
Mit 18 hielt ich es bei meinen Eltern zuhause endgültig nicht mehr aus. Meine Familie bildete eine Bedarfsgemeinschaft, das heißt eine Gruppe von Menschen, die zusammen wohnen und für die das Bürgergeld gemeinsam berechnet wird. Man darf aus einer Bedarfsgemeinschaft erst ausziehen, wenn man 25 Jahre alt ist, es sei denn, man hat einen triftigen Grund. Ich nannte meine Psyche. Das Jobcenter überzeugte das nicht.
Also zog ich inoffiziell zu meinem damaligen Freund. Inzwischen bin ich seit acht Jahren wohnungslos. Zum Glück musste ich noch nicht auf der Straße leben und hüpfe zwischen Freunden, Familie und meinem Freund von Couch zu Couch. Ich existiere in Koffern, Tüten und Kellern.
Nach einer fünfjährigen Wartezeit bekam ich 2022 endlich einen Platz für eine psychotherapeutische Begleitung meiner Transition in Baden-Württemberg. Ich durfte zur Familie von meinem Freund ziehen, um die Therapie zu machen. Nach einem Jahr Therapie strich mir das Jobcenter in Baden-Württemberg das Geld komplett. Das war vor dreieinhalb Jahren. Angeblich fehlten Papiere, dabei war ich bei jedem Termin und habe alle Anträge ausgefüllt.
So begann ein dreijähriger Zeitraum, in dem ich überhaupt keine Leistungen bezog – kein Bürgergeld, keine Unterkunftskosten, nichts. Ohne Leistungen verlor ich meine Krankenversicherung und wurde zwangsweise privat versichert. Ich ging gar nicht mehr zum Arzt und musste meine rezeptpflichtige Hormontherapie abbrechen. Inzwischen habe ich dadurch 20.000 Euro Schulden.
Ich zog zurück nach Duisburg zu meiner Mutter, um durch sie wieder an Leistungen zu kommen. Aufgrund von Kommunikationsproblemen zwischen den Jobcentern strichen sie dem ganzen Haushalt – meiner Mutter, meiner Schwester und mir – das Geld.
Wir lebten komplett von der guten Rente und den Rücklagen meiner Oma. Ohne sie wären wir alle obdachlos geworden. Meine Mutter ist schwer krank, sie hat unter anderem Bluthochdruck, Atemnot und eine Gerinnungsstörung. Ohne die Hilfe von meiner Oma hätte sie sich keine Medikamente mehr leisten können, sie hätte nicht überlebt. Uns wurde immer wieder Strom und WLAN abgestellt.
Es frustriert mich, wenn Menschen sich nicht vorstellen können, was passiert, wenn man jemandem die Leistungen kürzt. Sanktionen führen zu keinem Anreiz, sondern dazu, dass die Menschen keine Lust mehr haben zu leben. Sie schaffen Obdachlose, psychisch Kranke und Tote.
Eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt⬆ nach oben
Seit einem Jahr wohne ich bei meinem Freund in Köln. Ich bin hier nicht gemeldet, der Vermieter möchte das nicht. Es dauerte drei Monate, bis das Kölner Jobcenter meinen Antrag auf Bürgergeld annahm. Eine Zeitlang konnte ich die Schecks aber gar nicht abholen. Mein Ausweis war abgelaufen und ich hatte kein Geld, um mir einen neuen machen zu lassen. Die Bank hatte mein Konto geschlossen, weil ich die Gebühr nicht decken konnte. Ohne das eine geht das andere aber nicht: Ohne Ausweis konnte ich mir kein neues Konto eröffnen und keine Schecks abholen, um an Geld für den neuen Ausweis zu kommen. Irgendwann traf ich auf einen netten Mitarbeiter im Postamt, der ein Auge zudrückte und sagte: „Komm, das muss ja irgendwie einen Anfang nehmen.“ Nur dadurch konnte ich meinen ersten Scheck abholen.
Man sagt immer, Bürgergeldempfänger:innen würden nicht mitarbeiten. Es ist eher so, dass man so krank gemacht wird, bis man wirklich nicht mehr kann. Fehler seitens des Jobcenters gehen immer zu Lasten des Leistungsbeziehers. Verrechnen sie sich, muss man alles zurückzahlen, wobei man das Geld selbstverständlich nicht mehr hat. Die Bearbeitungszeiten für Anträge dauern so lange, dass man ohne Hilfe von außen in der Zeit verhungern würde. Manchmal kommt die Post so spät an, dass man die darin genannten Fristen nicht mehr einhalten kann. Selbst wenn man Briefe per Einschreiben schickt oder sogar selbst persönlich in den Briefkasten am Jobcenter einwirft, heißt es, sie hätten nichts bekommen. Nur durch Hilfe der Off Road Kids Stiftung konnte ich überhaupt wieder Bürgergeld beziehen und in die gesetzliche Krankenversicherung kommen. Die Stiftung hilft einem aber nur bis zum 27. Lebensjahr. In einem Jahr bin ich raus.
Unsichtbar⬆ nach oben
Die Wohnung meines Freundes hat 20 Quadratmeter, ist kalt und schimmelt. Die vorbeifahrenden LKWs, die Autowerkstatt nebenan und die Menschen, die durch unsere Fenster im Erdgeschoss reingucken wie im Zoo, rauben mir die Ruhe. Wir haben die Rollläden und Vorhänge immer unten, damit keiner reingucken kann. Wir können kaum lüften, weil schnell Gerüche von Sprit, Lack oder Öl in die Wohnung ziehen.
Ich kämpfe mit einer schweren Depression, Angststörung und Sozialphobie, auch wegen sexueller Gewalt, die ich schon früh erfahren habe. Obwohl ich bis heute keine offiziellen Diagnosen habe, habe ich auch Symptome einer komplexen PTBS, Autismus, ADHS, Schlafstörungen und einer Waschzwangsstörung. Ich bin dadurch schon lange arbeitsunfähig. Inzwischen komme ich kaum aus der Wohnung raus. An den meisten Tagen liege ich stundenlang im Bett. Mein Körper fühlt sich an wie Blei und ich finde keinen Sinn aufzustehen. Ich existiere gefühlt gar nicht mehr.
Lange dachte ich, meine Familie und ich würden einfach verschwinden, ohne dass je jemand erfährt, was wir erlebt haben. Die ständige Hetze gegen Menschen wie uns nimmt mir das letzte Selbstwertgefühl. Dass meine Geschichte jetzt Raum bekommt, fühlt sich an, als würden wir endlich gesehen werden.
Die Wände werden enger⬆ nach oben
Im Grundgesetz steht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Ich sehe jeden Tag, dass es nicht so ist. Der Bürgergeld-Regelsatz reicht dafür nämlich nicht. Jeden Tag muss ich mich entscheiden: Heize ich oder esse ich, esse ich oder wasche ich mich, wasche ich mich oder wasche ich meine Wäsche? Drei Mahlzeiten am Tag konnte ich mir das letzte Mal vor der Pandemie leisten. Ich ernähre mich hauptsächlich von Toastbrot, Instantnudelsuppen oder Hühnerbrühe. Meine Sehkraft hat nachgelassen und ich habe Haarausfall, rissige Lippen und oft Bauchschmerzen. Ich gehe nur zum Arzt, wenn ich denke, dass ich sonst sterbe. Einer meiner Zähne ist so sehr verfault, dass ich Schmerzen beim Kauen habe.
Ich habe schreckliche Angst davor, wieder zum Jobcenter eingeladen zu werden. Man muss bloß alles hinnehmen, immer nicken, weil man sonst die Mitwirkungspflicht verletzt und sehr schnell alles verliert. Seit die Reform zur „neuen Grundsicherung“ angekündigt wurde, durch die die Bedingungen und Sanktionen des Bürgergeldes noch weiter verschärft werden, sehe ich kaum noch einen Grund weiterzuleben.
Ich spüre, wie die Wände enger werden und meine Koffer dem Straßenrand immer näher rücken. Ich mache mich darauf gefasst, irgendwann betteln zu müssen, um zu überleben.
Was mir Kraft gibt⬆ nach oben
Meine Gedanken und meine Kreativität retten mich. Am liebsten schreibe ich Fantasiegeschichten, Gedichte und Songs.
Ich möchte mich engagieren, mit Menschen reden, zusammen nachdenken und Dinge diskutieren. Ich habe schon jemanden gefunden, der den Mindestbeitrag für die Mitgliedschaft bei den Linken für mich bezahlen würde (1,50 Euro monatlich). Sollte es mir wieder besser gehen, möchte ich eintreten.
Ich habe es inzwischen geschafft, trotz fehlender Meldeadresse ein Online-Bankkonto einzurichten, mit dem ich endlich einen Antrag auf eine Wohnung stellen kann. Was mir aber am meisten helfen würde, sind Diagnosen. Das gäbe mir Sicherheit, denn ohne wird man nicht gesehen. Ich möchte Therapie machen. Ich möchte eine Anpassung des Regelsatzes an die Inflation. Armut und Wohnungslosigkeit isolieren und machen noch kränker. Ohne Arbeit keine Wohnung, ohne Wohnung keine Arbeit und ohne Wohnung keine Wohnung. Wer einmal alles verliert, kommt da nicht mehr eigenständig raus.
Hinter Obdachlosigkeit stecken immer Schicksale. Es kann jeden treffen. Ich wünsche mir, dass Menschen sich immer erstmal fragen, warum jemand gerade da ist, wo er ist.
Anlaufstellen für den Notfall:
Psychiater:innen, Psychotherapeut:innen und Hausärzt:innen. Im Zweifel den Notdienst (in Deutschland die 112) anrufen.
Für Kinder und Jugendliche gibt es die Youth-Life-Line und Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr die Nummer gegen Kummer: 0800 1110333 und die 116111.
Wenn man selbst betroffen ist, kann man die Telefonseelsorge unter den Nummern 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 erreichen. Der Anruf ist kostenlos und erscheint nicht auf der Telefonrechnung.
Red freut sich über den Austausch mit KR-Leser:innen und ist offen für Nachrichten, Kommentare oder Fragen zu seiner Geschichte. Sein Instagram lautet @bluemonsterred_
Redaktion: Lea Schönborn, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Gabriel Schäfer, Audioversion: Christian Melchert