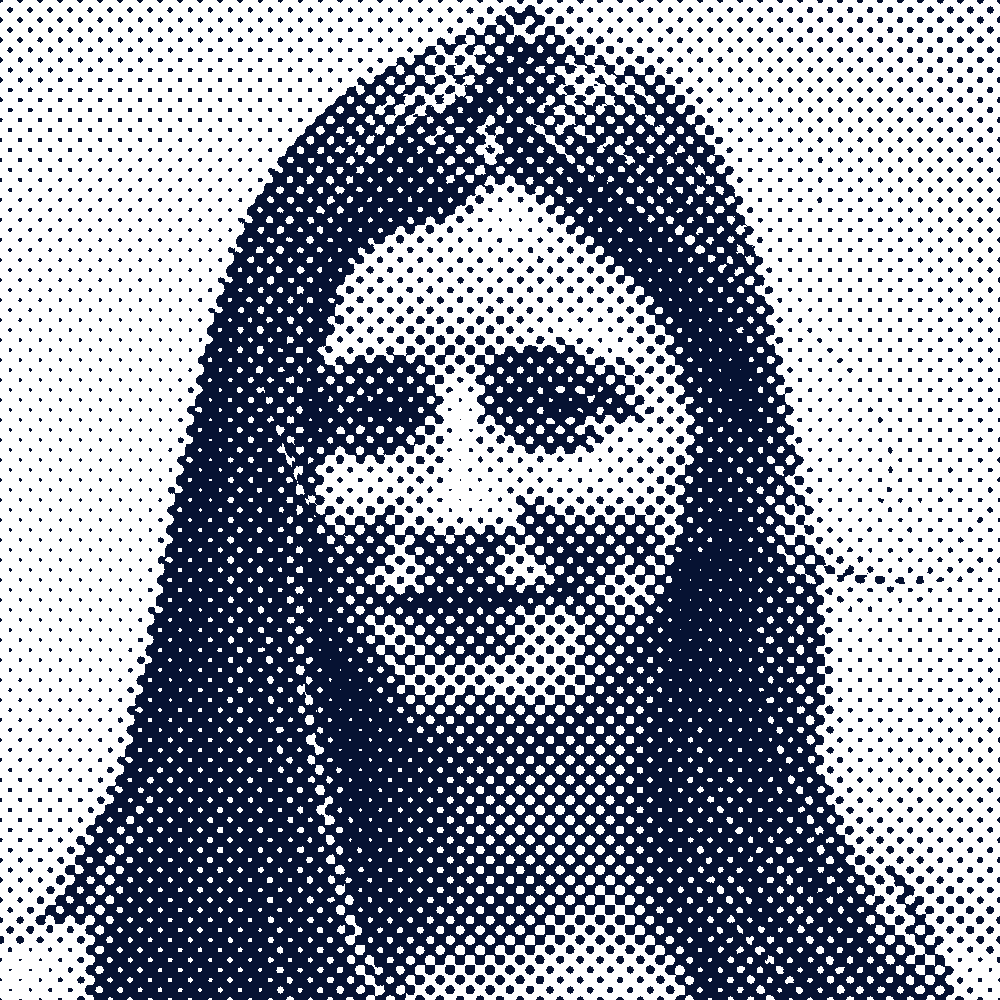Das Unglück, das Tanja widerfahren ist, hätte für mehrere Leben gereicht. Mit neun Jahren zog sie in ein Kinderheim. Mit Mitte 20 bekam sie Brustkrebs. Drei Monate lag sie im Koma. Als sie aufwachte, hatte sie 240.000 Euro Schulden, Panikattacken und eine Privatinsolvenz. Inzwischen hat Tanja wieder Krebs, es ist das dritte Mal, dieses Mal eine chronische Art. Zum Leben hat sie nur Bürgergeld.
Aber Tanja sieht sich nicht als Opfer. „Ich könnte mich natürlich in die Ecke setzen und mein Leben beklagen, aber das hilft weder mir noch meiner Tochter.“ Mit ihrem dunklen Bob und der schwarzen Kleidung wirkt sie selbstbewusst. Während sie erzählt, lacht sie über die Fliege, die zwischen uns schwirrt, zwischendurch kommt ihre achtjährige Tochter Clara zum Kuscheln rein. Auf dem Tisch hat Tanja Kekse und Weintrauben angerichtet, auf dem Bett liegt eine glattgestrichene Tagesdecke.
Über Menschen wie Tanja – über Bürgergeld-Empfänger:innen – wird in Deutschland bei Talkshows und Stammtischen diskutiert. Dann geht es darum, ob die nicht zu viel bekommen, wie arbeitswillig die seien. Nun will die Union zehn Prozent des Budgets beim Bürgergeld einsparen. Bürgergeld-Empfänger:innen selbst kommen in dieser Debatte selten zu Wort.
Dabei können sich die meisten Deutschen vieles an deren Alltag kaum vorstellen. Ich wollte von Bürgergeld-Empfänger:innen wissen, welche Aspekte das sind. Dafür habe ich eine nicht-repräsentative Umfrage gestartet, an der 100 Menschen teilgenommen haben. Außerdem habe ich neben Tanja noch mit einer anderen Bürgergeld-Empfängerin und mit drei Expert:innen gesprochen.
Aktuell bekommen in Deutschland 5,4 Millionen Menschen Bürgergeld. Davon galten im August 1,4 Millionen als nicht erwerbsfähig, weil sie jünger als 15 Jahre sind oder so krank, dass sie laut Gutachten nicht mehr als drei Stunden am Tag arbeiten können. 3,9 Millionen Bürgergeld-Empfänger:innen könnten laut der Bundesagentur für Arbeit einem Job nachgehen. Von ihnen waren 2023 weniger als die Hälfte tatsächlich arbeitslos. Die anderen pflegten Angehörige, gingen noch zur Schule, steckten in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen oder arbeiteten einfach und stockten mit dem Bürgergeld auf.
Was es bedeutet, Bürgergeld zu bekommen, lässt sich deshalb nicht anhand von einer Geschichte erzählen. Was hat die ukrainische Familie mit dem promovierten Chemiker gemein, der nicht sofort eine adäquate Stelle findet, weil die Branche schwächelt? Was die krebskranke Tanja mit Alexandra, einer Marketing-Fachkraft, die wegen eines Burnouts arbeitsunfähig wurde?
Vor allem dieses: Der Name des Geldes, von dem sie leben, ist heute hoch politisiert. Und trotzdem können sich wohl die wenigsten Menschen vorstellen, wie Bürgergeld den Alltag prägt. Fünf Schlaglichter:
Wie anstrengend es ist, über die Runden zu kommen⬆ nach oben

Tanja auf ihrer Couch in Berlin-Kreuzberg | © Rebecca Kelber
Tanja hat über die Jahre Strategien entwickelt, um mit ihrem Geld hauszuhalten. Sie macht am Anfang des Monats einen Großeinkauf, um gar nicht erst in Versuchung zu geraten, das Geld für andere Dinge auszugeben. Sie blättert durch Prospekte, sucht Rabattaktionen, um möglichst viel zu sparen. Obst und Gemüse kauft sie freitags auf dem Markt bei ihr um die Ecke, weil dort große Mengen günstig angeboten werden.
Seit sechs Jahren hat sie sich keine neuen Klamotten gekauft. Braucht ihre Tochter neue Kleidung, übernehmen das oft die Großeltern. Manchmal geht Tanja in Second-Hand-Läden oder zur Kleiderkammer. „Anders würde es nicht gehen.“ Trotzdem muss sie sich am Ende des Monats öfter mal 20 Euro von Freund:innen leihen, ein unangenehmes Gefühl.
In einer von dem Verein „Sanktionsfrei“ beauftragten Studie vom Juni dieses Jahres stimmten nur neun Prozent der befragten Bürgergeld-Empfänger:innen der Aussage zu, mit dem Regelsatz könne man sich gesund ernähren. Für Alleinstehende liegt der bei 563 Euro pro Monat. Über die Hälfte der Eltern sagen, dass sie selbst auf Essen verzichten, damit ihre Kinder genug bekämen. In meiner Umfrage unter Krautreporter-Leser:innen berichten mehrere Bürgergeld-Empfänger:innen, sie könnten sich die Zuzahlung für wichtige Medikamente nicht leisten.
Tanja hat wenig Scheu, Hilfsangebote zu nutzen. Etwa Geld anzunehmen, um ihrer Tochter Schulmaterial kaufen zu können oder im Urlaub bei guten Freund:innen unterzukommen, weil sie sich keine Unterkunft leisten könnte.
Aber viele Bürgergeld-Empfänger:innen tun sich schwer damit, Hilfe anzunehmen. Bei der Studie von Sanktionsfrei sagten 42 Prozent, sie würden sich schämen, Bürgergeld zu bekommen.
Gleichzeitig gelten für Geldgeschenke strenge Grenzen. Das Jobcenter schaut sich regelmäßig die Kontoauszüge an. Bürgergeld-Empfänger:innen dürfen im Jahr 50 Euro geschenkt bekommen. Alles darüber wird verrechnet.
Wie einsam Armut macht⬆ nach oben
Wer arm ist, fühlt sich häufiger einsam. Mehrere Studien haben das gezeigt. Wenn man wenig Geld hat, ist es viel schwieriger, Freund:innen regelmäßig zu sehen. Alexandra hat das erlebt. Vor zwei Jahren arbeitete sie 60 Stunden die Woche im Marketing in einer Münchner Agentur. Abends traf sie sich regelmäßig mit ihren Freund:innen im Restaurant, in der Kneipe oder auf einem Konzert. Sie sagt, sie hätte nie gedacht, dass sie mal Bürgergeld beziehen würde.
Dann kamen die Panikattacken, beinahe täglich. Bevor sie sich in der Lage fühlte, zur Arbeit zu fahren, musste sie erstmal spazieren gehen. Selbst einfache Aufgaben wie Einkaufen überforderten Alexandra. Sie ließ sich krankschreiben und beantragte erst Arbeitslosen- und nach einem Jahr Bürgergeld.
Eigentlich fühlte sich Alexandra von ihren Freund:innen damals unterstützt. Ohne sie hätte sie es nicht geschafft, sich um einen Platz in einer psychiatrischen Klinik zu kümmern, sagt sie. Trotzdem sieht Alexandra ihre Freund:innen deutlich seltener, seitdem sie Bürgergeld bekommt. Das erzählt sie am Telefon.
Treffen sich ihre Freund:innen jetzt nach der Arbeit zum Essen oder auf ein Bierchen, kann sie nicht mitkommen, weil ihr das Geld dafür fehlt. Selbst ein ÖPNV-Ticket kann sie sich kaum leisten. Gleichzeitig arbeiten die meisten Menschen in ihrem Umfeld viel und haben dementsprechend wenig Zeit. Letztes Jahr musste sie immer wieder auf Gruppenaktivitäten verzichten. Auch am Junggesellinnenabschied und der Hochzeit einer guten Freundin konnte sie nicht teilnehmen, weil sie das Hotel nicht bezahlen konnte und sich nicht schon wieder was leihen wollte. Sie sagt: „Sowas tut weh. Das sind einmalige Erlebnisse, bei denen ich gefehlt habe.“
Dazu kommt: Gerade am Anfang hat sich Alexandra sehr dafür geschämt, Bürgergeld zu bekommen. Bis heute will sie nicht, dass entferntere Freund:innen oder Bekannte davon erfahren, auch deshalb steht hier ihr Nachname nicht.
Mehrere Teilnehmer:innen meiner Umfrage berichten, dass sie nach und nach Freund:innen verloren hätten. Bei der Studie von Sanktionsfrei sagen nur zwölf Prozent der Teilnehmer:innen, sie würden am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Auch eine IAB-Studie kommt zu dem Schluss, dass Arbeitslose häufiger unzufrieden mit ihren Sozialkontakten sind.
Natürlich trifft das nicht auf jede:n zu. Tanja etwa erzählt, was für ein großes Glück ihre Freund:innen für sie seien. Aber auch sie hat heute ein anderes Umfeld als noch vor einigen Jahren, als sie im wohlhabenderen Berlin-Charlottenburg lebte und berufstätig war. Heute arbeiten viele ihrer engsten Bezugspersonen im sozialen Bereich und bringen Verständnis für ihre Situation mit.
Wie oft man es erlebt, von oben herab behandelt zu werden⬆ nach oben
Wer von seinem Gehalt gut leben kann und keine Kinder hat, hat wohl selten mit Behörden zu tun: vielleicht, wenn man sich ummeldet, heiratet oder wie jedes Jahr seine Steuererklärung macht. Wer Bürgergeld bekommt, muss dagegen regelmäßig zu einem Jobcenter. In meiner Umfrage berichten mehrere Teilnehmer:innen, als wie unangenehm sie den Kontakt mit Jobcenter-Mitarbeiter:innen empfinden.
Lucas, der eigentlich anders heißt, war schon in jungen Jahren arbeitslos. Er schreibt: „Wenn man als junger Mensch arbeitsunfähig wird, gilt man beim Jobcenter schnell als Simulant. Zumindest ist das meine Erfahrung.“ Das begann bei abwertenden Kommentaren von Jobcenter-Mitarbeiter:innen. Er sagt, er wurde als Bittsteller bezeichnet oder es sei von „Menschen wie Ihnen“ geredet worden. Ein andermal hätte ein Jobcenter-Mitarbeiter zu ihm gesagt, es sei ja wohl nicht zu viel verlangt, zumindest hier ordentlich mitzuarbeiten, wenn er sonst schon nichts tue. Er schreibt: „Ich empfand das als sehr erniedrigend, vor allem, da es manchmal schon von Mitarbeiter:innen im Eingangsbereich kam, also mit Publikum.“
Auch Alexandra erzählt von solchen negativen Erfahrungen. Sie brachte mehrere Jahre Berufserfahrung und einen sehr guten Master-Abschluss in Amerikanistik mit. Trotzdem sagte ihr Sachbearbeiter: „Mit dem Studium können Sie froh sein, wenn Sie überhaupt was finden.“ Ein entmutigender Kommentar für sie, die sich große Sorgen machte, keine neue Arbeit zu finden und in den zwei Jahren Arbeitslosigkeit 80 Bewerbungen schrieb.
Ob sich Bürgergeld-Empfänger:innen von oben herab behandelt fühlen, hängt stark von der Sachbearbeiterin ab. Und unter ihnen gibt es auch zugewandte. Immerhin 48 Prozent der Bürgergeld-Empfänger:innen sagten in der Studie von Sanktionsfrei, sie würden von den Jobcenter-Mitarbeiter:innen freundlich behandelt werden. Auch Tanja berichtet, ihre Arbeitsvermittlerin würde ihre gesundheitliche Situation verstehen.
Wie sehr man dem Jobcenter ausgeliefert ist⬆ nach oben
Das Machtgefälle zwischen Bürgergeld-Empfänger:innen auf der einen Seite und den Jobcenter-Mitarbeiter:innen auf der anderen Seite führe immer wieder zu Fällen behördlicher Willkür. Das schildert Helena Steinhaus vom Verein Sanktionsfrei.
Etwa, wenn jemand in einer Bedarfsgemeinschaft einen Minijob annimmt und deshalb die Leistungen neu berechnet werden müssen. Sie sagt: „Manche Sachbearbeiter lassen kein Geld auszahlen, bis die Neuberechnung fertig ist, obwohl klar ist, dass die Familie nicht von dem einen Minijob leben kann. Da entstehen finanzielle Lücken.“ Die gleicht dann ihr Verein aus. Aber Steinhaus sagt: „Das ist Willkür und dagegen gehen wir auch vor.“
Genauso wirken manche Entscheidungen von außen schwer nachvollziehbar. Alexandra zum Beispiel wollte sich nach ihrem zweiten Burn-out umschulen lassen. Ihr bisheriger Job im Marketing war nicht nur extrem arbeitsintensiv, sondern machte ihr auch wenig Spaß. Eine gefährliche Mischung für ihre psychische Gesundheit. Doch weder die Arbeitsagentur noch das Jobcenter genehmigten ihre Anträge für eine Weiterbildung als Datenanalystin, weil sie dafür bereits zu hoch qualifiziert sei. Sie bildete sich schließlich von ihrem Ersparten weiter und lernte so die Grundlagen vom Programmieren.
Ein anderer Bereich, in dem Helena Steinhaus schwer nachvollziehbare Entscheidungen des Jobcenters beklagt, sind die Darlehen. Die können Bürgergeld-Empfänger:innen beantragen, wenn etwa der Kühlschrank oder die Waschmaschine kaputtgehen. Das Darlehen wird dann über die kommenden Monate vom Bürgergeld-Satz abgezogen.
Aber nicht immer genehmigen Jobcenter-Mitarbeiter:innen diese Anträge. Steinhaus erzählt von einem achtjährigen Kind, das schwer kurzsichtig sei. Es brauche laut Augenarzt dringend Myopie-Gläser. Andernfalls könnte es später erblinden. Die Krankenkasse hätte die Kosten von knapp 300 Euro nicht übernommen und auch das Jobcenter lehnte ein Darlehen ab. Sanktionsfrei übernahm dann die Kosten.
Wie es ist, wenn einem das Geld gestrichen wird – komplett⬆ nach oben
Das stärkste Instrument, das die Jobcenter zur Verfügung haben, ist die Sanktionierung. Und es ist wohl auch das umstrittenste. Während einige Jobcenter-Mitarbeiter:innen beklagen, ohne diese Maßnahme würden sie manche Bürgergeld-Empfänger:innen nie zu Gesicht bekommen, warnen andere vor den negativen Folgen dieser Sanktionen.
Sanktionen können sich existenzbedrohend anfühlen. So erging es Tanja Anfang des Jahres. Sie wurde für zwei Monate vollsanktioniert, das Jobcenter übernahm für diese Zeit auch nicht die Krankenversicherung. Und das, obwohl Tanja aufgrund ihrer chronischen myeloischen Leukämie darauf angewiesen ist, täglich teure Medikamente zu nehmen. Zu ihrem Glück sprang erst ihr Ex-Freund ein und nahm einen Arbeitskredit auf, damit sie die Miete für die Wohnung weiterbezahlen konnte, danach half ihr der Verein Sanktionsfrei.
So weit weg diese Erfahrungen klingen mögen, niemand ist davor gefeit, krank zu werden, im Job auszufallen und den Anschluss an den Arbeitsmarkt zu verpassen. Auch für Alexandra klang das früher weit weg. Bis es nach ihrem Burnout für sie Realität geworden ist.
Redaktion: Astrid Probst, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert