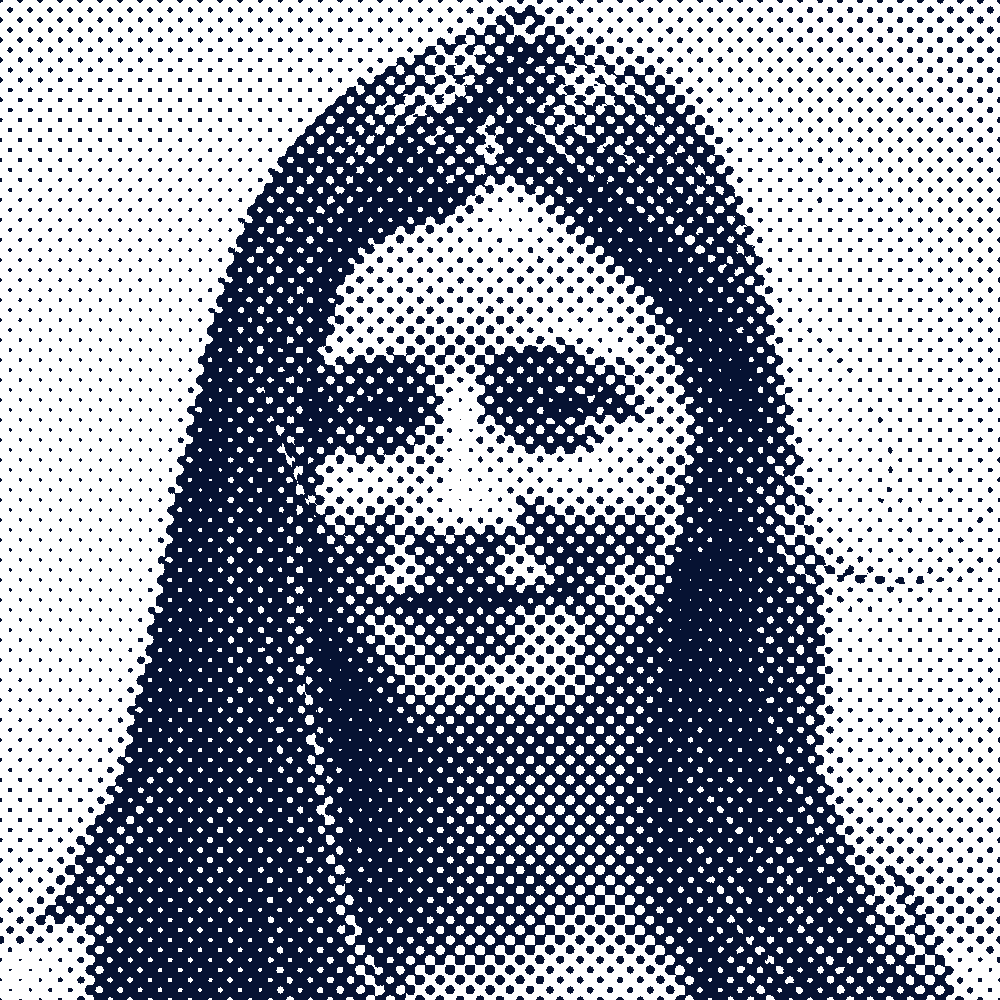CumEx – das gilt als sperriges Schlagwort für einen der größten Steuerbetrüge in der Geschichte der Bundesrepublik. Schätzungsweise 10 Milliarden Euro stahlen Banken, Investor:innen und Anwält:innen mit gezielten Aktiengeschäften dem deutschen Staat.
Eigentlich sollte CumEx längst Geschichte sein, aber mit anderen Methoden läuft der Steuerbetrug weiter.
Das jedenfalls sagt Anne Brorhilker. Als Staatsanwältin ermittelte sie elf Jahre federführend gegen CumEx. Auf der anderen Seite: reiche Männer mit guten Verbindungen und teuren Anwält:innen. Trotzdem brachte Brorhiker mehrere von ihnen auf die Anklagebank, manche sogar ins Gefängnis.
Vor einem Jahr hörte sie überraschend bei der Staatsanwaltschaft Köln auf, verzichtete auf ihr Beamtengehalt und ihre Pensionsansprüche und wechselte zur NGO Finanzwende. Damals sagte sie: „Ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Wirtschaftskriminalität verfolgt wird.“
Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie sie Beweise für die organisierte Steuerhinterziehung sammelte, warum ihr persönliche Angriffe nicht so viel ausmachen und was die Bundesregierung tun müsste, um einen Großteil der 100 Milliarden Euro, die jährlich an Steuern hinterzogen werden, einzutreiben.
Frau Brorhilker, dass Sie Ihren ersten CumEx-Fall bekommen haben, war Zufall. Die Schadenssumme lag bei 460 Millionen Euro. Was dachten Sie, als Sie die Akte zum ersten Mal sahen?
Anne Brorhilker: Mir war schnell klar, dass der Fall außergewöhnlich war. Ich habe mich auf Gegenwehr eingestellt. Das lag zum einen an der hohen Schadenssumme, zum anderen an der Gegenseite, in diesem Fall US-Pensionsfonds. Das waren sehr professionelle Akteure, mit denen wir in der Staatsanwaltschaft sonst selten zu tun hatten. Ich wusste damals schon, dass die das Bundeszentralamt für Steuern, die steuerrechtlich zuständig waren, unter Druck gesetzt hatten. Die Pensionsfonds hatten beispielsweise das ganze Amt verklagt. Aber ganz viel war noch unklar: Die Mechanik hinter CumEx war noch nicht bekannt. Die große Frage am Anfang war, wie wir die nötigen Beweise sammeln, um zu verstehen, was da auf Bankenseite passiert.
Viele schalten sofort ab, wenn sie das Wort „Cum-Ex“ hören. Zu komplex, zu weit weg. Dabei ist das Wichtigste schnell zu erklären: Es waren illegale Aktiengeschäfte, bei denen sich Banken eine Steuer mehrfach erstatten ließen. Genauer: die Kapitalertragssteuer rund um den Dividendenstichtag. Dafür arbeiteten verschiedene Banken eng zusammen. Den ersten CumEx-Fall gab es schon 1990.
Wie haben Sie die Beweise dann gesammelt?
Ich bin beim Landeskriminalamt vorstellig geworden. Das hat den Fall übernommen und sehr professionell eine riesige Auslandsdurchsuchung durchgeführt. Das war wirklich sehr ungewöhnlich. Da war ich erst mal froh, dass das alles gut über die Bühne gegangen und erfolgreich verlaufen ist (lacht).
Allerdings hat allein diese Beweissicherung Jahre gedauert.
Brorhilker organisierte gemeinsam mit vier Mitarbeitern des LKA Düsseldorf eine der größten internationalen Razzien in der Geschichte der Bundesrepublik. Am 14. Oktober 2014 betraten Fahnder in 14 Ländern fast zeitgleich 130 Gebäude. Dabei sicherten sie lastwagenweise Akten von Kanzleien und Banken – die Grundlage, auf der Brorhilker und ihr Team weiter ermittelten.
Wann ist Ihnen das Ausmaß von CumEx bewusst geworden?
Das hat eine Weile gedauert. Am Anfang gingen wir alle davon aus, dass hinter CumEx eine kleine Gruppe schwarzer Schafe steckt. Wie falsch unsere Annahme war, wurde erst durch die Insider aus dem Bankenbereich klar, die wir vernommen haben. Die hatten alle so 10, 15 Jahre bei internationalen Großbanken gearbeitet, meist auch im Ausland, und schilderten uns dann unabhängig voneinander, dass CumEx-Geschäfte für sie ein normaler Arbeitsbereich waren.
Diese CumEx-Geschäfte waren in jeder Hinsicht gigantisch: Man benötigte immens viel Startkapital, um die Geschäfte überhaupt starten zu können, die gehandelten Aktienpakete waren wahnsinnig groß und die erschlichenen Steuererstattungen bewegten sich jeweils im zwei- und dreistelligen Millionenbereich. Weil die Dimensionen so groß waren, mussten diese Trades intern genehmigt werden, und der Genehmigungsprozess geht einmal quer durch die Bank bis zum Vorstand. Wir haben E-Mails innerhalb von Banken gesehen, bei denen 50 Personen im Verteiler waren. Das machte uns klar: hier ging es nicht um zwei, drei aus dem Ruder gelaufene Trader, sondern da war der gesamte Apparat involviert.
Auch in den Organigrammen von Banken hat man diesen Bereich der „Tax Trades“ erkennen können, den Insider „Delta One“ nennen. Das ist ein Segment, in dem Trader Aktien-Deals machen, deren Profit allein aus steuerlichen Effekten herrührt. Ich fand frappierend, wie offen ausgewiesen dieser Bereich war, bei dem Banken in unsere Steuerkassen greifen.
Warum sind diese Geschäfte so lange niemandem aufgefallen?
Die Banken haben die Geschäfte hochprofessionell verschleiert und die Behörde über Ablauf und Umfang der Geschäfte häufig bewusst getäuscht. Wenn staatliche Behörden versucht haben, CumEx-Fälle zu prüfen, gab es außerdem viel Gegenwehr mithilfe von teuren Anwaltskanzleien. Und das war nicht nur in Deutschland so. Diese Geschäfte gab es weltweit, besonders Europa war stark davon betroffen. Lange hat kein Staat gesehen, wie viel Geld ihm da verloren geht.
Als Sie die Ermittlung übernommen haben, gab es noch kein Urteil, das CumEx für illegal erklärt hatte. Im Gegenteil: Sogar Rechtsgutachten behaupteten, das Vorgehen sei legal. Hatten Sie manchmal Zweifel daran, dass CumEx wirklich illegal ist?
Nein. Ich hatte deswegen keine Zweifel, weil ich mich vorher als Staatsanwältin viel mit Umsatzsteuerkarussellen beschäftigt hatte. Das war ein Glücksfall, denn die sind von der Struktur und der rechtlichen Argumentation vergleichbar mit CumEx-Kreisgeschäften. In beiden Fällen findet kein echter Handel mit Waren oder Aktien statt, sondern diese werden nur im Kreis bewegt, um die Finanzämter zu täuschen. Es geht in beiden Fällen nur darum, sich Steuern erstatten zu lassen, die zuvor gar nicht abgeführt worden sind.
Und es hat sie nicht verunsichert, dass diese Geschäfte in so einem industriellen Maßstab vonstattengingen?
Nur weil viele etwas machen, heißt das ja nicht, dass es legal ist. Auf die Idee würden wir bei Ladendiebstahl auch nicht kommen. Anders als Ladendiebe reagieren Wirtschaftskriminelle aber häufig nicht schuldbewusst, wenn sie erwischt werden. Sie sind um Ausreden meist nicht verlegen. Wir haben viele Leute aus der Branche vernommen. Wenn diese mir gegenüber saßen, haben immer alle als Erstes gesagt: „Ich habe gedacht, das wäre legal.“ Da habe ich gefragt: „Erklären Sie mir das mal. Wieso sind Sie denn der Meinung, dass man sich eine Steuer erstatten lassen kann, die man zuvor nicht bezahlt hat?“ Und jedes Mal kam: „Das weiß ich auch nicht, aber das sagt unser Rechtsberater.“
Viele Beratungskanzleien haben ein kompliziertes Argumentationsgerüst gebaut, das zwar einer genaueren rechtlichen Prüfung nicht standhielt, aber zunächst mal mit vielen Worten beeindrucken und verunsichern sollte. Viele lange und komplizierte Sätze sollten vom Kern der Geschäfte ablenken und dem Leser vermitteln: Du bist kein Steuerrechtsexperte, deshalb kannst du das gar nicht beurteilen. Dabei haben Gerichte später festgestellt, dass es eigentlich ganz einfach ist. Man kann sich nicht Steuern erstatten lassen, die vorher keiner gezahlt hat. Das entspricht sicherlich auch dem Rechtsgefühl, das die meisten Menschen haben. Und dieses Rechtsgefühl war genau richtig, wie Gerichte später festgestellt haben. Die langen Sätze und vielen Worte der angeblichen Experten wurden als das entlarvt, was sie waren: Gefälligkeitsgutachten. Diese konnte die Täter nicht entlasten, sodass sie verurteilt wurden. Einige sind dafür auch ins Gefängnis gegangen.
Der wohl bekannteste dieser Experten: Der Rechtsanwalt Hanno Berger, jahrzehntelang einer der renommiertesten Steuerrechtsanwälte der Bundesrepublik. Er gilt als Initiator der CumEx-Geschäfte. Bis heute streitet er ab, dass diese illegal waren, und behauptet, er hätte eine Gesetzeslücke genutzt. Das Gericht sah das anders: Aktuell sitzt er für acht Jahre im Gefängnis.
Ich stelle mir Ihre Arbeit sehr anstrengend vor, vor allem in dieser Anfangszeit als Staatsanwältin, als Sie nur Wenige im Team waren. Was war das Anstrengendste an Ihrem Job?
Das kann ich schwer sagen. Ich habe viel gearbeitet, aber das hat mir nicht so viel ausgemacht, weil ich Spaß bei der Arbeit hatte. Ich habe die Schwierigkeiten immer auch als Herausforderung betrachtet, für die wir mit unseren vorhandenen Mitteln eine Lösung finden müssen, etwa wenn wir wenig Personal hatten oder wenn die Gegenseite sehr viel Gegenwind entfacht hat. Das waren Probleme, für die wir uns im Team dann jeweils Lösungswege ausgedacht haben. Auch Angriffe von außen haben mich nicht so getroffen.
Weniger als anderen Kolleg:innen?
Ja. Da hatte ich einfach Glück, das liegt an meiner Persönlichkeitsstruktur. Wenn man im Bereich Wirtschaftskriminalität arbeitet, ist der Ton sehr rau, auch vor Gericht. Das hat mir auch einmal eine Kollegin bestätigt, die in meinen Bereich gekommen ist und vorher organisierte Kriminalität bearbeitet hat, zum Beispiel ganz harte Rockerbanden. Als sie ihren ersten Prozess bei CumEx hatte, meinte sie, so ein Verhalten von Strafverteidigern habe sie überhaupt noch nie erlebt. Manches war auch wirklich so übertrieben, dass es schon fast lustig war.
Dürfen Sie dafür ein Beispiel nennen?
Vor Gericht hat sich mal ein Verteidiger über mich geärgert, weil ich mich nicht von ihm habe einschüchtern lassen, was er aber wohl erwartet hatte. Da hat er mir empört entgegengeworfen: „Sie mit Ihrer billig wirkenden Kleidung und Ihrem verrutschten Make-up“ (lacht). So etwas nehme ich nicht ernst.
Abgesehen davon hat sich im Bereich Wirtschaftskriminalität in den vergangenen Jahren einiges geändert. Inzwischen leistet sich, wer viel Geld zur Verfügung hat, nicht nur teure Anwaltsteams, sondern auch PR-Berater. Die versuchen, die Ermittlungen und später auch die Prozesse vor Gericht durch öffentlichen Druck zu beeinflussen, auch über Medienkampagnen. Immer wieder erhebt jemand Strafanzeige gegen mich und meldet dies sofort den Medien. Das ist ein typischer Anlass, um Raum in Medien zu bekommen und sich darüber auszulassen, wie unverschämt die Strafverfolgung bei CumEx ist, wie wenig rechtsstaatlich und was da immer alles so kommt an Textbausteinen.
Staatsanwältinnen wie ich werden dann immer wieder mit den gleichen Adjektiven versehen: „verbissen“, „ehrgeizig“ und „profilneurotisch“.
Nach Recherchen des Handelsblatts haben Sie auch deswegen als Staatsanwältin aufgehört, weil man Sie teilweise schief angeschaut hat, weil sie so viel gearbeitet haben. Sie bekamen auch nicht die Unterstützung von Vorgesetzten, die Sie sich wünschten. Stimmt das?
Das fällt unter das Dienstgeheimnis, dazu darf ich nichts sagen.
Laut dem Handelsblatt hielten Beamt:innen der Staatsanwaltschaft Köln Brorhilker für „übergeschnappt“, weil sie so viel arbeitete. Ihr direkter Chef soll ihr nicht geholfen, sondern ihr Druck gemacht haben, wann sie endlich mit CumEx fertig sei. Immer wieder sollen sie sich lautstark gestritten haben. Auch von Minister-Ebene gab es wenig Unterstützung. Einzige Ausnahme: Der CDU-Politiker Peter Biesenbach, von 2017 bis 2022 NRW-Justizminister. Er machte Brorhilker zur Hauptabteilungsleiterin und besorgte ihr mehr Personal. Als sein Nachfolger Benjamin Limbach (Grüne) sie 2023 entmachten und ihr die Hälfte der Leute wegnehmen wollte, soll sich Brorhilker für den Ausstieg als Staatsanwältin entschieden haben. Nach öffentlicher Kritik ruderte Limbach zwar zurück – aber da war es anscheinend bereits zu spät.
Als Sie Ihren Wechsel von der Staatsanwaltschaft zur NGO Finanzwende bekannt gegeben haben, haben Sie gesagt: „Ich habe gemerkt, wie schwer es ist, beim Thema CumEx ausreichend Unterstützung zu bekommen. Und das liegt nicht daran, dass die Behörden und die Politik das Thema nicht verstanden haben.“ Woran liegt es denn dann?
Ich glaube, es liegt an zwei Faktoren. Erstens sind Behörden in allen Bereichen – Justiz, Polizei, Finanzverwaltung – zu schwach aufgestellt. Sie leiden unter anderem unter Personalmangel, veralteter technischer Ausstattung und wenig Austausch der Behörden untereinander. Insbesondere komplexe und schwierige Fälle können sie daher kaum bewältigen und die bleiben dann in der Praxis liegen oder werden auch mal mit einem schnellen „Deal“ beendet.
Die jeweils verantwortlichen Minister könnten hier gegensteuern und die Behörden gerade beim Kampf gegen gravierende Fälle von Wirtschaftskriminalität unterstützen, etwa indem sie Prioritäten klar festlegen und für ausreichend Personal und Sachmittel sorgen. In Nordrhein-Westfalen haben die Minister dies im Kampf gegen CumEx zeitweise getan. Der ehemalige Justizminister Peter Biesenbach hat speziell für die Bearbeitung von CumEx Stellen bei der Staatsanwaltschaft Köln geschaffen und sowohl der Innenminister als auch der Finanzminister in NRW haben für mehr polizeiliche Ermittler und Steuerfahnder gesorgt. Leider hat diese politische Unterstützung mittlerweile offenbar wieder nachgelassen.
Und der zweite Faktor?
Dazu muss ich etwas ausholen: Geschätzt gehen uns allen allein durch Steuerhinterziehung jedes Jahr 100 Milliarden Euro durch die Lappen. Wenn wir dieses Geld jedes Jahr zur Verfügung hätten, dann wäre politisch viel mehr möglich in Deutschland. Es wäre also zu erwarten, dass der Staat entschlossen gegen Wirtschaftskriminalität und Steuerhinterziehung vorgeht. Das Gegenteil ist aber der Fall!
So ist etwa die Zahl der Betriebsprüfer in den letzten Jahren stetig gesunken, obwohl jeder Betriebsprüfer ein Vielfaches dessen für den Staat hereinholt, was er selbst kostet. Warum?
Die mächtige Finanzlobby hat etwas dagegen. Seit drei Jahren gibt es in Deutschland das Lobbyregister und seit drei Jahren steht die Finanzlobby unangefochten an seiner Spitze. In 2024 stammen zehn der 100 finanzstärksten Einträge im Lobbyregister von Banken, Versicherern und der Fondsindustrie. Diese geben fast 40 Millionen Euro pro Jahr für Lobbyarbeit aus. Das ist mehr als Auto- und Chemielobby zusammen.
442 Lobbyisten und Lobbyistinnen, also umgerechnet fast zehn für jedes Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags, beeinflussen Prozesse und Gesetze für die Finanzlobby. Diese ist damit den Vertretern der Zivilgesellschaft klar überlegen, was zu einem gefährlichen Ungleichgewicht in der Interessenvertretung führt.
Wie genau arbeiten diese Lobbyist:innen denn?
Sie verbreiten zum Beispiel Narrative, die plausibel klingen, aber einfach falsch sind. Gerade im finanzpolitischen Bereich ist das für Laien oft schwer zu durchschauen. Nicht jeder Politiker ist ein Finanzmarktexperte, kann er ja auch gar nicht sein. Meistens geht die Lobby dabei wie folgt vor: In einem ersten Schritt wird ein kriminelles Konstrukt wie CumEx verharmlost. Dann heißt es, das sei nur eine kleine Gruppe schwarzer Schafe. Oder das seien alles falsche Zahlen, es bestehe kein Handlungsbedarf.
Als zweiter Schritt wird das Problem, beispielsweise ein Vorgehen gegen CumEx, als sehr kompliziert dargestellt. Dann sagen Lobbyisten zu Politikern: Wenn man sich da vorwagt, wird das Jahre dauern, außerdem ist alles rechtlich unklar. Was da mitschwingen soll ist: Lass da lieber die Finger von, das wird alles in die Hose gehen. Politiker wissen, dass die Behörden schwach aufgestellt sind.
Manch einen verlässt da der Mut, das Thema anzugehen. Es geht also nicht darum, dass Lobbyisten Geldscheine auf den Tisch legen. Griffige, aber falsche Narrative können zur Entscheidungsfindung beitragen.
Gibt es nicht gleichzeitig auch immer wieder enge Verflechtungen zwischen dem Finanzministerium und der Finanzindustrie? Hanno Berger etwa wusste Bescheid über viele geplante Gesetzesänderungen, die CumEx-Regelungen betroffen haben, und hat darauf Einfluss genommen.
Genau. Das habe ich jetzt ein bisschen abstrakt beschrieben, aber hinter diesen Narrativen stehen Menschen. Eine Methode der Lobby ist es, gezielt Seitenwechsler aus der Politik oder von der Spitze der Verwaltung anzuwerben, damit man über diese dann direkten Zugang zu Entscheidungsträgern erhält. Jemand wie Hanno Berger, ein ehemaliger Spitzenbeamter in der Finanzverwaltung, hat Verbindungen und hat diese dann später, als er auf der anderen Seite war, auch bewusst genutzt. Er hat dann oft nicht selbst agiert, sondern über Lobbyverbände wie den Bankenverband irreführende Argumente bei politischen Entscheidungsträgern eingespielt und Narrative bedient, wie ich sie gerade beschrieben habe.
Die Verflechtungen zwischen Banken und Politik gibt es nicht nur im Finanzministerium. Als 2016 die Hamburger Warburg-Bank 47 Millionen Euro aus CumEx-Geschäften zurückzahlen sollte, meldete sich der Aufsichtsratsvorsitzende der Bank Christian Olearius bei einflussreichen Hamburger-SPD-Politikern. Die vermittelten mehrere Treffen zwischen Scholz und Olearius. Die Finanzverwaltung änderte ihre Meinung, die Bank durfte das Geld behalten. An den Inhalt der Gespräche kann sich Olaf Scholz angeblich nicht erinnern. Anne Brorhilker fand bei Durchsuchungen die Tagebücher des Bankers, in denen er die Treffen mit den SPD-Politikern akribisch festhielt.
Sie haben erst durch einen Strafprozess davon erfahren, dass das Bundeszentralamt für Steuern 566 CumEx-Verdächtige auf einer Liste hatte, die es Ihnen nicht weitergegeben hat – obwohl Ihnen das viel Arbeit erspart hätte. Auch ansonsten haperte es immer wieder bei der Zusammenarbeit. Woran lag das?
Dass sich Behörden nicht austauschen, obwohl sie eigentlich in einem Themenbereich arbeiten, hat auch der Bundesrechnungshof mehrfach moniert und das ist wirklich nicht auf CumEx begrenzt. Bei Behörden gibt es eine Kultur, dass man nichts nach außen trägt. Das wird einem von Anfang an vermittelt. Das Silodenken erschwert die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Es gibt so viele Staatsanwälte und Staatsanwältinnen in Deutschland, die dieses fachlich schwere Feld bearbeiten. Gleichzeitig gibt es eine hohe Personalfluktuation, es bleibt also kaum Zeit, Fachexpertise aufzubauen. Aber ein Forum für Beamte aus dem operativen Bereich, um sich auszutauschen, zu vernetzen oder voneinander zu lernen, das gibt es kaum.
Was würde gegen dieses Inseldenken helfen?
Wenn es eine externe Stelle gäbe, die misst, wie gut Behörden ihre Aufgaben wahrnehmen und wie viel Output sie haben, würde das die Qualität der Arbeit in den Mittelpunkt stellen. Und da würde man sicherlich auf den naheliegenden Gedanken kommen, das Wissen zu vernetzen.
Aber ist es nicht die Aufgabe des Bundesrechnungshofs, die Arbeit der Behörden zu prüfen?
Doch, aber er hat leider keinerlei Durchgriffsrechte. Er ist zwar unabhängig und berichtet an den Bundestag. Aber wenn der Rechnungshof Mängel feststellt, hat das keine direkten Konsequenzen.
Sie haben im Januar 2025 gesagt, dass Sie davon überzeugt sind, dass CumEx-Geschäfte weiter laufen. Warum sind Sie sich denn da so sicher?
Zum einen hatten wir dazu Erkenntnisse bei der Staatsanwaltschaft Köln, über die ich aber im Einzelnen nicht sprechen darf, weil das unter das Dienstgeheimnis fällt.
Ich darf aber über das sprechen, was öffentlich bekannt ist. Es gab 2016 noch einen CumEx-Fall, der auch medial bekannt geworden ist. Das war vier Jahre, nachdem eine Gesetzesänderung in Kraft getreten war, die diese Geschäfte eigentlich technisch unmöglich machen wollte.
Außerdem gibt es Untersuchungen zweier US-Professoren, die zeigen, dass der Aktienhandel rund um den Dividenden-Stichtag auch nach 2011 noch signifikant erhöht ist. Das ist eigentlich auch gar nicht verwunderlich, denn Gesetze allein können Kriminalität nie stoppen. Kriminelle setzen sich ja gerade über Gesetze hinweg. Außerdem hat sich an den Rahmenbedingungen – hoher Tatanreiz wegen hoher Gewinne und geringes Entdeckungsrisiko wegen schwacher Behörden – leider bisher wenig geändert.
Bei den wesensverwandten CumCum-Geschäften sollen weitere 30 Milliarden Steuern hinterzogen worden sein – auch hier im industriellen Maßstab, über viele Jahre hinweg. Bei CumCum-Geschäften wurde nicht eine Steuer mehrfach erstattet. Stattdessen haben unterschiedliche Akteure zusammengearbeitet, um sich eine Steuer erstatten zu lassen, obwohl der eigentliche Eigentümer der Aktie darauf kein Anrecht hatte.
CumCum-Geschäfte gelten als großer Bruder von CumEx. Mein Eindruck ist, dass CumCum trotzdem weniger bekannt ist und es auch weniger Ermittlungsverfahren gibt. Warum liegt kein so großer Schwerpunkt darauf?
Ich glaube, dass auch hier die Narrative der Lobby verfangen haben. Insbesondere ist das immer so dargestellt worden, dass die Geschäfte „branchenüblich“ seien. Das erinnert mich sehr an die Anfangszeit von CumEx, das wurde nämlich anfänglich auch in diesem Zusammenhang gesagt. Dabei ist hier die Rechtslage noch klarer, schon 2015 hat das oberste Finanzgericht für eine typische CumCum-Variante entschieden, dass diese rechtswidrig ist. Weitere Urteile für weitere typische Varianten folgten.
Ich glaube außerdem, dass viele CumCum-Fälle bisher gar nicht entdeckt worden sind. CumCum war noch viel weiter verbreitet als CumEx, insbesondere haben viele kleinere Institute mitgemacht – unter anderem Sparkassen, obwohl sie eigentlich gemeinwohlorientiert handeln sollen. Aber auch Sparda-Banken, Unternehmen und Fonds. Das ist ein Problem für die Finanzverwaltungen: Während große Investmentbanken von spezialisierten Prüfern geprüft werden, werden kleinere Institute oft von nicht speziell geschulten Kräften geprüft.
Bei CumCum-Geschäften drohen zu Januar 2026 massenhaft Beweise vernichtet zu werden. Sie haben Finanzminister Lars Klingbeil mehrfach aufgefordert, das zu verhindern. Haben Sie eine Antwort bekommen?
Das Kabinett hat auf seine Initiative hin beschlossen, die Aufbewahrungsfristen für typische CumCum-Akteure wieder zu verlängern. Ich freue mich darüber, dass unsere Forderung Gehör gefunden hat und hoffe nun, dass die CumCum-Bekämpfung endlich an Fahrt aufnimmt.
Eine andere Sache, die Sie ja auch schon seit längerem fordern, ist, eine zentrale Behörde zur Bekämpfung von schwerer Wirtschaftskriminalität. Warum finden sie, dass es die braucht?
Für international organisierte Geldwäsche haben wir jetzt schon eine Bundesbehörde, nämlich das Bundeskriminalamt. Das ist auch sinnvoll, weil die Akteure oft im Ausland sitzen und Ermittlungen meist nur über den internationalen Rechtshilfeweg stattfinden können. Das Gleiche gilt auch für international organisierte Steuerhinterziehung wie CumEx, CumCum oder Umsatzsteuerkarusselle. Das ist keine lokale Kriminalität, die von lokal zuständigen Behörden bearbeitet werden sollte, sondern hier sind ganz überwiegend Auslandsermittlungen erforderlich.
Wir fordern eine zentrale Stelle auf Bundesebene sowohl für international organisierte Geldwäsche als auch für international organisierte Steuerhinterziehung. Beides hängt ganz eng zusammen, es sind dieselben Ermittlungsschritte erforderlich. Gerade bei aufwändigen Auslandsermittlungen ergibt es gar keinen Sinn, diese Ermittlungen auseinanderzureißen.
Dazu kommt: Solche Fälle brauchen viel Fachexpertise. Deshalb wäre eine kleine, schlagkräftige Truppe auf Bundesebene sinnvoll. Eine solche zentrale Stelle könnte wahrscheinlich viele Milliarden wieder reinholen. Mit dem derzeitigen System zersplitterter Zuständigkeiten ist das dagegen kaum denkbar.
Von der aktuellen Regierung gibt es dazu aber keine Äußerungen.
Ja, es gibt zwar ein paar Hinweise dazu im Koalitionsvertrag, was diese bedeuten, ist aber unklar. Wenn das Bekenntnis zur entschlossenen Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Wirtschaftskriminalität keine leere Rhetorik bleiben soll, braucht es auch organisatorische Veränderungen in der Verwaltung und dazu gehört die Schaffung einer schlagkräftigen zentralen Stelle für international organisierte Fälle von Geldwäsche und Steuerhinterziehung.
Redaktion: Rico Grimm, Schlussredaktion: Theresa Bäuerlein, Fotoredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert und Iris Hochberger