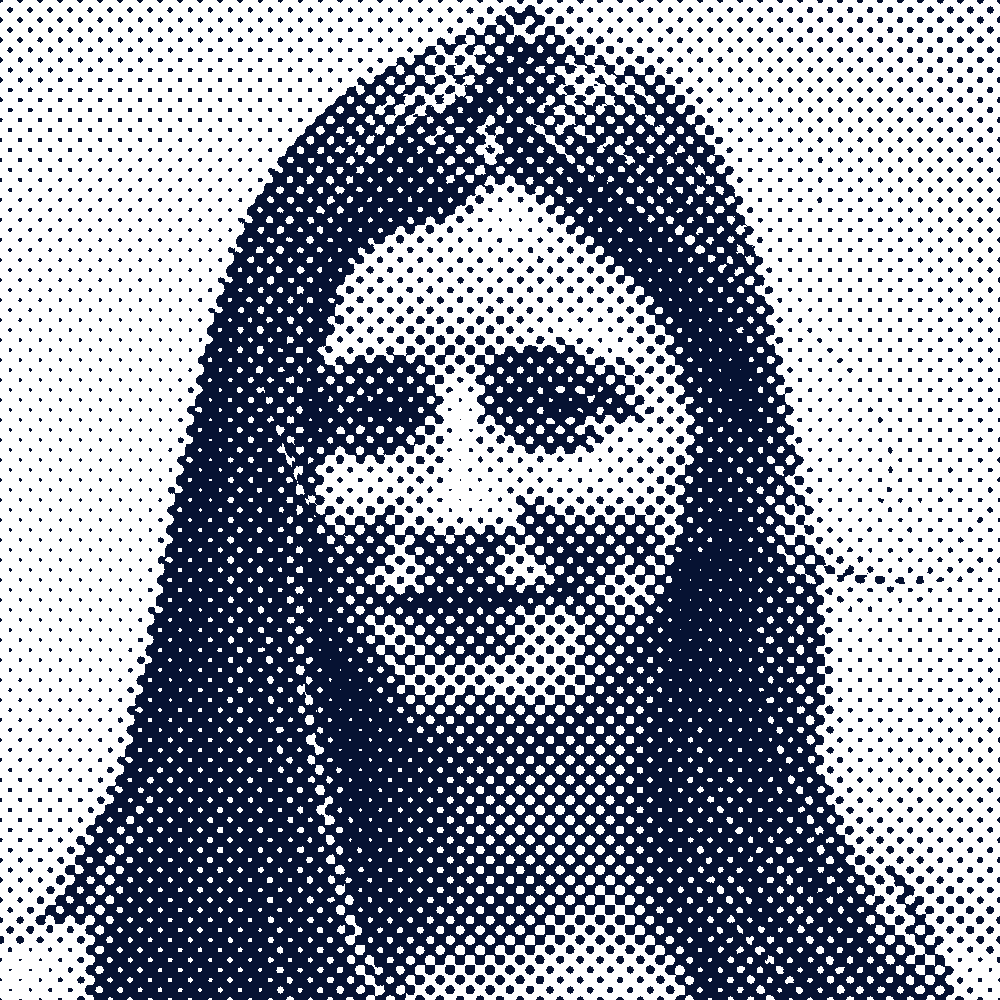Vor ein paar Tagen argumentierte der deutsche Bundeskanzler wie ein Junge aus meiner Klasse vor 15 Jahren. Er erzählte damals bei einem Vortrag, dass er es übertrieben findet, wie viel Wohnfläche Hartz-IV-Empfänger:innen bezahlt bekommen. Die Wohnfläche sollte im ersten Jahr des Hartz-IV-Bezugs etwas erhöht werden. In meiner Erinnerung war meine ganze Klasse seiner Meinung. Außer mir.
Ich war mitgemeint. Meine Mutter bekam Hartz IV und damit auch ich. Damals habe ich geschwiegen, um mich nicht angreifbar zu machen. Heute nicht.
Im Sommerinterview fragte ein Journalist Friedrich Merz, was er gegen die hohen Wohnkosten von Bürgergeld-Empfänger:innen tun wollte. Seine Antwort: Die Mieten für Bürgergeld-Empfänger:innen konsequent deckeln. Das bedeutet nicht etwa, dass er die Mietpreise senken will, sondern den Betrag, den das Jobcenter übernimmt. „Sie haben in den Großstädten heute teilweise bis zu 20 Euro pro Quadratmeter, die sie vom Sozialamt oder von der Bundesagentur bekommen für Miete“, sagte Merz. „Das kann sich eine normale Arbeitnehmerfamilie nicht leisten.“
Und weil es sich die Arbeiter:innen nicht leisten können, sollen Bürgergeld-Empfänger:innen auf der Straße landen. Denn das wäre die logische Konsequenz, schließlich gibt es in vielen deutschen Städten schlicht keinen günstigen verfügbaren Wohnraum. Mich macht das so wütend, dass mir beim Schreiben Tränen in die Augen schießen.
Es ist einfach für Merz, den Arbeitslosen die Schuld an der Wohnungskrise zuzuschieben und dabei die Verantwortung seiner eigenen Partei auszusparen. Immerhin hat die CDU 17 der vergangenen 20 Jahre mitregiert.
Auch der Koalitionspartner SPD hält nicht viel von Merz’ Idee, Fraktionsvize Dagmar Schmidt hat ihr schon eine Absage erteilt. Aber selbst wenn dieser Vorschlag nicht umgesetzt wird, steht er doch symbolisch dafür, wie die Union mit Bürgergeldempfänger:innen umgeht. Sie nutzt Vorurteile, um Stimmung gegen Schwache zu machen.
Die Union erklärt seit Langem, dass sie die leeren Haushaltskassen füllen will, indem sie am Bürgergeld kürzt. CSU-Chef Markus Söder sieht darin eine Frage der Gerechtigkeit. Konsequenterweise hat die CDU angekündigt, dass sie 2027 beim Bürgergeld 3,5 Milliarden Euro sparen will. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles (SPD), hält das für unrealistisch. Dazu kommt: An anderer Stelle gäbe es mehr Geld einzutreiben. Was ist mit den 30 Milliarden Euro Steuern, die bei CumCum-Geschäften nach Schätzungen hinterzogen wurden? Ist es nicht auch eine Frage der Gerechtigkeit, wenn die Reichsten einer Gesellschaft Steuern im industriellen Maßstab hinterziehen – und damit größtenteils straffrei durchkommen?
Aber wie umsetzbar und sinnvoll die Kürzungen beim Bürgergeld sind, scheint ohnehin zweitrangig. Wir leben in einer Umbruchszeit, die Welt fühlt sich unsicher und chaotisch an. Jahrelang schwächelte die deutsche Wirtschaft, auf die USA ist unter Donald Trump nicht mehr Verlass und ein Krieg in Europa fühlt sich wieder realistischer an. Was braucht man in solchen Momenten? Sündenböcke. Und wer eignet sich dafür am einfachsten? Aus CDU-Perspektive: Migrant:innen und Bürgergeld-Empfänger:innen.
Dabei kann fast jeder mal auf Bürgergeld angewiesen sein. Etwa weil man nach dem Studium nicht direkt einen Job findet, obwohl man Dutzende Bewerbungen schreibt. Oder weil man unter einer chronischen Erkrankung leidet, sei es nun Long Covid oder Depressionen und es noch nicht mal schafft, das Bett zu verlassen, geschweige denn, acht Stunden am Tag zu arbeiten. Weil man jahrelang Kinder erzogen hat, sich vom Partner getrennt hat und nun einfach keinen Job mehr findet. Friedrich Merz und sein Umfeld mögen genug finanziellen Puffer haben, um solche Zeiten ohne staatliche Unterstützung zu überstehen. Auf viele Deutsche trifft das nicht zu.
Das Bürgergeld sollte das Leben für Arbeitslose mal leichter machen
Kurz sah es unter der Ampel aus, als würde das Leben für Bürgergeld-Empfänger:innen etwas leichter werden. Interessiert verfolgte ich mit, wie die SPD im Januar 2023 das Bürgergeld einführte, um endlich ihr Hartz-IV-Trauma loszuwerden und weniger Sanktionen, mehr Geld und mehr Augenhöhe zwischen Jobcenter-Mitarbeiter:innen und Arbeitslosen zu schaffen. Doch der Backlash kam, als das Bürgergeld aufgrund der Inflation im Januar 2024 um zwölf Prozent angehoben wurde. Seitdem diskutieren Spitzenpolitiker:innen in Talkshows, ob sich Arbeit überhaupt noch lohne. Und das, obwohl Studien zu einem klaren Ergebnis kommen: Ja, Arbeit lohnt sich weiter.
Die CDU nutzt die aufgeheizte Stimmung immer wieder für populistische Vorschläge. So entschied der CDU-Bundesvorstand im März, dass sie sogenannten Totalverweigerern das Bürgergeld komplett streichen würde. Dabei ging es um 16.000 Menschen, 0,4 Prozent der Bürgergeld-Empfänger:innen. Diese von der Regierungspartei beschlossene Maßnahme ist verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hatte Sanktionen über 60 Prozent schon 2019 für nicht mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt.
Tatsächlich ist es so: Nur eine:r von zehn Bürgergeld-Empfänger:innen sieht sich noch als Teil der Gesellschaft. Nur neun Prozent der Bürgergeld-Empfänger:innen können sich gesund ernähren. Über die Hälfte der Eltern verzichten auf Essen, damit ihre Kinder genug bekommen. Zu dem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Vereins „Sanktionsfrei“. Der Bürgergeld-Empfänger und ehemalige Jobcoach Thomas Wasilewski berichtete bei einer Pressekonferenz, dass Menschen stundenlang bei der Tafel anstehen, weil sie Hunger haben. Über diese Bürgergeld-Empfänger:innen spricht Merz nie. Die hungern, weil am Ende des Monats kein Geld mehr da ist, die alleine drei Kinder großziehen müssen, die sich schämen und alles dafür tun, aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen. Und trotzdem wenig Hoffnung haben, weil körperliche oder psychische Erkrankungen es ihnen schwer machen, einen Job zu finden.
Er spricht auch nicht über das Drittel der Bürgergeld-Empfänger:innen, die minderjährig sind. 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche, die unverschuldet in Armut leben, so wie ich vor 15 Jahren.
Als ich in der Grundschule war, schwächelte die deutsche Wirtschaft. Ähnlich wie jetzt. Als ich aufs Gymnasium wechselte, wurde gerade Hartz IV eingeführt, damit sich weniger Menschen in der „sozialen Hängematte“ ausruhen sollten. Begleitet wurde das von Bild-Kampagnen von frechen Arbeitslosen, die fünf Handys besaßen und auf Mallorca lebten. Am Vorabend flimmerte das sogenannte Assi-Fernsehen auf den Fernsehern in deutschen Wohnzimmern. Dort konnte man Hartz-IV-Empfänger:innen bei ihrem vermeintlich lächerlichen Leben zusehen und sich im Vergleich selbst ein bisschen weniger lächerlich fühlen.
Arm sein bedeutet, sich zu schämen
Meine Mutter, alleinerziehend mit drei Kindern, bekam zu dieser Zeit Hartz IV. Ich ging auf ein gutbürgerliches Gymnasium, die Eltern vieler meiner Mitschüler:innen waren Ärzt:innen oder Anwält:innen, sie wohnten in großen Häusern und beschäftigten Reinigungskräfte. Die Mütter arbeiteten halbtags, die Väter machten Ausflüge mit Oldtimern.
Bis heute erinnere ich mich an die Scham, die damit verbunden war, ärmer zu sein als sie. Ich lernte durch kritische Blicke schnell, dass es besser war, wenn niemand wusste, dass mein Vater nicht mit am Abendbrottisch saß und dass meine Mutter keinen Job hatte. Nur so konnte ich verhindern, dass meine Mitschüler:innen mich mit den Menschen in Verbindung brachten, die sie im Fernsehen sahen. Wir zogen immer wieder um, ich wechselte häufig die Schule und versuchte, meinen Mitschüler:innen möglichst wenig über mein Leben zu verraten. Dann zog ich weg, studierte und schaffte den sozialen Aufstieg.
Aber in Zeiten wie diesen denke ich an die Kinder und Jugendlichen, die heute Angst haben, wenn sie in den Nachrichten lesen, dass ihre Eltern vielleicht bald nicht mehr genügend Geld für die Miete vom Jobcenter bekommen. Die fürchten, in eine andere Stadt ziehen zu müssen oder auf der Straße zu landen. Die sich schämen, weil ihre Eltern sich vermeintlich nicht genug anstrengen. Ich möchte ihnen sagen, dass sie sich nicht schämen müssen.
Redaktion: Lea Schönborn, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Gabriel Schäfer, Audioversion: Iris Hochberger