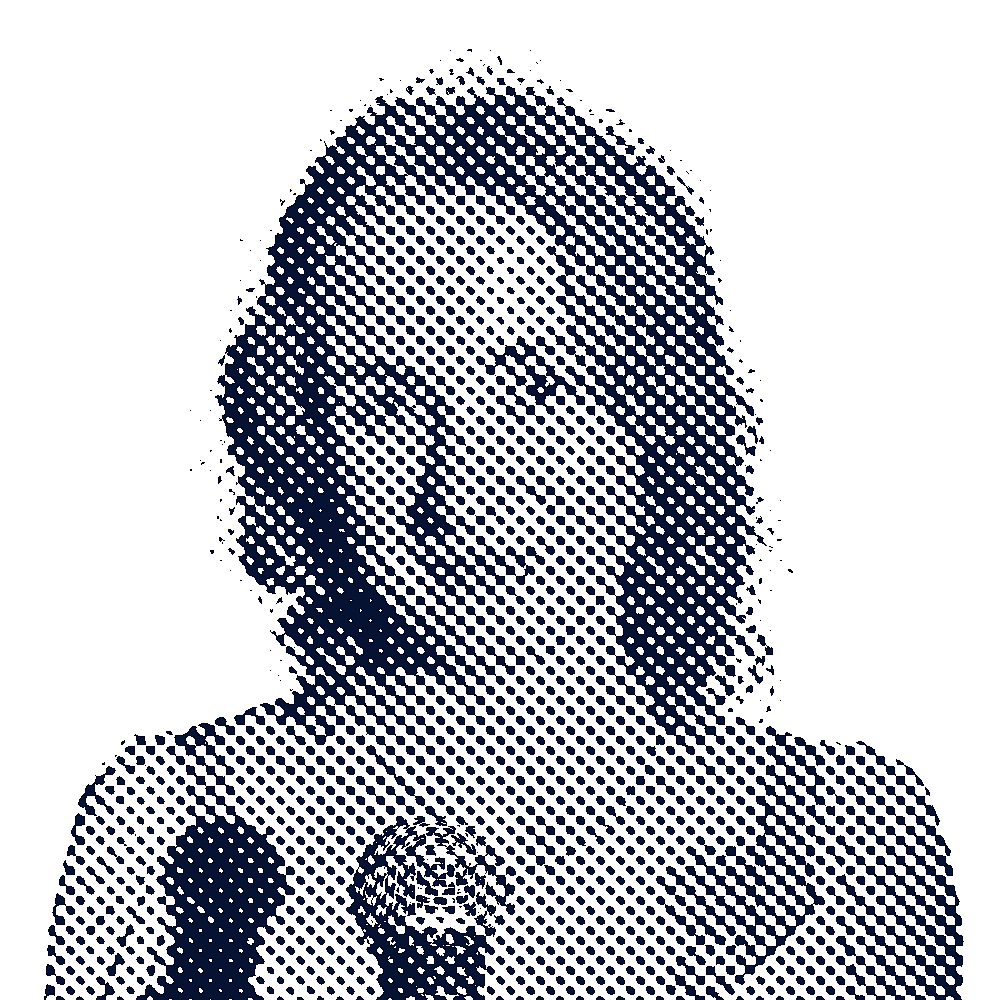Meine Freunde hatten mich gewarnt. „Musa, die können dich mitnehmen.“ „Musa, pack lieber einen Rucksack mit Anziehsachen und Bettbezügen.“ So reagierten sie, als ich erzählte, dass ich Asyl beantragen wollte. Ich habe nicht auf meine Freunde gehört. Was könnten die Behörden mir schon anhaben, fragte ich mich. Ich lebte seit vier Jahren mit meiner Aufenthaltserlaubnis in Köln, hatte eine WG und einen Job, fühlte mich sicher.
So stand ich im Februar 2018 in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Bonn und fragte nach Asyl. Die Security schickte mich nach Bochum. Dort wollte ich einem Sozialarbeiter erzählen, wie ich 2014 nach Deutschland kam, als in der Türkei die Gezi-Proteste blutig niedergeschlagen wurden.
Ich wollte erzählen, wie ich damals Journalismus studierte und meine Dozenten an der Ege University in Izmir mir und meinen Kommilitonen rieten auszuwandern. Sie empfahlen Deutschland. Dort könnten wir weiterhin unabhängig berichten, müssten als angehende Journalistinnen keine Verfolgung fürchten. Als Kurde hatte ich Angst. Ich war Teil einer Minderheit, unsere Stimmen wurden in der Öffentlichkeit nicht gehört.
Aber der Sozialarbeiter hörte mir nicht zu und auch sonst niemand. Sie nahmen mir lediglich meinen türkischen Pass ab und sagten, ich solle warten. Worauf, wollte ich wissen. Keine Antwort. Ich habe stundenlang dort im Flur gesessen. Um drei Uhr nachts hieß es, wir sollten in einen Bus einsteigen. Niemand sagte mir, wohin es ging. Wie ein Schwerverbrecher habe ich mich gefühlt. Zwei Stunden später sah ich ein Containerdorf, wir waren bei einer Geflüchtetenunterkunft. Solche Orte kannte ich bislang nur aus Erzählungen. Ich sollte dort die nächsten drei Monate festsitzen.
Ich bin kein klassischer Flüchtling. Ich bin nicht in einem Boot nach Deutschland gekommen, sondern in einem Flugzeug. Im März 2014 kam ich her. Ich war 25 Jahre alt und wollte im Master Journalismus studieren. Was ich stattdessen erlebte, waren verschlossene Türen und schier unüberwindbare Hürden. Die deutsche Bürokratie hat meine Träume platzen lassen.
Ich wollte studieren, aber mir fehlte das Geld⬆ nach oben
Schon an dem Versuch, an einer Uni angenommen zu werden, scheiterte ich. Ich hatte vier Zulassungen, nur ein Zertifikat fehlte. Für deutschsprachige Studiengänge musste mein Deutsch auf C1-Niveau sein, ich musste also fast so gut wie ein Muttersprachler sprechen. Ich startete bei null und pro Modul des Sprachkurses musste ich 500 Euro zahlen. Meine Familie hatte mir meinen Bachelor in der Türkei finanziert. Ich habe zehn Geschwister, für mehr reichte das Geld meiner Eltern nicht.
Als ausländischer Student musste ich 8.040 Euro auf einem Sperrkonto haben, als Finanzierungsnachweis. Um zu zeigen, dass ich mir das Leben und das Studieren in Deutschland leisten kann. Die ersten Monate lebte ich von der Unterstützung meines großen Bruders, dann ging mir das Geld aus und ich musste arbeiten gehen. Ich habe Geschirr gespült für fünf Euro die Stunde, dann auf türkischen Hochzeiten Fotos geschossen. Ich arbeitete schwarz und fühlte mich schlecht deswegen.
2017 habe ich bei ArtiMedia angefangen. Von Köln aus berichteten wir unabhängig über die politische Lage in der Türkei. „Arti“ heißt auf Deutsch „plus“. Wir wollten mehr Informationen liefern, als es in der Türkei gab. Für die Website Arti Gerçek schrieb ich Nachrichten, für den Fernsehsender Arti TV stand ich einige Jahre lang vor der Kamera. Meine Familie war so stolz auf mich. Und auch ich dachte, ich hätte es geschafft. Aber dann kamen die ersten Konflikte.
Warum ich in Deutschland geblieben bin⬆ nach oben
Ich wollte meinen Sprachkurs weiterführen, weil mein Ziel ja immer noch war, Journalismus zu studieren. Mehrmals bin ich durch die Hörprüfung gefallen, weil ich mir so viel Druck gemacht habe. Ich musste weniger arbeiten. Meine Chefredakteure sagten ganz einfach: „Das geht nicht.“ Und: „Wir brauchen dich hier.“ Als Exil-Journalist in Deutschland war ich sehr allein und isoliert. Ich hatte weder eine Krankenversicherung noch eine Arbeitserlaubnis.
Meine Familie habe ich 2016 das letzte Mal gesehen. Damals hatte ich noch das Visum und meinen türkischen Pass. In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli versuchten Teile des türkischen Militärs, die Regierung zu stürzen. Sie scheiterten. Wenige Tage später rief das Kabinett einen dreimonatigen Notstand (Olağanüstü hal) aus. Ich war kurz danach in Istanbul.
Auf den Straßen der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, herrschte Stille. Viele Journalisten wurden entlassen oder sogar verhaftet. Die Telekommunikationsbehörde RTÜK entzog vor allem kleinen und lokalen Sendern die Sendelizenz. Die Versammlungsfreiheit wurde eingeschränkt. Da wusste ich, ich muss wohl erstmal in Deutschland bleiben.
Als meine Aufenthaltserlaubnis zur Studienvorbereitung auslief, lag mein Deutsch-Sprachniveau zwischen B1 und B2 – und damit zu niedrig. Ich war gescheitert. Dabei hatte ich alles gegeben, um in Deutschland zu studieren.

In Köln fand Musa Arbeit als Journalist. Er fing bei ArtiTV an. Offiziell angestellt war er nie. | © Screenshot ArtiMedia
Ich wurde behandelt, als wäre ich gerade erst angekommen, dabei hatte ich hier ein Leben⬆ nach oben
Nun blieb mir nur eine Option, um nicht abgeschoben zu werden: der Asylantrag. So landete ich 2018 in einer Asylunterkunft.
Damals in Dortmund, in der Asylunterkunft, sagte ich mir, Deutschland ist ein Rechtsstaat, die können dich für maximal 24 Stunden hier behalten. Aber ich irrte mich. Drei Monate saß ich in der Geflüchtetenunterkunft fest, in einem Zimmer mit fünf Asylbewerbern. Am vierten Tag brachten mir meine Freunde ein paar Unterhosen und T-Shirts, davor hatte ich nichts, außer meiner Kleidung am Leib. Ich durfte mich nur 30 Kilometer von dem Heim entfernen, meine Miete für meine Wohnung in Köln musste ich weiterhin zahlen.
Danach wurde ich in einen Wohnkomplex nach Bad Homburg gebracht, noch weiter weg von meiner Wahlheimat Köln. Sechs Monate hätte ich in einem Zimmer mit vier Betten bleiben sollen, bis zu meiner Anhörung. Das konnte ich nicht. Ich hatte mir ein Leben in Köln aufgebaut, ich hatte Freunde, eine Beziehung und meinen Job. Meine Redaktion brauchte mich. Ich war schon viel zu lange ausgefallen.
Also sprach ich mit meiner Sozialarbeiterin – eine der ersten Deutschen, die mir wirklich zuhörte. Ich durfte nach Köln zurück, musste aber einmal die Woche mein Taschengeld von 30 Euro abholen kommen, sonst wäre mein Asylverfahren sofort beendet worden. Das Geld ging für die Fahrt drauf. Für die 100-Kilometer-Strecke Köln-Bad Homburg brauchte ich vier Stunden mit verschiedenen Regionalzügen. Und dann musste ich noch zurückkommen. Ich verlor also jede Woche einen ganzen Arbeitstag.
Der ganze Prozess rund um den Asylantrag war für mich schwer zu verstehen. Ich holte mir Rat bei verschiedenen Anwälten ein. Ich brauchte Hilfe bei meinem Arbeitsnachweis. Den wollte mir meine Geschäftsführung nämlich nicht ausstellen. Sie hatten Angst, dass die Behörden herausfinden könnten, dass sie mich ohne Arbeitserlaubnis angestellt haben.
Nach vielen Diskussionen gaben sie mir ein Empfehlungsschreiben und mein Asylantrag konnte schneller bearbeitet werden. Am Ende wurde ich als Flüchtling anerkannt und durfte mit meiner Aufenthaltserlaubnis hier bleiben. Nach fünf Jahren erhielt ich eine Niederlassungserlaubnis – endlich hatte ich die Sprachprüfung bestanden.
Bevor ich nach Deutschland kam, hatte ich keine psychischen Probleme. Seit 2017 nehme ich Antidepressiva. Erst wegen der Angst, abgeschoben zu werden. Später wegen der bürokratischen Hürden, die immer größer wurden.
Die Bürokratie hinderte mich, meinen Vater vor seinem Tod zu sehen⬆ nach oben
2022 habe ich meinen Vater an den Krebs verloren. Als feststand, dass er nicht mehr lange leben würde, beantragte ich bei der Stadt Köln ein Visum für meine Eltern. Ich wollte meinen Vater ein letztes Mal sehen und mich verabschieden. Ich konnte meine Familie nicht einfach besuchen fahren, denn wenn ich mit meinem blauen Pass in die Türkei gereist wäre, hätte der deutsche Staat meine Asylberechtigung widerrufen können und ich hätte mein Aufenthaltsrecht für Deutschland verloren. Und so wartete ich.
Es kann bis zu 16 Wochen dauern, haben die Beamten von der Ausländerbehörde gesagt. Ich habe geantwortet, dass es schneller gehen muss. Nichts zu machen, sagen sie. In Woche zwölf starb mein Vater. Bis heute konnte ich mich nicht richtig verabschieden. Meine Mutter legt regelmäßig Blumen in meinem Namen an sein Grab in Istanbul.
Sie fragt, wann ich nach Hause komme, jetzt wo ich in Deutschland doch gar nicht mehr als Journalist arbeite. 2020 habe ich bei ArtiMedia gekündigt, weil man dort nicht an Corona glaubte. Ich meldete mich arbeitslos. Erst schrieb ich Bewerbungen an Medienunternehmen wie den MDR, fragte, ob ich da eine Hospitanz oder ein Praktikum machen könnte. Keine Antwort. Meine Sachbearbeiterin sagte mir, dass es selbst deutsche Journalisten schwer hätten, einen Job zu finden.
Sie ermutigte mich nicht, es weiter als Journalist zu versuchen. Sie sah in mir den Flüchtling und was können wir am besten? Andere Geflüchtete verstehen. Ich orientierte mich um, weil Deutschland gerade Sozialarbeiter brauchte und fing an, in Erstaufnahmeeinrichtungen zu arbeiten.
Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) habe ich so einiges gesehen. Menschen, die von ihrer Bettwäsche Stücke abschneiden, um Seile zu knüpfen, um sich damit bei drohender Abschiebung umzubringen. Oder dass Privatpersonen Geld mit der Unterbringung von Geflüchteten machen. Ich habe es zwar schnell aus dem Asylheim rausgeschafft, aber in Deutschland bin ich nie wirklich angekommen. Ich habe zum Beispiel auch keine deutschen Freunde. Immer wieder frage ich mich bei der Arbeit: Werden die anderen Geflüchteten hier Fuß fassen können?
Immer öfter frage ich mich: Soll ich zurückgehen?⬆ nach oben
Vor zwei Jahren habe ich eine deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Seit zwei Jahren warte ich auf eine Antwort.
Als Journalist wollte ich darüber sprechen, was in der Welt passiert. Als Kurde meine Stimme erheben. Inzwischen frage ich mich, ob es ein Fehler war, nach Deutschland zu kommen, ob mir als Journalist in der Türkei die Türen nicht offener stehen würden.
Auch wenn meine Dozenten damals was anderes gesagt haben, lese ich heute türkische Nachrichten und denke: Man kann dort kritisch berichten. Und auch die türkisch-kurdischen Dynamiken sind heute anders als 2014.
Immer mehr Migranten und auch jene zweiter oder dritter Generation überlegen, zurück in ihr Heimatland zu gehen, auch wegen der AfD. Freunde von mir schicken ihre Kinder auf Privatschulen, weil sie Angst vor Diskriminierung haben. Sollte ich einmal Kinder haben, bin ich mir nicht sicher, ob ich will, dass sie in Deutschland groß werden. Ich kann den Menschen in der U-Bahn ja nicht mal mehr in die Augen schauen, aus Angst, ihnen Angst zu machen.
Redaktion: Rebecca Kelber, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert