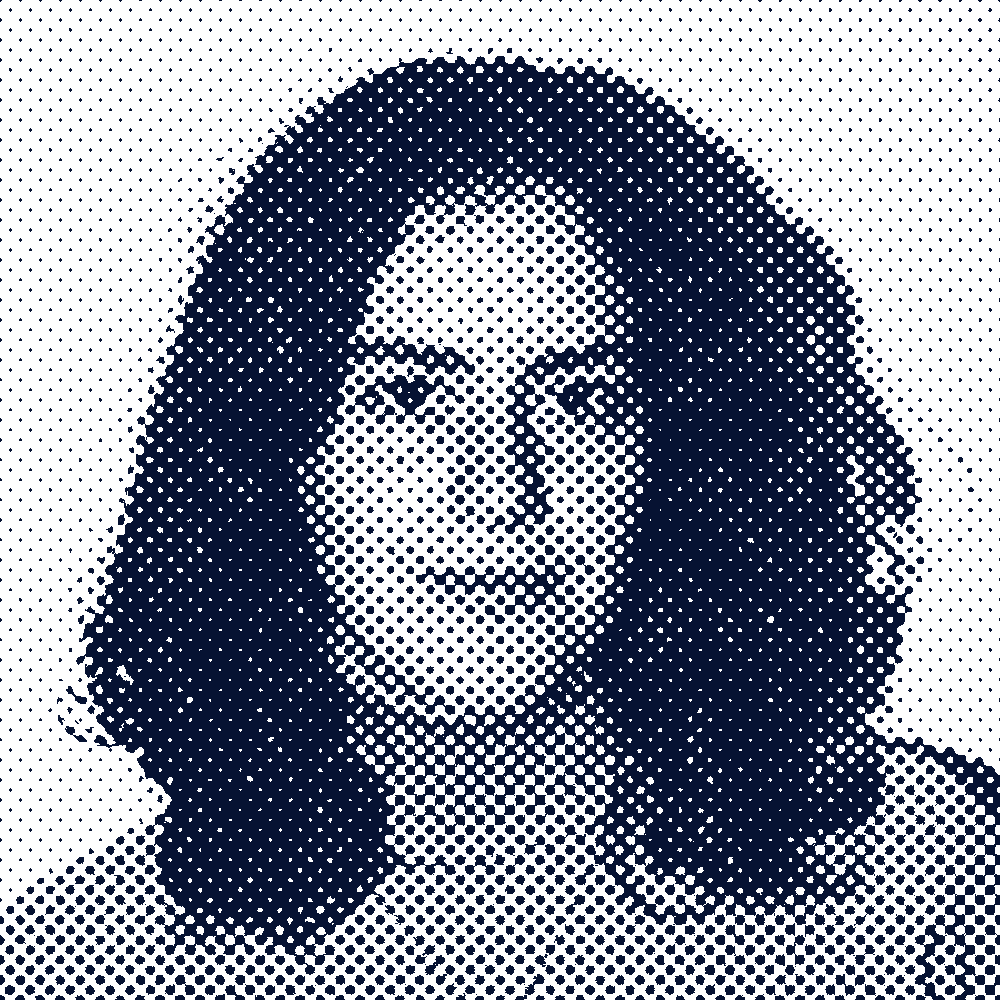Wenn Mushon Zer-Aviv durch die Straßen von Tel Aviv geht, weiß er genau, welche Straße das in Gaza Stadt wäre, würde man die Stadtpläne übereinander legen. Der Israeli, durch dessen dunkles Haar sich silberne Strähnen ziehen, weiß genau, dass der Ort, an dem sich in Gaza ein Gefängnis befindet, dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv entspricht. Dass das Restaurant in Tel Aviv, an dem wir an diesem Septembertag sitzen, nicht weit von einem Künstlerviertel in Gaza entfernt ist. Dass es sogar an dem entsprechenden Ort in Tel Aviv regelmäßig einen Markt mit Kunsthandwerk gibt.
Es war im Jahr 2007, Mushon machte seinen Master in interaktiven Medien an der New York University. Da startete er ein Projekt mit Laila el-Haddad, einer Journalistin und Bloggerin aus Gaza. Sie druckten eine Karte: auf der einen Seite Tel Aviv, auf der anderen Seite Gaza Stadt. Wenn man die Karte gegen das Licht hielt, zogen sich die Straßen der einen Stadt durch die Straßen der anderen Stadt. An mehreren auf der Karte vermerkten Orten in Tel Aviv klebten Sticker mit einer Telefonnummer.Wer dort anrief, hörte eine Sprachaufnahme von Laila, die eine Geschichte über ihren Alltag in Gaza erzählte.
Das war nur zwei Jahre, nachdem sich etwas Fundamentales in Gaza änderte: 2005 zog sich Israel aus dem schmalen Küstenstreifen zurück und räumte dabei auch israelische Siedlungen. Dieser Rückzug wurde „Abkoppelungsplan“ genannt und von verschiedenen Seiten kritisiert. Unter anderem deshalb, weil es keine Gegenleistungen gab, keinen Plan, der zum Beispiel gemäßigte Palästinenser:innen in Gaza stärkte. „Es war vor allem eine emotionale Abkopplung, die so stark war, dass beide Seiten es geschafft haben, sich gegenseitig zu entmenschlichen“, sagt Mushon. Der Stadtplan von Tel Aviv und Gaza Stadt bewirkte für ihn das Gegenteil. Heute, 18 Jahre nach diesem Projekt, sagt er: „Wir haben es geschafft, uns gegenseitig menschlich zu machen.“
Mushon hat sich dieses Gefühl bewahrt, dass da auf der anderen Seite, hinter der Sperranlage, ebenfalls Menschen wohnen, die die gleichen Bedürfnisse haben wie er, Wünsche und Träume, die hoffen und leiden.
Mushon Zer-Aviv ist 48 Jahre alt, Designer, Künstler und Aktivist. Er engagierte sich für das friedliche Zusammenleben von palästinensischen und jüdischen Menschen. Er hielt auch an seiner Einstellung fest, als die Hamas am 7. Oktober 2023 Israel überfiel. Mit seinen Ansichten gehörte er schon vor diesem Tag zu einer Minderheit in Israel. Doch seit der Hamas-Attacke und seit dem darauffolgenden Krieg in Gaza wird es immer einsamer um Mushon.
Daran ändert sich auch nichts, obwohl es gerade große Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas gibt. Mushon freue sich über den Waffenstillstand, schreibt er diesen Donnerstagmorgen, auch wenn er zu spät komme. Er könne aber nicht feiern, während sich dieselbe Gewalt im Westjordanland ausbreite. „Ich bin ein Israeli, der sich weigert zu glauben, dass unsere Freiheit auf dem Leid eines anderen Volkes aufgebaut werden kann“, schreibt er.
Zum ersten Mal seit langer Zeit gibt es jetzt eine Chance auf eine friedlichere Zukunft. Aber wie soll das gehen, nach so viel Gewalt, Tod und Zerstörung? Ein Waffenstillstand ist ein erster Schritt. Was kommt danach? Mushon setzt sich dafür ein, dass es ein besseres „danach“ geben kann. Auch wenn nicht jede:r versteht, wieso er sich nicht nur mit dem Leid auf „seiner“, sondern auch mit dem auf der „anderen Seite“ beschäftigt.
Mehr als drei Viertel der Befragten sagen: Israel sollte das Leid in Gaza nicht berücksichtigen⬆ nach oben
Mehr als drei Viertel der jüdischen Befragten findet, dass Israel bei militärischen Operationen das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung gar nicht oder nur in relativ geringem Ausmaß berücksichtigen sollte. Das ergab eine Umfrage des Israel Democracy Institutes von Anfang Juni 2025. Weniger als ein Drittel der jüdischen Befragten war der Meinung, dass Israel mehr humanitäre Hilfen nach Gaza zulassen sollte. Es machte einen großen Unterschied, ob sie sich links, rechts oder mittig einordneten. Drei Viertel der Linken waren für mehr humanitäre Hilfe, aber nur 17 Prozent der Rechten. Mushon ist einer dieser Linken.
Ein Treffen im Zentrum von Tel Aviv am Sonntagmittag. Es sind 32 Grad Celsius, Mushon bestellt Nudelsalat und Fisch zum Teilen. Er trägt ein schwarzes Shirt und eine graue Leinenhose. Selbst wenn er wütend wird, spricht er weiter leise und zurückhaltend. In Israel beginnt die Woche am Sonntag, nach dem Schabbat und damit eigentlich Mushons Arbeitswoche, aber er nimmt sich Zeit. Auch, weil er frustriert ist. Wegen der Menschen in seinem eigenen Land. Aber auch wegen Deutschland.
Anfang dieses Jahres saß er auf einer Bühne in Berlin, als er sagte: „Als Jude fühle ich mich nicht mehr sicher in Deutschland.“ Deutschland habe sich nach dem Zweiten Weltkrieg so weit wie möglich von den Nazis distanziert, um wieder in die Weltgemeinschaft aufgenommen zu werden, sagt er jetzt in Tel Aviv und will erklären, wie er das damals meinte. Es gebe noch einen anderen Teil dieser Geschichte: dass Jüdinnen und Juden zu „ewigen Opfern der Geschichte“ erkoren worden seien. Und dass Deutschland dabei blind geworden sei für das, was Israel und folglich damit viele Jüdinnen und Juden tun. „Das sind Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnische Säuberung und ja, Genozid“, sagt Mushon. Er sieht mich dabei aufmerksam an, wie um nachzuprüfen, wie ich darauf reagiere.
Hinter der Geschichte
Im Dezember 2023 haben wir einen Text von Mushon Zer-Aviv übersetzt und veröffentlicht. Er hatte die Überschrift „Eure Empathie bringt uns um“ und er handelt davon, dass es nur schadet, wenn man im israelisch-palästinensischen Konflikt einseitig Partei ergreift. Knapp zwei Jahre später wollte ich wissen, wie Zer-Aviv heute auf den Krieg blickt. Er sagte mir: „Leider war der Text sehr vorausschauend.“ Die einseitige Parteinahme habe tatsächlich zu einer Vertiefung der Gewalt geführt.
Mushon war häufiger in Berlin, als er zählen kann und weiß, dass es in Deutschland eine heftige Debatte um den Begriff Genozid gibt. Er weiß auch, dass Leute über die Aussage „From the river to the sea“, also „vom Fluss bis zum Meer“ diskutieren. Im Februar wollte er einen Workshop in Berlin geben, mit dem Titel „Co-liberation and political imagination from the river to the sea“. Die Veranstalter waren gegen den Titel, weil der Slogan „From the river to the sea“ strafbar sei. Mushon redet jetzt schnell. „Das macht mich wütend“, sagt er. Er sieht es so: Deutsche können gefahrenlos in Frankreich leben und andersrum, obwohl sich Deutsche und Franzosen geschichtlich betrachtet länger bekriegt hätten als Israelis und Palästinenser. Das sei etwas Schönes, und dann verbiete Deutschland Slogans wie „From the river to the sea“? Bei solchen Verboten geht es seiner Ansicht nach nicht mehr darum, Israel zu schützen. „Ich fühle mich unsicher, weil ich sehe, wie Deutsche sich abwenden, wenn sie Ungerechtigkeit sehen – weil ihnen gesagt wurde, sie sollen wegschauen.“
Ein Foto von getöteten Kindern in Gaza? „Ekelhaft“⬆ nach oben
Der 7. Oktober 2023 machte es noch schwieriger, über Frieden zu sprechen. Viele in Israel kennen jemanden, der an dem Tag getötet, entführt oder verletzt worden ist. Das Land ist klein, lässt sich in wenigen Autostunden durchqueren. Auch für die Palästinenser:innen in Israel, immerhin knapp 20 Prozent der Bevölkerung, wurde das Leben immer schwieriger. Während Menschen ihrer Gemeinschaft zu Zehntausenden in Gaza getötet werden, haben sie oft Angst, sich zu äußern. Manche fürchten sich sogar, dass sie ein Like in den sozialen Medien in Schwierigkeiten bringen könnte.
Vor fast genau zwei Jahren, am 10. Oktober 2023, klickte Mushon auf einen Zoom-Link. Das Treffen war Wochen zuvor für dieses Datum angesetzt worden. 16 Personen der israelisch-palästinensischen Organisation „A Land for All“ schalteten sich zusammen. Eigentlich war geplant, eine Umstrukturierung in der Organisation zu besprechen. „A Land for All“ setzt sich für ein Konföderationsmodell ein: zwei Staaten, offene Grenzen, Wohnen soll man überall dürfen, unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Ambitionierte Pläne. Die der 7. Oktober auf den ersten Blick so gut wie unmöglich machte.
Die Attacke der Hamas auf Israel und Israels Krieg in Gaza – wie soll da noch ein friedliches Zusammenleben möglich sein? Anstatt etwas zu beschließen, tauschten die 16 Aktivist:innen von „A Land for All“ Worte der Anteilnahme aus, so erzählt es Mushon. Worte der Unterstützung. Und der Scham. „Andere Organisationen wurden davon wirklich getroffen, wir sind gewachsen“, sagt er. „Von diesem Moment an war uns klar, dass unsere Arbeit nun viel schwieriger und viel wichtiger werden würde.“
Ein Samstagabend Ende September dieses Jahres am Strand von Tel Aviv zeigt, was genau mit „schwieriger“ gemeint ist. Die Sonne geht unter und taucht eine Israel-Flagge in orange-rotes Licht. An der Promenade haben sich knapp 100 Menschen versammelt. Sie stellen sich in einer Reihe auf, jede:r hat das Foto eines getöteten Kindes aus Gaza in der Hand. In der Mitte halten mehrere ein großes Banner, darauf steht: „19.424 ermordete Jungen und Mädchen in Gaza.“ Die Zahl wurde schon mehrmals überklebt, die Demonstrierenden passen sie jede Woche an. Mushon ist normalerweise selbst unter den Demonstrierenden, nur heute Abend konnte er nicht kommen.
An den Demonstrierenden laufen Jogger:innen vorbei, manche führen ihren Hund aus oder fahren mit einem Fahrrad um die Flanierenden herum. Und einige der Vorbeigehenden sind wütend.
„Ekelhaft.“
„Warum weint ihr nicht um eure eigenen Leute?“
„Das ist eine psychische Krankheit.“
„Geht weg, ihr Linken.“
„Alle Menschen in Gaza waren glücklich am siebten Oktober!“
Eine junge Frau ist besonders emotional. Eine Viertelstunde steht sie vor den Demonstrierenden, schreit, bezeichnet sie als „krank“. Warum ist sie so wütend, will ich wissen. Sie spricht ohne Pause: Seit eineinhalb Jahren sei sie in der Armee, erzählt sie, und sei in Syrien, im Libanon und in Gaza gewesen. „Es ist angsteinflößend! Ich bin 20 Jahre alt, habe eine Waffe in der Hand und blicke Terroristen in die Augen.“ Sie wolle zur Universität gehen, einen Freund haben, Spaß haben, in den Club gehen. Stattdessen gebe sie drei Jahre ihres Lebens her für die Sicherheit der Menschen, die hier demonstrieren. „Ich kann das nicht sehen!“ Sie weint, eine Freundin zieht sie weg.

Allein mit diesen Fotos provozieren sie viele der Vorübergehenden. | © Isolde Ruhdorfer
Nur 21 Prozent der Israelis denken, dass Israel und ein palästinensischer Staat friedlich nebeneinander existieren können, wie eine Studie des Pew Research Centers von Juni 2025 zeigt. Es ist der niedrigste Prozentsatz, seit das Umfrageinstitut diese Frage im Jahr 2013 das erste Mal stellte. Im Frühjahr 2023, also einige Monate vor Kriegsbeginn, lag der Wert 14 Prozentpunkte höher. Auch wenn die aktuellen Verhandlungen über einen Waffenstillstand erfolgreich sind: In den vergangenen zwei Jahren ist so viel passiert, haben Menschen so viel gelitten, dass wahrscheinlich weiterhin nur ein kleiner Teil der Bevölkerung an ein friedliches Zusammenleben glaubt.
Der 7. Oktober hat für viele Menschen in Israel bewiesen, dass Menschen wie Mushon Zer-Aviv falschliegen. Er sagt, dieser Tag habe bewiesen, dass er richtig liege. „Der 7. Oktober zeigt, dass wir nicht erwarten können, dass Mauern uns schützen und dass wir keinen Frieden schaffen können, indem wir uns hinter ihnen verstecken.“
Mauern gibt es nicht nur zwischen Israel und Gaza, sondern auch zwischen Israel und dem Westjordanland. Knapp 760 Kilometer lang ist dort die Sperranlage, die sich überwiegend auf dem Territorium des Westjordanlandes befindet. Anfang der Zweitausender, als bei der zweiten Intifada immer mehr Israelis bei Anschlägen starben, begann Israel mit dem Bau der Sperranlage. Manche ziehen den Vergleich zur Berliner Mauer. Für viele Palästinenser:innen ist die Mauer kein Schutz, sondern ein Hindernis, das ein Land spaltet.
„Ich bin nicht komplett allein“⬆ nach oben
Mit fremden Menschen nicht einverstanden zu sein, ist das eine. Viel schwieriger wird es aber, wenn es um die eigenen Freund:innen geht. Kürzlich waren Mushon und seine Frau eingeladen bei einem befreundeten Paar. Dann kam „das Thema zur Sprache“, wie es Mushon ausdrückt. Also der Krieg in Gaza. Und er sagte zu seinen Freunden: „Hört mal, ihr wisst, was ich denke. Also werde ich nichts dazu sagen, sonst habe ich bald keine Freunde mehr.“ Es liege nicht daran, dass diese Freunde in irgendeiner Form rassistisch oder faschistisch seien, sagt Mushon. Sie seien einfach überfordert.
Er habe so etwas auch schon bei anderen Freunden erlebt, erzählt er. Die sich zurücklehnen, wenn es um den Krieg geht und den Blick senken. Mushon macht die Geste nach, stützt die Hände auf dem Tisch ab und lehnt sich weg. „Ich brauche auch etwas Ruhe und will nicht die Person sein, mit der niemand etwas zu tun haben will“, sagt er.
Es kann einen mit anderen verbinden, Überzeugungen zu haben, sich für etwas einzusetzen. Es kann einen aber auch ziemlich einsam machen. Das trifft wahrscheinlich in kaum einer Region so sehr zu, wie im Nahen Osten, wo so viele Menschen im ursprünglichen Wortsinn traumatisiert sind.
Und dann ist da noch die Familie. Der Teil mütterlicherseits ist nationalreligiös und lebt in Siedlungen über das gesamte Westjordanland verstreut. Manchmal redet Mushon mit seinen Cousins, aber sie haben sich nicht viel zu sagen. Hin und wieder kommentieren sie unter seinen Social Media Posts. „Sie sind angewidert“, sagt Mushon. Von seinen Posts, von seiner Weltsicht.
Inzwischen arbeitet er weniger in seinem eigentlichen Job als Designer, und mehr als Aktivist. Er hat kaum mehr Kund:innen und braucht sein Erspartes auf. Obwohl er zwei Kinder hat, sechs und 14 Jahre alt. Mushon tut das alles nicht aus reiner Selbstlosigkeit, das ist ihm wichtig. „Stelle mich nicht als einen Gutmenschen dar!”, sagt er am Ende unseres Gesprächs. Er sei eigentlich jeden Tag, konstant, kurz davor zu Weinen. Er hat rote Augen, während er das sagt. Was viele nicht verstünden, ist dass er nicht nur für Palästinenser:innen kämpfe. Es gehe ihm auch um die Zukunft seiner Kinder, um ihn selbst, darum, nicht ständig in Angst und Wut und gegenseitiger Entmenschlichung zu leben. „Ich kämpfe auch für meine eigene Seele.“
Inzwischen ist es Nachmittag geworden, eine Frau mit Kinderwagen geht vorbei. Mushon grüßt, sie unterhalten sich. Eine Kollegin von „A Land for All“, sagt er später, sie haben vor einer Woche einen Workshop über „politische Vorstellungskraft“ gehalten. Mushon grinst kurz. Und sagt, ein bisschen ironisch, aber auch ernst: „Ich bin nicht komplett allein.“
Transparenzhinweis: Ich war in Israel im Rahmen des Sylke-Tempel-Fellowships, das auch die Flugkosten übernommen hat. Dieser Text ist allerdings außerhalb des Fellowships entstanden.
Redaktion: Astrid Probst, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Gabriel Schäfer, Audioversion: Christian Melchert
.png?compress=true&format=auto)