Israels Premierminister Benjamin Netanjahu wird vorgeworfen, Konflikte schneller anzufangen, als sie zu lösen. Gilt das auch aktuell?
Ja, unbedingt. Wir erleben aktuell weltpolitisch einen Paradigmenwechsel, nämlich dass kriegerische Gewalt und die Durchsetzung von Interessen mit Gewalt eine andere Legitimität erlangt haben als noch vor 20, 30 Jahren. Die Legitimität des Krieges durch Geltungsansprüche, die moralisch begründet werden, ist wichtiger als die Legalität des Krieges. Das liegt natürlich daran, dass Russland die Büchse der Pandora mit dem Angriff auf die Ukraine geöffnet hat. Dieses neue Politikmuster hat sich nun auch in Teilen der israelischen Öffentlichkeit etabliert und beginnt sich jetzt auch in den USA durchzusetzen.
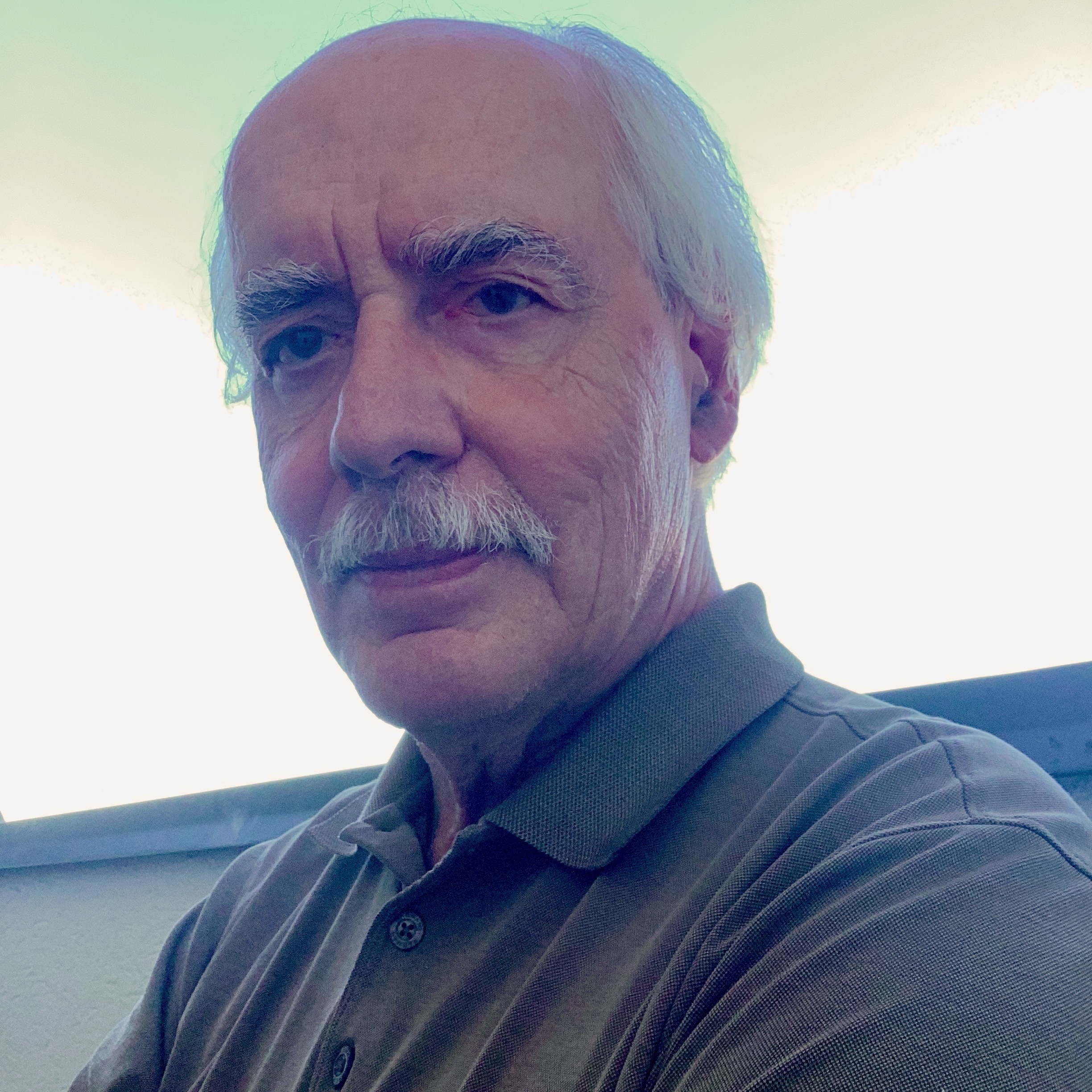
Reinhard Schulze
war von 1995 bis 2018 Professor für Islamwissenschaft und Neuere Orientalische Philologie an der Universität Bern. Sein Buch „Die Geschichte der Islamischen Welt“ gilt als Standardwerk und wurde in mehrere Sprachen übersetzt.
Sind die Vereinten Nationen, das Völkerrecht und das Prinzip der Verhandlung gescheitert?
Früher versuchte man, Konflikte zu lösen, indem man regelbasierte Ordnungen respektierte und durchsetzte. Und dort, wo das nicht gelang, wurde ein Bedrohungsszenario aufgebaut wie etwa im Sechs-Tage-Krieg 1967 oder im Jom-Kippur-Krieg 1973, als die Kriege letztlich über eine Mischung aus Legalität und strategischem Druck beendet wurden. Diese beiden Instrumente haben damals gegriffen.
Heute erleben wir einen fundamentalen Paradigmenwechsel, der bis in die Tiefen der Gesellschaft hineinreicht. Und man muss sich fragen: Was hat ihn eigentlich ausgelöst? Ein Teil der Antwort liegt sicher in der populistischen Wende nach rechts, die vielerorts zu beobachten ist. Und Israel ist geradezu ein Paradebeispiel dafür, wie dieses alte Paradigma an Plausibilität verloren hat und wie mit ihm auch die bürgerlichen Ordnungsvorstellungen zunehmend ins Wanken geraten sind.
Global hat der Angriff auf den Iran Erinnerungen an den Irak-Krieg wachgerufen, der oft als gescheitertes Projekt der US-Konservativen gesehen wird: Der Staat ist instabil, der Islamische Staat konnte sich zeitweise ausbreiten. Ist das für die israelische Regierung ein abschreckendes Beispiel? Oder ein positives Beispiel, weil der Irak heute keine Bedrohung mehr darstellt?
Auf jeden Fall wird der Irak heute als ein positives Beispiel gesehen. Politische Entwicklungen wie im Irak, in Syrien oder auch im Libanon sind strategisch für Israel von großem Vorteil. Es ist sicherlich für Israel eine bequemere Position, wenn sich politische Widersacher in den Nachbarländern sozusagen „gegenseitig an die Gurgel gehen“. Nur muss Israel dann auch immer kontrollieren, was in diesen Ländern los ist und sich gegebenenfalls engagieren.
Einige befürchten aktuell einen Dritten Weltkrieg im Nahen Osten. Ist so eine Ausweitung des Konfliktes auf die arabische Welt denkbar?
Der einzige mögliche Bündnispartner Irans wäre Russland, aber niemand weiß, was dort gerade verhandelt wird. Sollte Moskau bereit sein, Iran unter seinen nuklearen Schutzschirm zu stellen, entstünde ein Szenario, in dem der Ukraine-Krieg mit dem Iran-Konflikt verschmilzt. Das wäre ein geopolitischer Albtraum, das will man gar nicht denken. Die arabische Welt aber ist bei diesem Konflikt eher ein Zaungast und ist auch politisch nicht mehr so wichtig, dass daraus jetzt ein Dritter Weltkrieg entstehen könnte. Diese Zeiten sind vorbei.
Israel hat in den vergangenen Monaten nicht nur den Iran angegriffen und die Hamas in Gaza bombardiert, sondern auch die Hisbollah entscheidend geschwächt. War Netanjahu aus seiner Sicht erfolgreich?
Die israelische Armee hat deutlich gesagt, dass die Bedrohung der israelischen Nordgrenze durch die Hisbollah ausgeschaltet ist. Das ist sicherlich auch der Tatsache zu verdanken, dass die neue Hisbollah-Führung, nachdem ihre wichtigsten Leute getötet wurden, eine politische Neuorientierung vorgenommen hat und nun sehr viel stärker innenpolitische Aspekte im Libanon betont. Die Hisbollah hat sich von der Konfrontation mit Israel entfernt.
Dazu kommt, dass Ende letzten Jahres durch die Schwächung der Hisbollah das Assad-Regime in Syrien gestürzt werden konnte. Versucht Israel aktuell den Nahostkonflikt einseitig zu beenden, durch Stärke und Gewalt?
Die israelische Politik hat ganz klar so etwas wie eine Hegemonie über den Nahen Osten und die Gestaltung des Nahen Ostens insgesamt erzielt. Den Hegemonialanspruch aber muss sich Israel mit der Türkei teilen, insbesondere mit Blick auf Syrien und den Libanon.
Aber während Israel eine militärische Vormachtstellung errungen hat, fehlt weiterhin ein politisches Programm, das diese Ordnung für den Neuen Nahen Osten, wie das oft genannt wird, ausgestaltet. Dieser Wille fehlt nicht nur in Israel, sondern auch in der arabischen Welt.
Hat Israel überhaupt noch ernst zu nehmende Gegenspieler innerhalb der arabischen Welt?
Nur noch wenige para-staatliche Organisationen, eigentlich sind die Huthis im Jemen die Einzigen, die noch versuchen, so etwas wie Gegenfeuer aufzubauen. Selbst die irakischen para-staatlichen Organisationen haben mittlerweile mehr oder weniger ihre Neutralität erklärt. Und die iranische Vision einer Internationale gegen Israel hat sich praktisch in Luft aufgelöst.
Allein die Türkei kann mittelfristig als Gegengewicht auftreten und in einen hegemonialen Wettstreit mit Israel eintreten. Israel kann also nicht so ohne Weiteres sagen: Jetzt ist das Kapitel „Feindschaft mit der arabischen Welt“ beendet. Die Türkei könnte versucht sein, den Antagonismus zu erben und fortzuschreiben.
Ein weitgehend unbeachteter Punkt in der deutschen Öffetlichkeit ist die sogenannte Smotrich-Doktrin, ein Papier des israelischen Finanzministers, in dem er erklärt, dass eine Trennung zwischen Israel und Palästina nicht mehr möglich ist und der Nahostkonflikt nur durch israelische Hegemonie und Dominanz zu lösen sei. Ist diese Haltung in der israelischen Gesellschaft mehrheitsfähig geworden?
Mehrheitsfähig nicht, in Umfragen sagen immer noch rund 60 Prozent der Israelis, dass sie Verhandlungen weiterhin für sinnvoll halten. Aber diese Haltung ist in der Defensive. Die israelische Rechte hat eine Art von Definitionsmacht errungen und die Linke bzw. die bürgerliche Mitte muss beweisen, dass sie mit ihren alten Vorschlägen noch etwas ausrichten kann. Aber diese passive, defensive Haltung führt natürlich dazu, dass die Räume für eine andere Politik immer kleiner werden.
Warum schlagen sich diese Mehrheiten nicht in Wahlergebnissen nieder?
Naja, wenn heute gewählt werden würde, hätte Netanjahu wohl keine Mehrheit mehr. Aber durch den Krieg kann er sich als starker Mann inszenieren, was ihm und seinem Lager nutzt. Netanjahu braucht einen äußeren Gegner und das ist der Iran. Zugleich hat Netanjahu den Traum von einem starken, expansiven Israel in ein populistisches Projekt verwandelt, von dem er nicht mehr zurückkann.
Was meinen Sie mit dem „revisionistischen Traum vom expansiven Israel“?
In den 1920er und 1930er Jahren entwickelten die revisionistischen Zionisten eine Vision, die sich bewusst gegen die linken bürgerlichen Zionisten richtete: Israel sei nicht nur ein Zufluchtsort für Juden, sondern ein Territorium, das militant erobert und ausgeweitet werden könne, bis hin zur Westbank und Gaza. Dieses Konzept eines „imperialen Israels“, wie palästinensische Historiker die zionistische Vision eines „vollständigen Landes Israel“ gerne nennen, wurde nach 1948 unter Staatsgründer Ben Gurion zugunsten eines bürgerlichen Staates zurückgedrängt.
Mit dem politischen Machtwechsel 1977, als der Likud-Block unter Menachem Begin erstmals die Mehrheit errang, wurde dieses Konzept wiederbelebt. Netanjahu hat diesen revisionistischen Traum seit 2005 in ein populistisches Programm überführt, verbunden mit einem klaren Feindbild: der linken, säkularen Gesellschaft. Das ist eine Rhetorik, die wir auch in den USA von Trump kennen.
Seit dem Angriff auf den Iran sind durch die Gegenangriffe auch wieder Menschen in Israel gestorben. Hat dies den Blick der Israelis auf den Konflikt und auf ihre Regierung verändert?
Ja, durchaus. Die alte Idee der Revisionisten, nämlich eine eiserne Mauer zwischen Israel und der arabischen Welt zu errichten, hat neue Aktualität gewonnen. Der Iron Dome ist eine technische Übersetzung dieses Gedankens, aber er hat sich als verwundbar gezeigt. Diese Verwundbarkeit hat auch in der Bevölkerung Verunsicherung ausgelöst, besonders bei jenen, die bisher eher neutral oder gemäßigt dachten.
Viele sagen nun, man müsste diese eiserne Mauer weiter, weiter und weiter hochziehen. Das heißt, dass dann auch diejenigen, die bislang eigentlich eher in der bürgerlichen Mitte beheimatet waren, nun diesen Traum von der Abschottung übernehmen. Insofern hat der iranische Angriff mehr ausgelöst als die Raketen aus dem Irak in den 1990ern.
Der Konflikt ist plötzlich wieder im eigenen Land. Genau das wollte Netanjahu verhindern.
Ja, und genau das löst Panik aus. Viele Israelis sitzen sprichwörtlich auf gepackten Koffern und empfinden es zudem als grausam, dass die israelische Regierung quasi ein Ausreiseverbot erlassen hatte, das bis vor Kurzem galt, und sie nicht rauskommen. Auch die Legitimität der Regierung ist damit im Fluss.
Führt das zu einer politischen Veränderung? Oder bleibt es bei Unzufriedenheit ohne Folgen?
Eher Letzteres. Bislang deutet nichts auf einen Politikwechsel hin. Es entsteht eher der Eindruck, dass eine Art von Bestätigungsdiskurs für die Erwartung und Befürchtung stattfindet, die sowieso schon in der Bevölkerung existieren.
Sie beschäftigen sich seit 1974 wissenschaftlich mit dem Nahostkonflikt und Israel. Welchen Aspekten in der Betrachtung des Landes kommt in Ihren Augen zu wenig Aufmerksamkeit zu?
Man sollte stärker auf die innenpolitische Komplexität Israels hinweisen. Es geht immer sehr, sehr schnell entweder nur die israelische Regierung oder die rechtsradikalen Akteure in der israelischen Regierung. Dabei wird die Komplexität, werden die inneren, unterschiedlichen Lebenswelten, die in Israel entstanden sind, oft außer Acht gelassen. Diese Entdifferenzierung im Blick auf Israel spiegelt sich übrigens auch in der Wahrnehmung Gazas und der arabischen Welt wider. Und genau das erschwert politische Lösungen, die mit der tatsächlichen Vielschichtigkeit der Lage umgehen könnten.
Die israelischen Angriffe auf Gaza haben viele zivile Opfer gefordert und international, besonders in der arabischen Welt Empörung ausgelöst. Auch wenn die Staaten nicht militärisch reagieren, bleibt die Isolation Israels bestehen. Gibt es aus Sicht der israelischen Politik eine Strategie, aus dieser Lage wieder herauszukommen?
Ich befürchte, dass die derzeitige israelische Politik gar keine Exit-Strategie für Gaza verfolgt. Eine politische Lösung ist nicht vorgesehen. Stattdessen geht es darum, Gaza so weit zu neutralisieren, dass es für Israel keine Bedrohung mehr darstellt und im Idealfall sogar als Entwicklungsraum nutzbar wird. Dieses Modell soll langfristig auch auf die Westbank übertragen werden. Es ist die Wiederbelebung des alten revisionistischen Traums. Eine Einbindung der palästinensischen Bevölkerung spielt dabei keine Rolle. Die arabischen Staaten äußern allenfalls moralischen Protest, haben aber keine wirklichen Handlungsmöglichkeiten. Und die israelische Politik setzt darauf, dass sich das aussitzen lässt.
Redaktion: Isolde Ruhdorfer, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert und Iris Hochberger

