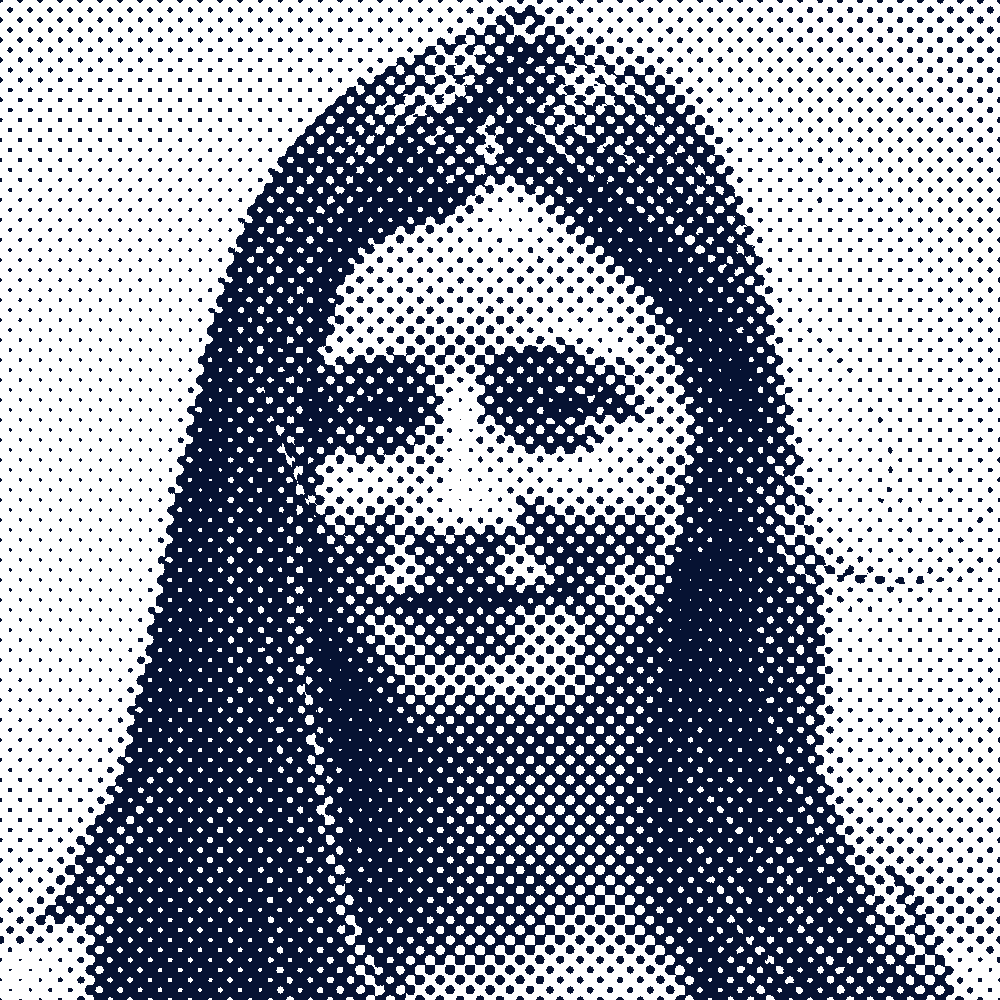Über den Sommer hinweg haben wir dir Romane und Sachbücher empfohlen, von denen wir denken, dass sie mehr Menschen kennen sollten. Nun haben wir uns in der Redaktion gefragt, welche Klassiker uns nicht loslassen. Das kann das Buch sein, das man zwar schon in der Schule gelesen hat, aber erst als Erwachsene:r so richtig wertschätzt oder ein Werk, das vermutlich erst in der Zukunft den Status des Klassikers erhalten wird. Viel Spaß beim Lesen!
Giovanni’s Room von James Baldwin
Lea Schönborn
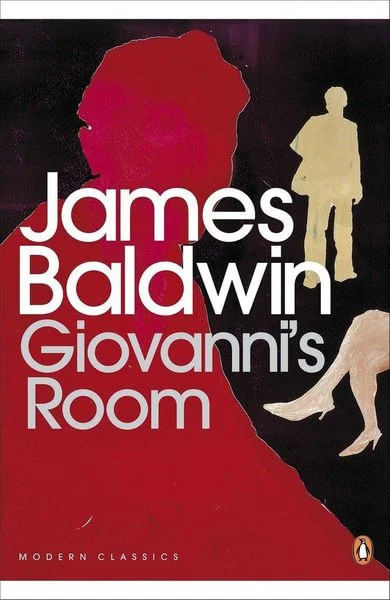
Giovanni’s Room von James Baldwin, 1956, Neuauflage 2001 von Penguin Books Ltd
Ein Freund hat mir „Giovanni’s Room“ ausgeliehen, als ich mal wieder auf der Suche nach neuer Lektüre war. Es hat mich umgehauen. Es ist so schmerzhaft und gleichzeitig schön, der Hauptperson beim Leiden zuzusehen. Ich bin kein Mann und auch nicht schwul, aber James Baldwin hat diesen Text so eindringlich geschrieben, dass ich den Schmerz und das Zerissensein nachfühlen konnte, als wäre es mein eigener. Baldwin sagte später über das Buch, es gehe darum, was passiert, wenn man Angst hat, jemanden zu lieben.
Das Buch wurde 1956 veröffentlicht. Es spielt in Paris, wo das Leben für queere Menschen etwas freier war als zur selben Zeit in den USA. Baldwin lebte selbst dort. Es geht um zwei Männer, die gemeinsam das Leben entdecken – und den Tod.
Sein Verleger soll Baldwin gesagt haben, er solle das Manuskript verbrennen, als Baldwin es ihm zugeschickt hatte. Baldwin ignorierte diesen „Rat“. Ein Glück für uns.
Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald
Rico Grimm
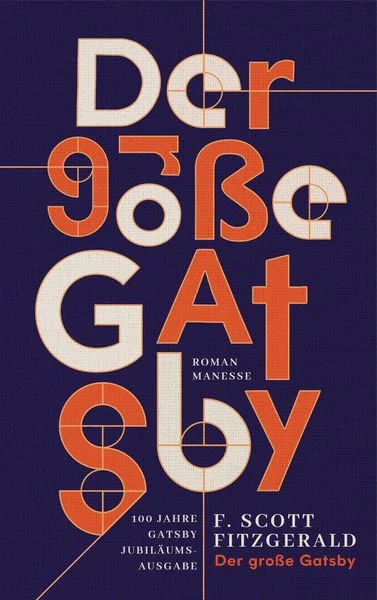
Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald, 1925, Neuauflage 2025 von Manesse
Viele Englischlehrer:innen lieben dieses Buch, weil es mit seiner starken Symbolik so einfach zu interpretieren scheint. Dabei ist es das überhaupt nicht. Beim Lesen bin ich mir niemals sicher, woran ich eigentlich bin. Das ganze Buch durchzieht eine Mystik in Gestalt des rätselhaften, neureichen Gatsby, der seiner Jugendliebe hinterhertrauert. Fitzgerald löst diese Mystik niemals auf und so bleibt offen: Ist es eine Liebesgeschichte, eine Gesellschaftssatire, ein Gaunerstück, vielleicht sogar ein Krimi?
Ich liebe dieses Buch, weil es Fitzgerald in jeder Szene gelingt, die Gemeinheit und Grandezza, die einer Begegnung zweier Menschen innewohnen kann, mit neuen Worten einzufangen. Fitzgeralds bravouröser Stil wird so der eigentliche Protagonist der Geschichte. Zurückgenommen, andeutungshaft, aber gleichzeitig hochpräzise holt er uns in das New York der 1920er Jahre und zeigt uns den kühlen Pathos der Moderne.
Zweimal habe ich den Gatsby schon gelesen, es werden noch einige Male dazukommen. Denn das ist ein Buch, das besser wird, je älter man wird. Gerade ist es in einer wunderbaren Neuübersetzung von Bernhard Robben bei Manesse erschienen.
Der Dschungel von Upton Sinclair
Rebecca Kelber
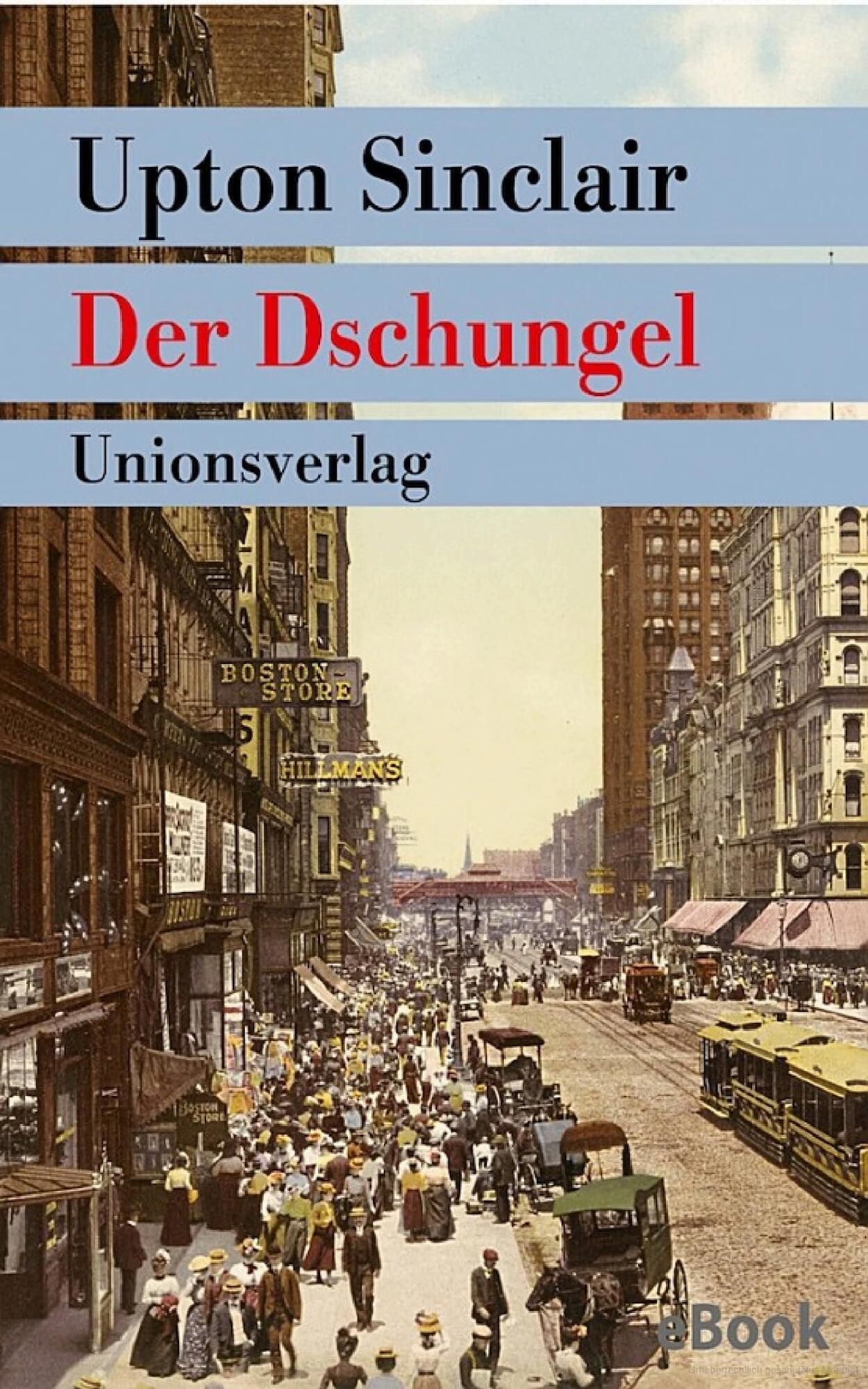
Der Dschungel von Upton Sinclair, 1905, 2020 von Unionsverlag. Übersetzung: Ingeborg Gronke
Oft weiß ich erst nach Jahren, wie gut ein Buch wirklich war. Schafft es den Test der Zeit, ein Klassiker zu werden, ein Buch, das mein Denken prägt? „Der Dschungel“ hat das definitiv geschafft. Seitdem habe ich seine Bilder vor Augen, wenn ich Worte wie „Ausbeutung“ höre.
Sinclair beschreibt das Schicksal einer litauischen Einwandererfamilie. Sie migrieren Anfang des 20. Jahrhunderts in die USA, um dem Elend des damaligen russischen Reichs zu entkommen. Sie landen in Chicago und arbeiten in der Fleischindustrie. Die Protagonist:innen glauben an den amerikanischen Traum – und werden von ihm verschlungen.
Das Buch ist stellenweise kaum aushaltbar: Die Frauen werden vergewaltigt, sterben bei der Geburt ihres Kindes oder müssen sich zwangsprostituieren, die Männer landen im Gefängnis, werden alkoholabhängig oder sterben an einer Lungenentzündung. Am Ende findet der letzte übrig gebliebene Protagonist zum Sozialismus und damit zu einem guten Leben – hier gleitet das Buch ins Pathetische.
Sinclair recherchierte sieben Wochen undercover in der Chicagoer Fleischbranche. In „Der Dschungel“ macht er die reale Brutalität dieses Arbeiterlebens plastisch, weil er es anhand von Menschen erzählt, denen man Gutes wünscht. Die Thematik ist immer noch aktuell: Bis heute arbeiten in der deutschen Fleischbranche viele Ausländer:innen unter elenden Bedingungen.
Bei seinem Erscheinen 1905 sorgte das Buch für großes Aufsehen, der damalige Präsident Theodore Roosevelt schickte zwei Referenten nach Chicago, um prüfen zu lassen, ob die Zustände dort wirklich so furchtbar waren, wie von Sinclair beschrieben. Sie bestätigten es. Daraufhin kam es zu Reformen, die allerdings nur die hygienischen Bedingungen verbessern sollten. „Auf die Herzen der Leute hatte ich es abgesehen, ihre Mägen habe ich getroffen“, sagte Sinclair deshalb.
Die Wand von Marlen Haushofer
Isolde Ruhdorfer
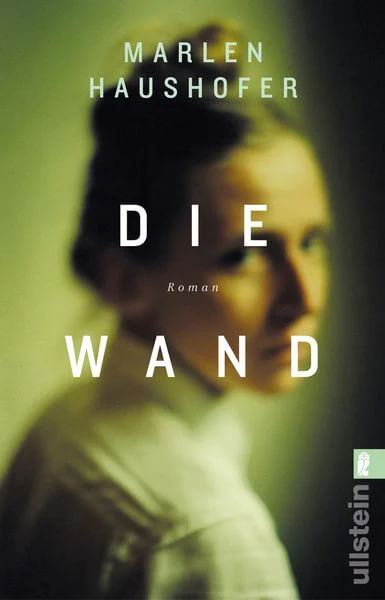
Die Wand von Marlen Haushofer, 1963, Neuauflage 2004 von List Taschenbuch
Eines Tages erwacht die Ich-Erzählerin in der Berghütte, in der sie gerade einen Wochenendurlaub macht. Allein. Die Gegend ist großräumig von einer durchsichtigen Wand eingeschlossen. Nichts und niemand kommt herein, sie kommt nicht heraus. Woraus diese Wand besteht und warum sie plötzlich erschien, bleibt unklar, es ist auch nicht so wichtig.
Die Protagonistin, deren Namen man nicht erfährt, muss jetzt überleben: Bohnen anbauen, mit der Sense mähen, Himbeeren sammeln oder Wild jagen. Ihre einzige Gesellschaft sind ihre Tiere: der Hund namens Luchs, die Kuh Bella und die Katze, die einfach nur Katze heißt.
Die Geschichte handelt von Einsamkeit, von der Beziehung zwischen Mensch und Tier und der Schönheit und Grausamkeit der Natur. Das sind alles große und schwammige Themen, von jedem anderen Autor wäre eine solche Geschichte prätentiös und langweilig. Aber Marlen Haushofer hat es geschafft, so real, poetisch und berührend darüber zu schreiben, dass ich mir sogar Sätze mit Bleistift angestrichen habe. Manche davon kann ich auswendig und zitiere sie gelegentlich. Zum Beispiel: „Ich bin schon jetzt nur noch eine dünne Haut über einem Berg von Erinnerungen.“
Das Tolle an der Geschichte ist, dass sie jenseits der großen Gefühle ganz pragmatisch den Alltag dieses Lebens beschreibt. Die Blasen an den Fingern der Protagonistin, die täglichen Herausforderungen, weil sie sich mit der Landwirtschaft nicht so gut auskennt. Wie sie Himbeersaft und Butter zubereitet. Und immer wieder geht es um ihre geliebten Tiere, die zu versorgen ihr wichtigster Lebensinhalt geworden ist. „Die Wand“ hat mir mehr über den Sinn des Lebens beigebracht, als es jeder Ratgeber oder Glücksphilosoph könnte.
Die geheime Geschichte von Donna Tartt
Theresa Bäuerlein
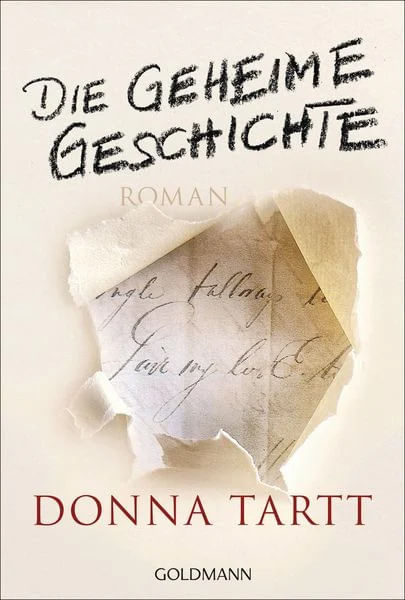
Die geheime Geschichte von Donna Tartt, 1992, Neuauflage 2017 von Goldmann. Übersetzung: Rainer Schmidt
Manchmal verliebe ich mich regelrecht in eine Autorin oder einen Autor und lese dann wochen- manchmal monatelang, jedes einzelne ihrer Bücher. Ich versinke in der Welt, die sie schaffen, schlafe abends damit ein, greife morgens wieder danach. Wenn ich alles gelesen habe, bin ich traurig, aber auch ein bisschen erleichtert.
Zuletzt ging es mir so mit der Autorin Donna Tartt. Und es begann damit, dass ich im Urlaub in Italien war, 35 Grad klebrige, schwüle Hitze, jede Menge Mücken, sogar der Pool war zu warm. Ein Klima, in dem man eigentlich nichts essen kann, außer einer riesigen Wassermelone am Tag. Ideal, um im Schatten zu dösen und ein Hörbuch zu hören.
Ich entschied mich für „Die geheime Geschichte“ von Donna Tartt aus zwei Gründen: Meine Bücherei-App hatte es mir vorgeschlagen. Und es war sehr lang, 22 Stunden und 4 Minuten.
Donna Tartt nimmt sich für jedes ihrer Bücher ganze zehn Jahre Zeit. Das merkt man ihnen an. Die Sprache ist dicht und verschlungen wie ein Weg, der durch einen Dschungel führt. Drei Romane hat sie bisher geschrieben. „Die geheime Geschichte“ ist ihr erster, erschienen 1992.
Ich hörte das Buch auf Englisch („The Secret History“), die Autorin liest es selbst.
Tartt ist Jahrgang 1963. Ihre Stimme klingt wie die eines Teenagers aus den Südstaaten der USA (die Autorin wurde in Mississippi geboren). Wenn sie „what“ oder „where“ sagt, klingt es wie „hwat“ oder „hwere“. Irgendwie trägt das zum Zauber des Buches bei. Was vielleicht merkwürdig klingt, wenn man bedenkt, dass sich die Handlung um einen Mord in einer Studentenclique an einem fiktiven College dreht. Es ist eine umgekehrte Detektivgeschichte, erzählt von einem der sechs Studenten, Richard Papen, der Jahre später über die Umstände des Mordes an seinem Freund Edmund „Bunny“ Corcoran nachdenkt. Mehr will ich nicht verraten. Ich kann nur sagen, dass ich beim Hören oft fast vergessen habe, dass ich in Italien war, nicht an einem College in Vermont.
Die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll
Astrid Probst
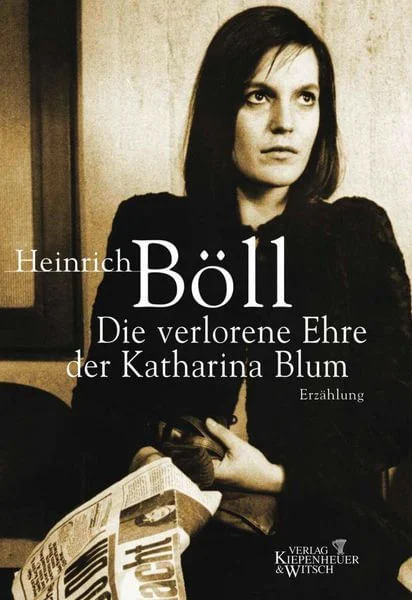
Die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll, 1974, Neuauflage 2009 von Kiepenheuer & Witsch
„Personen und Handlung dieser Erzählung sind frei erfunden. Sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der Bild-Zeitung ergeben haben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich“, schreibt Heinrich Böll im Vorwort und beginnt dann mit nüchterner Sprache zu erzählen, wie es dazu kam, dass Katharina Blum ihre Ehre verlor.
Schuld ist die Sensationslust des Boulevardjournalismus. Am Anfang ist Blum eine unbescholtene Hauswirtschafterin. Doch dann folgen Lügen, Gerüchte in Medienberichten einer Zeitung, die Böll die ZEITUNG nennt, hasserfüllte Anrufe und Briefe. Wut und Verzweiflung treiben Blum zu einer Tat, nach der sie nicht mehr als unbescholten gelten kann. Nur 160 Seiten kurz ist Bölls Erzählung. Aber diese 160 Seiten genügen, um zu begreifen, wie sich eine mediale Hetzjagd entspinnt, wie sie Leben zerstören kann.
Vor 51 Jahren erschien Bölls Werk, dessen Titel vollständig lautet: „Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann“. Böll zeigt dabei auch, welche Macht Sprache hat und wie manipulativ sie eingesetzt werden kann. Obwohl er diese Geschichte schrieb, als die Welt noch offline war, sie als Anklage gegen den Sensationsjournalismus verfasste, beschleicht einen in Zeiten von Shitstorms und Cybermobbing das Gefühl, dass seine Warnung heute aktueller ist denn je.
Alias Grace von Margaret Atwood
Rebecca Kelber
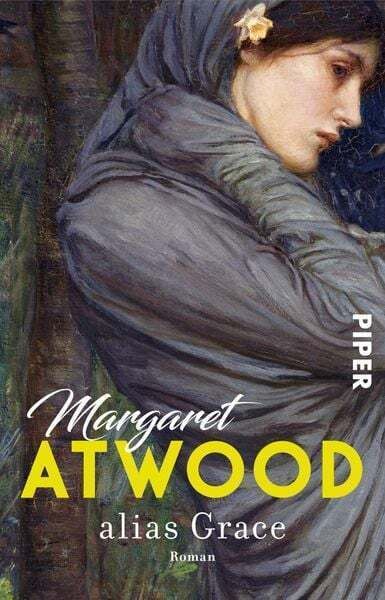
Alias Grace von Margaret Atwood, 1996, Neuauflage 2017 von Piper Taschenbuch. Übersetzung: Brigitte Walitzek
Nichts und niemandem kann man in diesem Roman vertrauen, schon gar nicht der Erzählerin Grace. Seit vielen Jahren sitzt sie im Gefängnis, weil sie als 16-Jährige mit ihrem angeblichen Geliebten einen Mord an ihrem Dienstherren und seiner Haushälterin begangen haben soll. Ein Komitee setzt sich dafür ein, sie zu begnadigen und engagiert einen angehenden Psychologen, der herausfinden soll, ob sie schuldig ist oder nicht.
Dieser Roman ist erst 1996 erschienen, aber er liest sich für mein ungeschultes modernes Auge so, als wäre er mindestens hundert Jahre zuvor geschrieben worden. Die große Erzählerin Margaret Atwood nimmt die Leser:innen in diesem Buch mit ins viktorianische Zeitalter, mitten in das Kanada des 19. Jahrhunderts. Grace Marks gab es wirklich, die Morde auch. Was klingt wie ein historischer Roman, bietet außerdem noch eine Geistergeschichte, Thrillerelemente und feministische Sozialkritik. Ein Buch, das ich gleich nochmal lesen will.
In einer vorherigen Fassung hieß es, bei Alias Grace werde der Dienstherr ermordet. Tatsächlich waren es aber der Dienstherr und eine Haushälterin. Wir haben das korrigiert.
Redaktion: Rebecca Kelber, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Isolde Ruhdorfer, Audioversion: Iris Hochberger