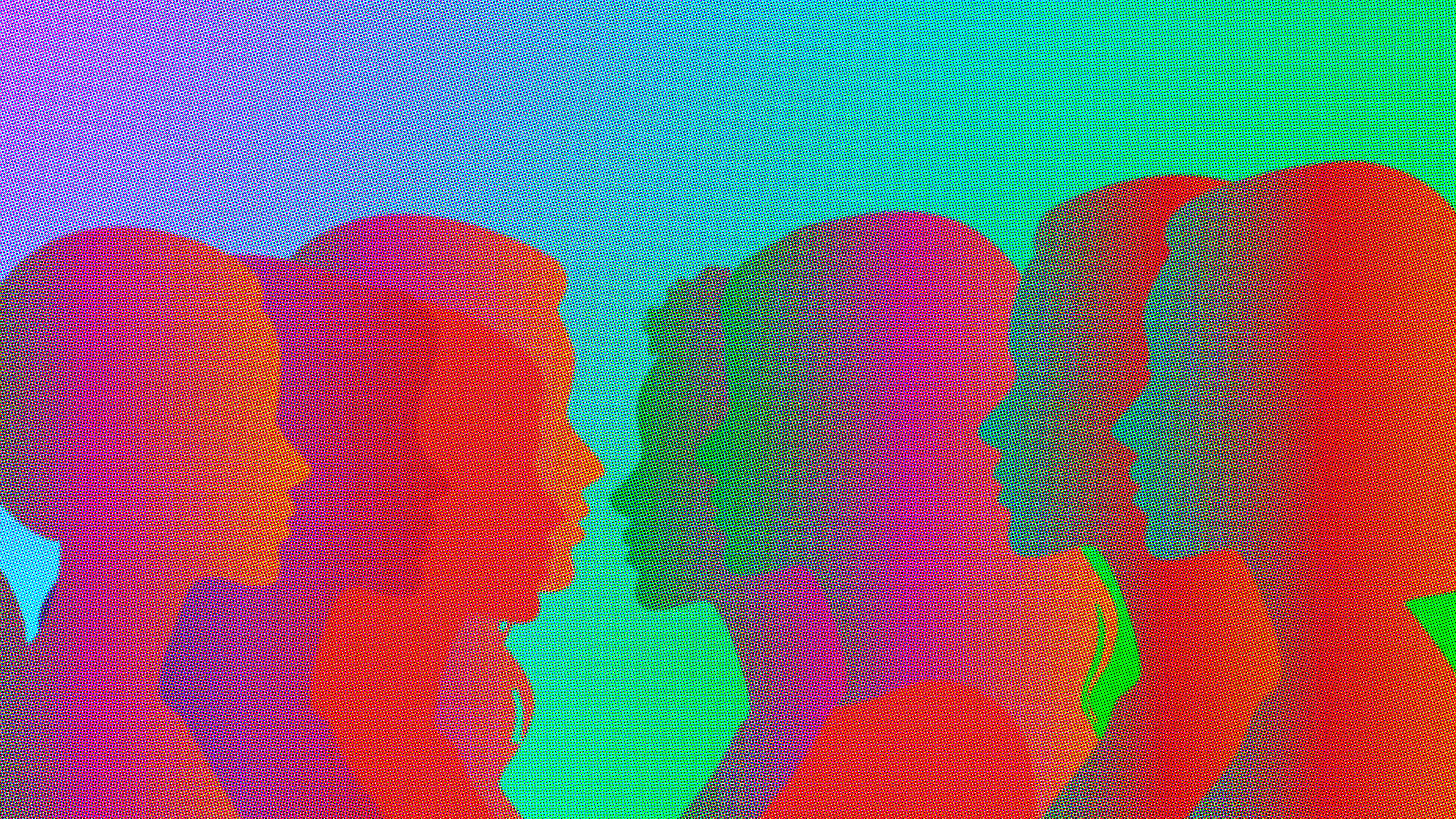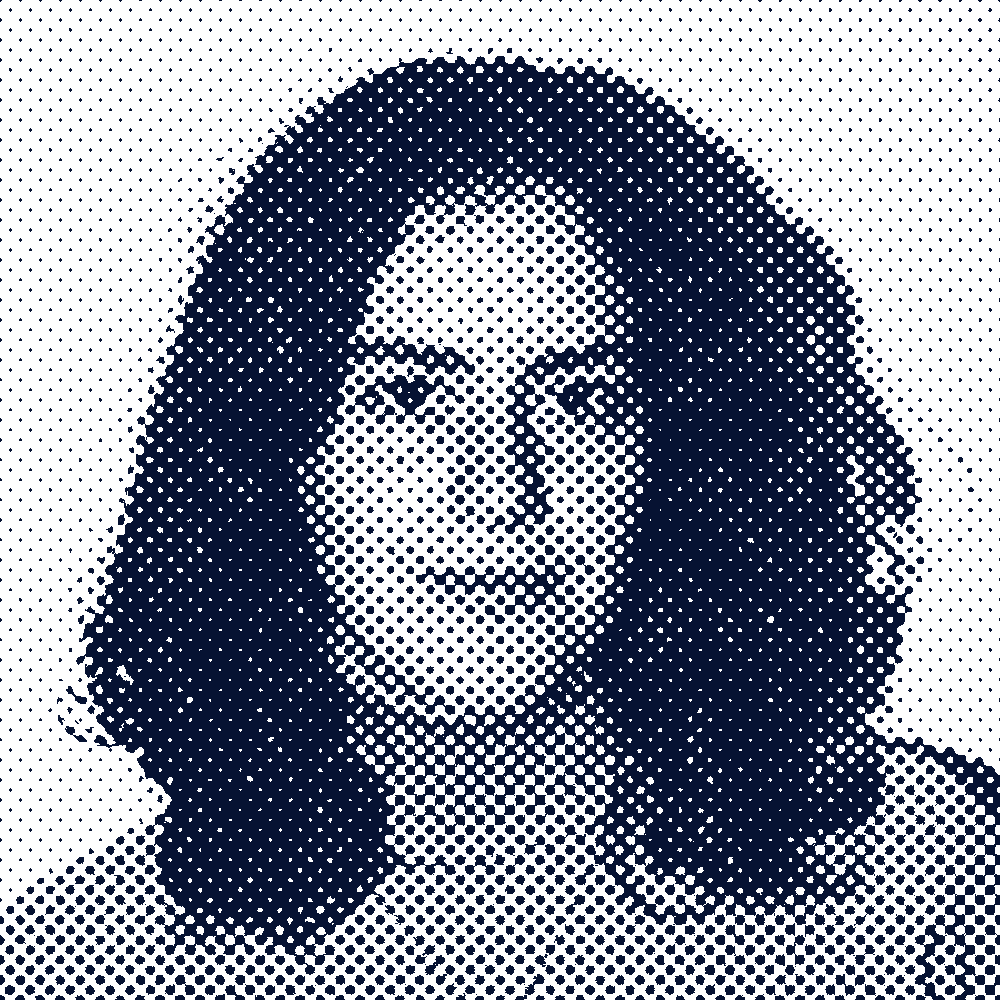Elisabeth Selbert haben wir zu verdanken, dass Männer und Frauen laut dem Grundgesetz gleichberechtigt sind. Emine Orhanoğlu hat als Gastarbeiterin für ihre Rechte gekämpft. Rita Thomas gab nach dem Mauerbau queere Partys in ihrer Wohnung.
Das sind drei von acht Frauen aus dieser Liste, die die deutsche Gesellschaft durch ihren weiblichen, teils queeren Blick verändert haben. Sie stehen für den Mut, anders zu sein, Neues zu wagen, die Welt ein Stück besser zu machen.
Trotzdem kennt sie kaum jemand. Dabei inspiriert es, ihre Geschichten zu lesen.
Anita Augspurg, Kämpferin für die rechtliche Gleichstellung der Frau⬆ nach oben
Nina Roßmann
Anita Augspurg war ausgebildete Lehrerin, Fotografin, Schauspielerin, Deutschlands erste promovierte Juristin, Bäuerin und eine einflussreiche Feministin, die sich gegen die Ehe und für das Wahlrecht für Frauen einsetzte.
Geboren 1857 als jüngstes von fünf Kindern im niedersächsischen Verden, zog es sie nach dem Abitur nach Berlin. Dort besuchte sie ein Lehrerinnenseminar – wohl nicht, weil sie unbedingt Lehrerin werden wollte, sondern weil das damals eine der wenigen Möglichkeiten für bürgerliche Frauen war, einer Heirat zu entgehen. Sie arbeitete nie als Lehrerin, sondern nahm Schauspielunterricht und tourte durch Europa.
Später eröffnete sie mit ihrer Lebensgefährtin Sophia Goudstikker ein Fotoatelier in München. Außerdem engagierte sie sich feministisch: Sie organisierte Kongresse, veröffentliche Beiträge in Zeitschriften, rief zum „Eheboykott“ auf und setzte sich dafür ein, dass Frauen wählen können. Um diese Forderung besser durchsetzen zu können, studierte sie Jura in Zürich (in Deutschland konnten Frauen damals noch nicht Jura studieren) und promovierte im Alter von 40 Jahren.
Ihre zweite Lebenshälfte verbrachte sie mit Lida Gustava Heymann. Beide waren in der Frauen- und Friedensbewegung aktiv und betrieben einen ökologischen Bauernhof. Während der Nazi-Diktatur zogen die beiden in die Schweiz, wo sie relativ verarmt bis zu ihrem Tod zusammenlebten. In ihren Lebenserinnerungen schreiben sie: „Nichts ist unmöglich.“
Lena Christ, feministische Stimme der bayerischen Literatur⬆ nach oben
Isolde Ruhdorfer
Lena Christ als Heldin zu bezeichnen, wäre falsch. Sie war unvernünftig, kriminell und hat über andere gelogen. Lena Christ war aber auch eine Frau, die in ihrem Leben so viel erleiden musste, dass es wehtut, nur darüber zu lesen.
Christ wird 1881 in Glonn, einem Dorf nahe München, geboren. Sie ist ein uneheliches Kind und wächst zunächst bei ihren Großeltern auf. Mit acht Jahren zieht sie nach München, dort soll sie bei der Arbeit in der Wirtschaft ihrer Mutter helfen. Und von da an beginnt die Qual. Die Mutter verprügelt sie regelmäßig, erzählt Christ in ihrer Autobiografie. „Jede, auch die geringste Verfehlung wurde mit Prügeln und Hungerkuren bestraft, und es gab Tage, wo ich vor Schmerzen mich kaum rühren konnte.“ Christ geht ins Kloster, kehrt doch wieder zurück, heiratet einen Kohlenhändler, bekommt mehrere Kinder. In der Ehe leidet sie unter ihrem gewalttätigen Mann.
Ich habe mit Lena Christ gelitten, als ich ihre Autobiografie „Erinnerungen einer Überflüssigen“ gelesen habe. Weil sie so klar und direkt über diese brutale Zeit in Bayern um die Jahrhundertwende schreibt. Und weil ich aus ihren Büchern gelernt habe, was es damals bedeutete, eine Frau zu sein. Bekannte Romane von ihr heißen „Die Rumplhanni“ und „Mathias Bichler“. Christ hat einen ganz besonderen Schreibstil, der sie in Bayern berühmt machte. Darüber hinaus kennt sie kaum jemand.
Allerdings hat Christ in ihrer Autobiografie auch gelogen: Zum Beispiel wurde ihr erster Ehemann nicht, wie sie schreibt, in eine „Irrenanstalt” eingeliefert. Was Christ auch nicht schreibt, ist, dass sie wegen Gelegenheitsprostitution ins Gefängnis musste und Bilder fälschte. Um dem Prozess zu entgehen, beging sie 1920 Suizid.
Das Leben und das Werk von Lena Christ sind schwere Kost. Aber sie war auch eine Frau, die ständig um ein besseres Leben kämpfte und irgendwie ihren Platz finden wollte.
Hermine Heusler-Edenhuizen, Wegbereiterin der modernen Geburtenkontrolle⬆ nach oben
Silke Jäger
Im Jahr 1909 eröffnete Hermine Heusler-Edenhuizen (1872 bis 1955) als erste Frau in Deutschland eine Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, erst in Köln und später in Berlin.
Was sie Anfang des 20. Jahrhunderts forderte, ist heute noch aktuell: Sie setzte sich für die kostenlose Abgabe von Verhütungsmitteln durch Krankenkassen und Fürsorgeverbände, die Abschaffung des Abtreibungsverbots sowie eine Preisregelung für den Schwangerschaftsabbruch ein. Sie engagierte sich für die schmerzfreie Geburt und die Bekämpfung des Kindbettfiebers.
Außerdem forderte sie umfassende Fürsorgemaßnahmen für Mutter und Kind ein und ermunterte Frauen, Sport zu treiben und einen Beruf zu ergreifen.
Hermine Heusler-Edenhuizen musste sich sowohl privat als auch beruflich gegen Widerstände durchsetzen. Privat, weil sie einen geschiedenen Mann heiratete, was damals ein Skandal war, und beruflich, weil es für Frauen weder üblich war, Abitur zu machen, noch Medizin zu studieren. Dass Mädchen überhaupt Abitur machen können, erfuhr die junge Hermine nur, weil sie in einer Buchhandlung auf einen Zeitschriftenartikel mit dieser Info stieß. Später als Medizinstudentin war sie auf die Gunst ihrer Dozenten angewiesen. Als Frau durfte sie offiziell nur Gasthörerin sein.
Hermine Heusler-Edenhuizen hat sich nicht nur selbst durchgekämpft, sie setzte sich auch dafür ein, dass es andere Frauen leichter haben als sie. Denn sie war Gründungsmitglied des Deutschen Ärztinnenbundes, in dem sich Ärztinnen weiterbilden und vernetzen können.
Irmtraud Morgner, feministische Schriftstellerin in der DDR⬆ nach oben
Nina Roßmann
Irmtraud Morgner, geboren 1933 in Chemnitz, war eine der bekanntesten Schriftstellerinnen der DDR. Sie schrieb über die Rolle von Frauen in der Gesellschaft und nutzte dafür phantastische Elemente. In „Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura“ trifft eine alleinerziehende Frau aus der DDR eine 800 Jahre alte französische Dichterin. In „Amanda: Ein Hexenroman“ entdeckt die Triebwagenfahrerin aus Ost-Berlin, dass sie eigentlich eine Hexe ist.
Die phantastischen Elemente in ihren Büchern nutzte Morgner auch, um indirekt Kritik an der DDR zu üben. Von deren Repressionen war sie direkt betroffen. Einige ihrer Werke wurden zensiert und ihr zweiter Mann spionierte sie für die Staatssicherheit aus.
Morgner studierte in Leipzig Literatur. Später zog sie nach Berlin, arbeitete zunächst als Lektoratsassistentin und bald als freiberufliche Schriftstellerin. Von 1954 bis 1970 war sie mit dem späteren Lektor im Aufbau Verlag Joachim Schreck verheiratet, mit dem sie einen Sohn bekam. 1972 heiratete sie den Journalisten Paul Wiens, ließ sich jedoch 1977 abrupt scheiden, nachdem sie herausgefunden hatte, dass er Stasi-Spitzel war.
Morgner erhielt mehrere Literaturpreise der DDR und der BRD, darunter den „Literaturpreis für grotesken Humor“. Lachen war für sie auch feministische Praxis. Der Zeitschrift Emma sagte sie kurz vor ihrem Tod: „Frauen, denen das Lachen im Ernst nicht vergangen ist – das können viele Männer ganz schlecht vertragen. Weil in solchem Gelächter eine gewisse Souveränität durchklingt.“
Irmtraud Morgner starb kurz nach dem Mauerfall im Mai 1990 an Krebs.
Emine Orhanoğlu, Kämpferin für fairen Lohn für Frauen⬆ nach oben
Nina Roßmann
Emine Orhanoğlu war eine von 1.700 überwiegend migrantischen Frauen, die 1973 den Automobilzulieferer Pierburg KG in Nordrhein-Westfalen bestreikten. In einem Video berichtet sie davon. „Eine Mark mehr“, skandierten die Frauen und bekamen sie am Ende auch. Ihre Löhne lagen dennoch zwischen 30 und 40 Prozent unter denen der Männer.
Sie kam 1964 als 19-Jährige nach Deutschland und arbeitete in verschiedenen Fabriken. Ihre Kinder lebten zeitweise bei ihrer Schwester in der Türkei. Denn von Gastarbeiterinnen wurde erwartet, in Vollzeit zu arbeiten. Kindergartenplätze gab es in Westdeutschland zu wenige, für unter Dreijährige quasi gar nicht.
Emine Orhanoğlu leistete schwere Arbeit, lebte in beengten Verhältnissen, mit einer Toilette für zehn Personen, erlebte immer wieder Rassismus und verdiente so wenig, dass sie nichts zurücklegen konnte.
Viele hätten während des Streiks Angst gehabt, ihre Arbeit zu verlieren, erzählt Emine Orhanoğlu. „Da ist die Tür, geh wenn es dir nicht passt“, bekommt sie zu hören. Doch sie lässt sich nicht einschüchtern und weiß, dass sie vielleicht nicht allein, aber gemeinsam mit anderen etwas erreichen kann: „Ich habe gelernt, für meine Rechte zu kämpfen. Wenn man zusammenhält, schafft man das.“
Elisabeth Selbert, Mutter des Grundgesetzes⬆ nach oben
Rebecca Kelber
Sie war nicht nur eine Kämpferin, sondern eine gewiefte politische Strategin. Denn sie setzte durch, dass ein Satz ins Grundgesetz geschrieben wird, den wohl jeder kennt: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“
1896 wird Selbert in einen kleinbürgerlichen Haushalt geboren, der Vater arbeitet als Gefängniswärter, die Mutter kümmert sich um die vier Kinder. Nach der Novemberrevolution 1918 entdeckt sie die Politik für sich, tritt wie ihr späterer Mann Adam Selbert der SPD bei. Weil sie bald merkt, dass ihr theoretische Grundlagen fehlen, holt Selbert 1926 das Abitur nach und studiert Jura – da ist sie schon Mutter von zwei Kindern. Kurz bevor die NSDAP Frauen den Zugang zum Anwaltsberuf verwehrt, wird sie als Rechtsanwältin zugelassen.
1948 wird sie als politisch Unbelastete in den parlamentarischen Rat gewählt, der das Grundgesetz schrieb, als eine von vier Frauen unter 61 Männern. Für sie war die Gleichberechtigung von Mann und Frau eine Selbstverständlichkeit, aber selbst die anderen drei Frauen stimmten in einer ersten Lesung im Hauptausschuss gegen die Formulierung.
Statt ihre Niederlage hinzunehmen, tourte Selbert daraufhin durch die Republik, rief im Radio und bei Veranstaltungen dazu auf, dem parlamentarischen Rat Briefe zu schreiben und sich für den Paragraphen einzusetzen. Dabei gelang es ihr anscheinend, den Widerstand deutlich größer wirken zu lassen, als er war. Selbert sprach etwa von Waschkörben voller Protestbriefe, die es wohl so nie gegeben hat. Und sie hatte damit Erfolg: Es kam zum Umdenken im parlamentarischen Rat, der nun für die Formulierung stimmte. Die direkte Folge: Große Teile des patriarchalischen Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) mussten umgeschrieben werden. 1957 beschloss der Bundestag das erste Gleichberechtigungsgesetz und passte das BGB zumindest etwas an. Fortan durften Männer ihren Frauen nicht mehr verbieten zu arbeiten, und das Vermögen der Frau gehörte nach der Hochzeit nicht mehr automatisch ihrem Mann.
Josepha von Siebold, Pionierin der Geburtshilfe⬆ nach oben
Silke Jäger
Josepha von Siebold wurde 1771 im thüringischen Geismar geboren und starb 1849 in Darmstadt. Sie erhielt als erste deutsche Frau die Ehrendoktorwürde für ihre „Entbindungskunst“.
Ihr zweiter Mann, der Arzt Damian von Siebold, hatte in der Nähe von Darmstadt eine Landarztpraxis, die nicht genug Geld für die siebenköpfige Familie abwarf. So beschloss Josepha von Siebold, ihren Mann in der Praxis zu unterstützen. Sie absolvierte ein Studium der Frauenheilkunde in Würzburg, für das sie nur durch ihren Schwiegervater und ihren Schwager, beide wichtige Ärzte, eine Ausnahmegenehmigung erhielt.
Im Gegensatz zu ihren männlichen Kommilitonen musste sie während der Vorlesungen hinter einem Vorhang sitzen und wurde von den Übungen ausgeschlossen. Als Hebamme sammelte sie viele praktische Erfahrungen und absolvierte 1807 erfolgreich die für Frauen besonders strenge Staatsprüfung zur Frauenärztin: Erst nach vier Stunden waren die Prüfer zufrieden.
Josepha von Siebolds größtes Ziel war, die Sterblichkeitsrate bei Geburten zu senken. Sie setzte sich dafür ein, dass Schulen für Hebammen eingeführt wurden und machte Hausbesuche bei den Frauen, die die Fahrt zu einer Arztpraxis nicht bewerkstelligen konnten.
Ihr Buch „Die Frauen und ihre Krankheiten“ bezeugt, dass sie schon damals erkannt hatte, dass sich weibliche und männliche Körper stark unterschieden und die Behandlungen daran angepasst werden sollten. Josephas Tochter wurde ebenfalls Ärztin.
Rita (Tommy) Thomas, queere Aktivistin in der DDR⬆ nach oben
Nina Roßmann
Die (Ost-)Berlinerin Rita Thomas, geboren 1931, nannte sich ‚Tommy‘ und verdiente ihr Geld als Hundefriseurin. Bekannt wurde sie aber vor allem als Gastgeberin queerer Partys im Osten Berlins. Außerdem fotografierte sie gerne. Ihre Fotos bezeugen den queeren Alltag in der DDR.
Von der jungen Tommy selbst gibt es auch ein Bild: Die Hände hat sie darauf fest in die Taschen ihrer dunklen Herrenhose gestemmt. Sie trägt ein weißes Hemd mit Weste, eine Fliege und darüber einen hellen Trenchcoat. Ihre Haare hat sie zu einer Art Elvis-Tolle frisiert und blickt, eine Zigarette im Mundwinkel, finster in die Kamera.
Seit ihrem 15. Lebensjahr trug Tommy Männerkleidung, ab 17 verdiente sie ihr eigenes Geld. Zunächst half sie auf Rummelplätzen aus, dann machte sie eine Ausbildung als Tierfriseurin. Ihre Liebe zu Frauen hat sie immer frei ausgelebt. Mit nicht einmal 20 Jahren lernte sie Helli D. kennen, mit der sie bis zu ihrem Lebensende 2018 zusammenblieb.
Gemeinsam mit Helli besuchte sie queere Lokale, die sich jedoch fast alle in Westberlin befanden. Mit dem Mauerbau 1961 war damit Schluss, also machte sie ihre eigene Wohnung in der Thaerstraße 42 in Friedrichshain zum Treffpunkt queeren Lebens.
In den 1970ern wurde Tommy Mitglied der Homosexuellen Interessengemeinschaft Berlin (HIB), der ersten Vereinigung queerer Personen in den damaligen Ostblock-Staaten. Die HIB traf sich in privaten Wohnungen zu Feiern, Vorträgen und Diskussionen. Die Fotos dieser Zeit kann man sich im Feministischen Archiv in Berlin ansehen.
Redaktion: Nina Roßmann, Bent Freiwald, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Gabriel Schäfer