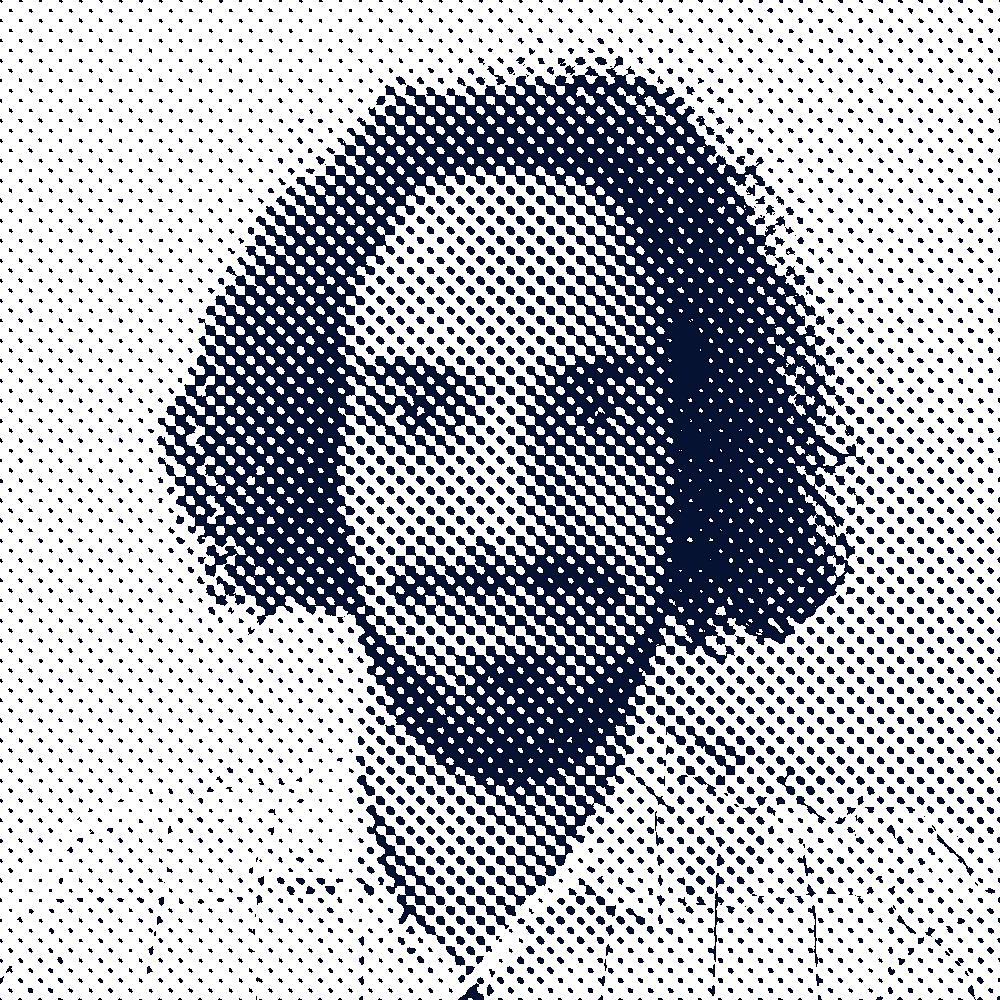Ob in Talkshows, Kommentarspalten oder in den eigenen vier Wänden: Schlechte Argumente sind allgegenwärtig.
Manchmal kommen sie als vermeintliche Aufforderung zum Selbstdenken daher. Dann heißt es etwa, „der gesunde Menschenverstand sagt doch, dass härtere Strafen zu weniger Verbrechen führen.“
Manchmal soll stattdessen ausdrücklich nicht selbst gedacht werden. Dann kann ein Argument auch so aussehen: „Fragen Sie nicht so viel. Die Ärzt:innen wissen schon, was das Beste für Sie ist.“
Beide Beispiele sind eigentlich logische Fehlschlüsse und damit schlechte Argumente. Der „gesunde Menschenverstand“ kann keine überprüfbaren Daten zur Korrelation zwischen Verbrechen und härteren Strafen liefern. Und auf einen Doktortitel zu verweisen kann eine nachvollziehbare Erklärung einer Diagnose nicht ersetzen.
Schlechte Argumente wie diese können dazu führen, dass eine Diskussion sich im Kreis dreht oder sogar in einen Streit mündet.
Doch es gibt eine gute Nachricht: Schon im antiken Griechenland haben Philosophen Strategien entwickelt, wie man Quatschargumente geschickt entkräftet. Die Ansätze von Sokrates, Aristoteles und Epiktet funktionieren heute noch und kommen ohne viel Faktenwissen aus.
Ein Allheilmittel gegen schlechte Argumente gibt es natürlich nicht, aber je nach Situation funktioniert eine dieser drei Strategien garantiert.
Die Sokrates-Strategie: Wohlwollend nachfragen⬆ nach oben
Mehrere KR-Mitglieder haben mir geschrieben, dass kritische Nachfragen ihr Mittel der Wahl gegen Quatschargumente sind. Andrea und Steffi zum Beispiel lassen sich Zusammenhänge und Details genauer erklären, fragen: „Wie meinst du das?“, oder: „Kann das stimmen?“ Diese Methode hat sich auch schon vor 2.500 Jahren bewährt. Sokrates nutzte sie häufig, wenn er die Athener auf der Straße in ein Gespräch verwickelte.
Einer davon war der Religionsexperte Euthyphron. Sokrates spricht mit ihm darüber, was Frömmigkeit ist. Euthyphron liefert ihm eine erste Definition: Fromm sei es, jemanden wegen Mordes anzuzeigen, selbst wenn es der eigene Vater ist (so wie Eutyphron es gerade selbst getan hat). Sokrates zeigt sich freundlich und wissbegierig. Er geht auf das Beispiel ein, gibt aber zu bedenken, dass dies noch keine allgemeingültige Definition sei.
Eutyphron versucht es noch einmal: „Fromm ist, was die Götter mögen.“ Sokrates wirft daraufhin ein, dass die Götter sich oft uneinig seien: Zeus könne gut finden, dass man seinen eigenen Vater anschwärzt, während Kronos es nicht gut fände.
Und so geht das Gespräch weiter. Sokrates bringt keine eigenen Argumente ein, sondern stellt nur Rückfragen. Er bringt Eutyphron im gemeinsamen Gespräch dazu, die Lücken und Widersprüche in seinen Gedanken selbst zu erkennen.
Diese Methode hat mehrere Vorteile. Sokrates lässt sein Gegenüber für sich selbst sprechen, es fühlt sich gesehen und ernst genommen. Gleichzeitig muss er argumentativ nicht in die Offensive gehen.
Funktionieren kann das aber nur, wenn die Gesprächspartner wohlwollend und gesprächsbereit sind. Stammt das Quatschargument von Vorgesetzten oder einer anderen Autorität, sind kritische Nachfragen oft nicht möglich. Auch die Situation muss stimmen: Eine Pressekonferenz bietet zum Beispiel weniger Raum für kritische Rückfragen als ein langes Interview.
Sokrates Methode war bahnbrechend, sollte ihm selbst aber zum Verhängnis werden. Er sprach mit Euthyphron über Frömmigkeit, weil ein Athener ihn vor dem Volksgericht angeklagt hatte, wegen Gottlosigkeit und weil er die Jugend verderbe. Das Gericht verurteilte ihn daraufhin zum Tod.
In seiner „Apologie“ erklärt Sokrates, was es mit der Anklage auf sich hat: Jugendliche nutzten seine Gesprächsmethode gern, um Leute auf der Straße ihres Irrtums zu überführen. Diese Leute wurden sauer, aber nicht auf die Jugendlichen, sondern auf Sokrates. Sie warfen ihm vor „dass er dem, was im Himmel und unter der Erde ist, nachtrachte, (an) keine Götter glaube und aus Schwarz Weiß mache.“ Anders gesagt: Sokrates stelle bestehende Gewissheiten auf den Kopf.
Die Aristoteles-Strategie: Mit Logik trumpfen⬆ nach oben
Aristoteles hat Quatschargumente systematisiert. In seinem Werk „Sophistische Widerlegungen“ sammelt er logische Fehlschlüsse, die immer wieder vorkommen. Das Perfide an diesen Denkfehlern ist, dass sie oft einleuchten, insbesondere, wenn man mit der vertretenen Position einverstanden ist. Aber auch ein sympathisches Argument ist nicht immer ein gutes.
Heute gibt es im Internet Listen mit Hunderten typischen Fehlschlüssen. Wer sie kennt, kann nicht nur populistische Politiker:innen oder Werbeversprechen besser entlarven, sondern wird auch selbst zum besseren Gesprächspartner. Wenn dir die häufigsten Fehlschlüsse schon ein Begriff sind, kannst du die folgende Aufzählung überspringen. Danach kommt aber noch ein Fehlschluss, den selbst Logik-Profis nicht immer auf dem Schirm haben.
-
Insbesondere Zahnpflegeprodukte, aber auch Eltern und Vorgesetzte appellieren gern **an die Autorität. „9 von 10 Zahnärzten empfehlen…“, heißt es dann, oder: „Weil ich es sage.“ Inhaltliche Argumente rücken in den Hintergrund, entscheidend ist nur die Autorität des Sprechenden.
-
In Werbung, Politik und Erziehung kommen oft auch Appelle an die Mehrheit oder den gesunden Menschenverstand vor. In einer Werbekampagne klingen die zum Beispiel so: „Deutschlands meistverkaufte Matratze“. Über die Qualität der Matratze sagt das nichts aus. Und wer mehr Wert auf gesunden Menschenverstand als auf Wissenschaft legt, könnte auch glauben, dass die Erde flach sei.
-
Verschwörungstheorien und Erklärungen medizinischer Zusammenhänge basieren oft auf Scheinkausalitäten. Zum Beispiel gibt es eine Korrelation zwischen Autismus-Diagnosen und MMR-Impfungen, da beides in der Regel im Kindesalter geschieht. Oder zwischen der Corona-Pandemie und dem 5G-Netz, dessen Ausbau kurz zuvor begann. Beide Korrelationen sind noch kein Beweis dafür, dass es kausale Zusammenhänge gibt.
-
Dammbruch-Argumente fallen oft dann, wenn es um Regeln und Gesetze geht. Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) warnte 2015 zum Beispiel davor, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen. Darauf könnten andere Forderungen folgen, etwa nach der Heirat unter engen Verwandten. Das war damals aber nicht im Gespräch.
-
In politischen Debatten und hitzigen Streits ist die Versuchung bisweilen groß, persönlich anzugreifen, statt inhaltlich zu argumentieren. Die Rede ist von Ad-hominem-Argumenten, wenn zum Beispiel Jette Nietzard (Die Grünen) auf X zum Kandidatur-Verzicht von Frauke Brosius-Gersdorf postet: „Wieder einmal geht eine Frau, wenn es ein Mann hätte sein sollen #SpahnRücktritt.“ Sie greift den CDU-Politiker Jens Spahn nicht auf Sachebene an, sondern aufgrund seines Geschlechts.
-
Falsche Dilemmata präsentieren nur zwei Optionen, obwohl es noch mehr gäbe. Zum Beispiel behauptete Jens Spahn bei „Markus Lanz“: „Entweder beendet die demokratische Mitte die illegale Migration, oder die illegale Migration beendet die demokratische Mitte.“ Auch der US-amerikanische Demokrat Bernie Sanders tritt auf X in diese Falle, wenn er fragt: „Werden Oligarchen weiterhin unsere Politik dominieren? Oder werden wir Amtsträger wählen, die an der Seite arbeitender Familien stehen?“
-
Schnelle, schlagfertige Argumente in Talkshows oder Wahlkämpfen sind häufig Strohmann-Fehlschlüsse. Sie unterstellen dem Gegenüber einen Standpunkt, den es gar nicht vertritt. Wie beispielsweise der FDP-Politiker Christian Lindner, als er behauptete, dass die Grünen „den Petrolheads das Auto nehmen wollen und Fleischliebhabern das Steak.“
Jetzt aber zu dem Fehlschluss, auf den selbst Logik-Profis reinfallen können:
Diskussionsfreudige Internet-User:innen kritisieren fehlerhafte Argumente gern, indem sie sie direkt beim Namen nennen. Sie werfen ihrem Gegenüber vor, einen Strohmann aufzustellen oder an die Mehrheit zu appellieren. Aber auch das ist ein Fehlschluss, der sogenannte Fehlschluss-Fehlschluss. Wer eine Aussage einfach als Quatschargument abstempelt, hat damit noch nicht bewiesen, dass die Position des Gegenübers tatsächlich falsch ist. Und ein Gesprächskiller ist der Fehlschluss-Fehlschluss noch dazu.
Wie also geht Aristoteles mit einem schlechten Argument um? Seine Strategie ist, sich nicht inhaltlich an Argumenten aufzuhängen und stattdessen zu zeigen (nicht nur zu benennen!), warum sie aus logischer Sicht ungültig sind.
Die Behauptung, dass Kritiker:innen von Überwachung etwas zu verbergen hätten, würde er beispielsweise als „Falsches Dilemma“ und „Ad-hominem-Angriff“ identifizieren. Er würde entgegnen: Das hat nichts mit den Kritiker:innen persönlich zu tun. Man kann gleichzeitig gegen Überwachung sein und trotzdem nichts zu verbergen haben. Es verschließen ja auch unschuldige Menschen ihre Wohnungstür.
Die Epiktet-Strategie: Keine Antwort ist auch eine Antwort⬆ nach oben
Seien wir ehrlich: Vor allem in politischen Debatten können Nachfragen und logische Argumente oft nichts ausrichten. Weiter zu diskutieren ist dann sinnlos und frustrierend. Außerdem fehlen bisweilen Energie und Nerven, um auf Quatschargumente einzugehen. Mehrere KR-Mitglieder haben mir geschrieben, dass es ihnen oft so geht.
Für diesen Fall hat Epiktets „Handbüchlein der stoischen Moral“ die richtige Strategie parat: nämlich einfach durch „Schweigen, Erröten und eine finstere Miene“ seine Missbilligung zu zeigen. Schweigen ist für Epiktet die beste Antwort, „wenn man unter Idiotēs [griech. Unwissenden] auf einen Satz aus der Wissenschaft zu sprechen kommt. Denn die Gefahr ist groß, dass du sonst sofort wieder ausspeist, was du noch nicht verdaut hast.“
Epiktets Methode ist alles andere als eine Kapitulation. Im Gegenteil, er fordert uns auf zu handeln, anstatt uns redend im Kreis zu drehen: „Auch die Schafe zeigen den Hirten nicht, wie viel sie gefressen haben, indem sie ihnen das Futter zurückbringen. Sie verdauen innen ihre Nahrung und liefern dann nach außen Wolle und Milch. So stelle auch du vor Ungebildeten nicht die philosophischen Lehrsätze zur Schau, sondern lass sie deren Wirkungen sehen, nachdem du sie verarbeitet hast.“
Anders gesagt bringt es laut Epiktet wenig, seine guten Argumente in Gesprächen zur Schau zu stellen. Wirkungsvoller ist es, sein Wissen im eigenen Verhalten sichtbar werden zu lassen. Auf die heutige Zeit angewendet könnte das heißen: Wer Artikel über Demokratie und Zivilcourage in den sozialen Medien postet, „zeigt nur das Futter.“ Wer aber bei politischen Initiativen mitmacht, bei rassistischen Beleidigungen im Bus Haltung zeigt oder wählen geht, „liefert Wolle und Milch.“
Epiktet lehrt uns, dass Demokratie gar nicht von Debatte lebt, sondern vor allem von aktiven Handlungen. Knapp 2.000 Jahre später ist die Schriftstellerin Sarah Stein Lubrano in ihrem Buch „Don’t Talk About Politics“ zu einem ähnlichen Schluss gekommen. Theresa Bäuerlein hat es hier besprochen.
Vielen Dank an die KR-Mitglieder Ina, Ryek, Steffi, Günter, Susanne, Teresa, Andrea und Juris für euren Input zum Thema!
Redaktion: Nina Rossmann, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert