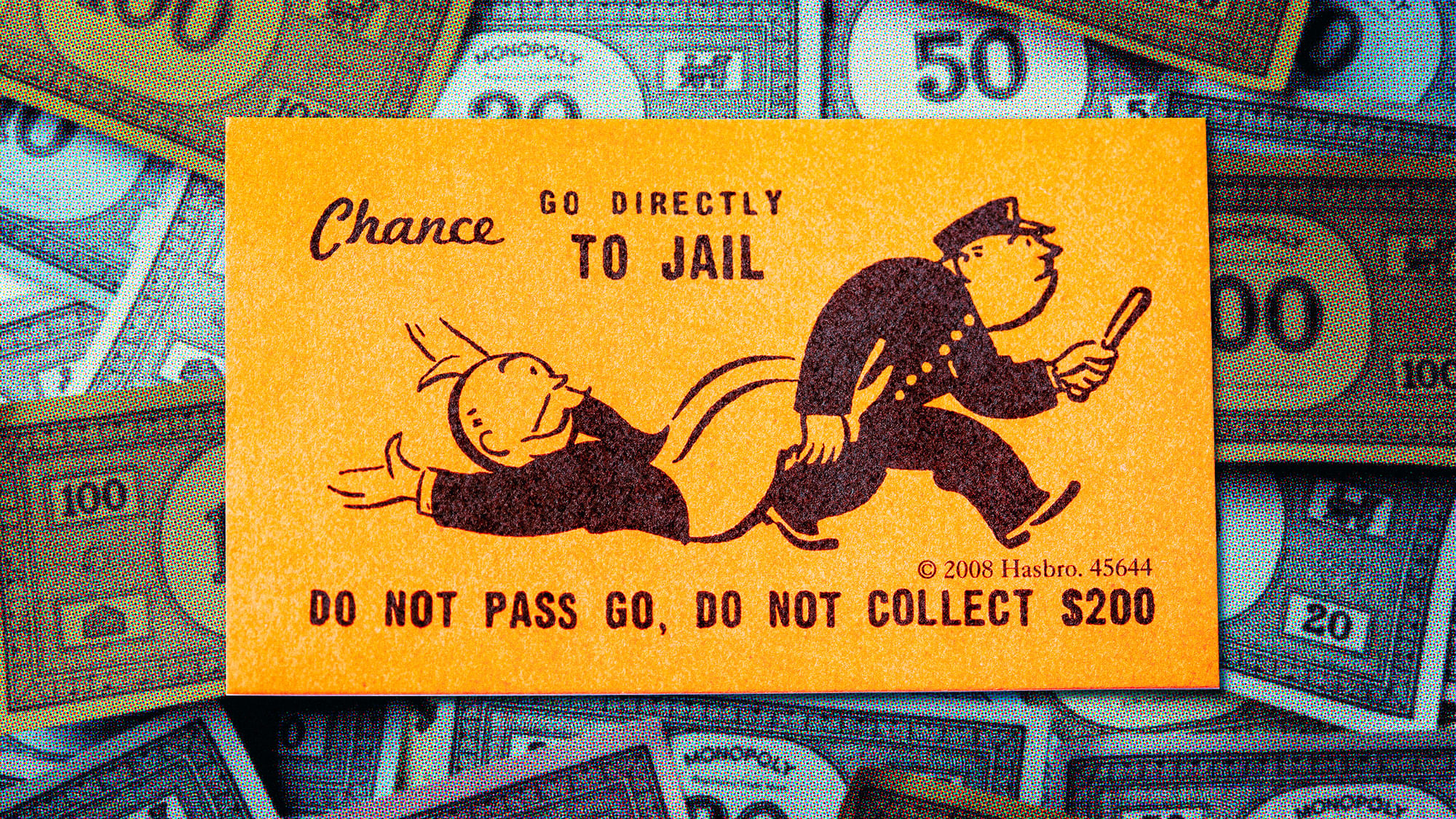Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gab es vor allem bei digitalen Unterhaltungsformen ein rasantes Wachstum. Videospiele, Streaming-Dienste und Podcasts sind inzwischen ein wichtiger Teil unserer Freizeit. Aber ein analoges Produkt, dessen Wurzeln bis zu den Anfängen der menschlichen Zivilisation zurückreichen, hat ein fulminantes Comeback erlebt: das Brettspiel.
Obwohl Brettspiele seit Jahrhunderten beliebt sind, gehören die im 20. Jahrhundert entstandenen Klassiker – etwa Risiko, Trivial Pursuit und Monopoly – wohl zu den bekanntesten.
Aber abgesehen davon, dass sie Klassiker sind: Was macht ein Brettspiel „modern”? Die Antwort kommt aus Europa, genauer gesagt aus Deutschland, wo Eurogames oder Brettspiele im „Euro-Stil” Ende des 20. Jahrhunderts entstanden. Das Spiel Catan aus dem Jahr 1995 war der erste große Erfolg in diesem Genre.
Gesellschaftsspiele haben sich in den vergangenen Jahrzehnten rapide weiterentwickelt⬆ nach oben
Anders als ältere Spiele, die oft nur ein einziges Ziel hatten, gewinnt man bei Eurogames durch die geschickte Kombination verschiedener Spielmechanismen. Spieler scheiden dabei nie aus und behalten immer eine Chance auf den Sieg. Auch der Zufall spielt kaum eine Rolle – entscheidend sind die klugen Entscheidungen der Spieler.
Seit dem Erfolg von Catan haben Eurogames Brettspiele so stark verändert, dass wir Elemente davon in fast jedem modernen Brettspiel finden können.
Spiele sind mehr als bloßer Zeitvertreib, sie sprechen einen sehr wichtigen Teil unseres Gehirns an, wie der Philosoph Johan Huizinga in seinem Buch „Homo ludens“ argumentierte. Laut Huizinga ist das Interesse am Spiel das, was die menschliche Existenz ausmacht – jede Kultur entsteht aus diesem Interesse.
Wir können diesen Gedanken durch eine evolutionsbiologische Betrachtung ergänzen: Lernen ist für den Menschen elementar und spielen ist die effektivste Art zu lernen. Jedes Spiel kann als potenzielles Lernwerkzeug gelten – denn um zu gewinnen, müssen wir zunächst seine Regeln und Ziele verstehen und dieses Wissen dann gezielt in unsere Entscheidungen und Strategien einfließen lassen.
Aber es lohnt sich auch, zu fragen, was wir durch Spiele lernen, die sich mit der Wirtschaft beschäftigen, einem beliebten Thema in Klassikern wie Monopoly, aber auch in modernen Spielen wie Catan.
Bei Monopoly entscheidet Glück, wer gewinnt⬆ nach oben
Monopoly in seiner heutigen Form erschien in den 1930er-Jahren bei Parker Brothers. Es war – um es vorsichtig zu sagen – stark inspiriert von The Landlord’s Game, einem Brettspiel der feministischen Autorin Elizabeth Magie aus dem frühen 20. Jahrhundert.
Magies Ziel war in erster Linie pädagogisch: Das Spiel sollte die gravierenden Probleme verdeutlichen, die durch die Konzentration von Eigentum in wenigen Händen entstehen – Probleme, die staatliches Eingreifen zur Regulierung des Immobilienmarktes notwendig machten.
Jeder, der Monopoly gespielt hat, weiß aber: Aus dieser Idee wurde ein Unterhaltungsprodukt, in dem die Spieler durch spekulativen Grundstückskauf reich zu werden versuchen. Wer am Ende gewinnt, hängt weniger von ökonomischem Geschick ab als vielmehr vom Zufall.
Bei Catan entwickelt sich eine kleine Marktwirtschaft⬆ nach oben
Demgegenüber steht „Die Siedler von Catan“. Wie jedes gute Eurogame lebt es davon, dass mehrere Spielmechanismen ineinandergreifen. Den Anfang macht die Geografie: Die Startpositionen entscheiden, welche Ressourcen im Überfluss vorhanden sind und welche Spieler direkten Zugang zu ihnen haben.
Weil niemand alle Ressourcen kontrollieren kann, bildet sich ein Markt. Dort handeln die Spieler um die Ressourcen, die ihnen fehlen. Wie viel verfügbar ist, schwankt je nach Angebot (durch Geografie und Würfelglück bestimmt) und Nachfrage (den Bedürfnissen der Spieler).
Wer in Catan erfolgreich sein will, braucht Verhandlungsgeschick und gute Planung. Zu Beginn wollen alle Holz und Lehm haben, um Straßen und Dörfer zu bauen. Doch sobald die Spieler ihre Dörfer zu Städten ausbauen möchten, steigen die Preise von Erz und Weizen.
Weil es verschiedene Wege zum Sieg gibt, bauen manche so viele Städte wie möglich, während andere lieber Entwicklungskarten kaufen. Selbst Spieler, die punktemäßig hinten liegen, können noch aufholen, wenn sie die längste Straße bauen oder Zugang zu einem Hafen erhalten, der Handel ermöglicht.
Monopoly und Catan markieren zwei unterschiedliche Epochen des Brettspiels. Catan steht dabei für ein ausgereifteres Design, das aus Jahrzehnten von Innovation hervorgegangen ist.
Wie jedes Kulturprodukt spiegeln Spiele die Gesellschaft, aus der sie stammen, und sie lehren uns auf ihre Weise, welche Wege zum Erfolg führen, zumindest im Mikrokosmos des Spiels.
Und sie sind längst nicht die einzigen. Jedes Jahr erscheinen Tausende neuer Brettspiele, deren thematische und spielmechanische Vielfalt exponentiell gewachsen ist, seitdem vor 25 Jahren Catan veröffentlicht wurde. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: In Brass: Birmingham lässt sich die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts nachspielen, in Terraforming Mars eine grüne Ökonomie auf einem fremden Planeten aufbauen – oder in Hegemony sogar eine Arbeiterrevolution des 21. Jahrhunderts anführen.
Spiele können Spaß machen. Doch die Frage bleibt, ob sie uns tatsächlich dabei helfen können, reale Herausforderungen wie Immobilienspekulation, soziale Ungleichheit oder die Klimakrise zu überwinden.
Die Antwort ist komplex. Spiele haben das Potenzial, unsere Sicht auf die Welt zu verändern, doch nicht alle vermitteln gleichermaßen nützliches oder allgemeingültiges Wissen. Damit Spiele wirklich zu Lernwerkzeugen werden, brauchen wir die Fähigkeit, Erfahrungen aus dem Spiel kritisch auf die Wirklichkeit zu übertragen.
Leider ist das leichter gesagt als getan. Im wirklichen Leben sind Regeln und Ziele viel vager als auf dem Spielbrett. Und manchmal müssen wir Spiele spielen, obwohl wir genau wissen, dass die Würfel nicht zu unseren Gunsten fallen.
Xavier Rubio-Campillo ist Leiter der Forschungsgruppe DIDPATRI (Didaktik & Kulturerbe) an der Universität Barcelona. Ursprünglich hat er Information studiert und das ich mit einer Promotion in Didaktik der Sozialwissenschaften und des Kulturerbes an der Universität Barcelona ergänzt.
Sein transdisziplinäres Profil verbindet Informatik und Geisteswissenschaften mit dem Ziel, zu erforschen, wie neue digitale Methoden eine kritische Perspektive auf die Vergangenheit und ihre Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft fördern können.
Dieser Artikel ist zuerst auf Englisch bei The Conversation erschienen. Hier könnt ihr den Originalartikel lesen.
Übersetzung: Rebecca Kelber, Redaktion: Isolde Ruhdorfer, Schlussredaktion: Rico Grimm, Fotoredaktion: Philipp Sipos