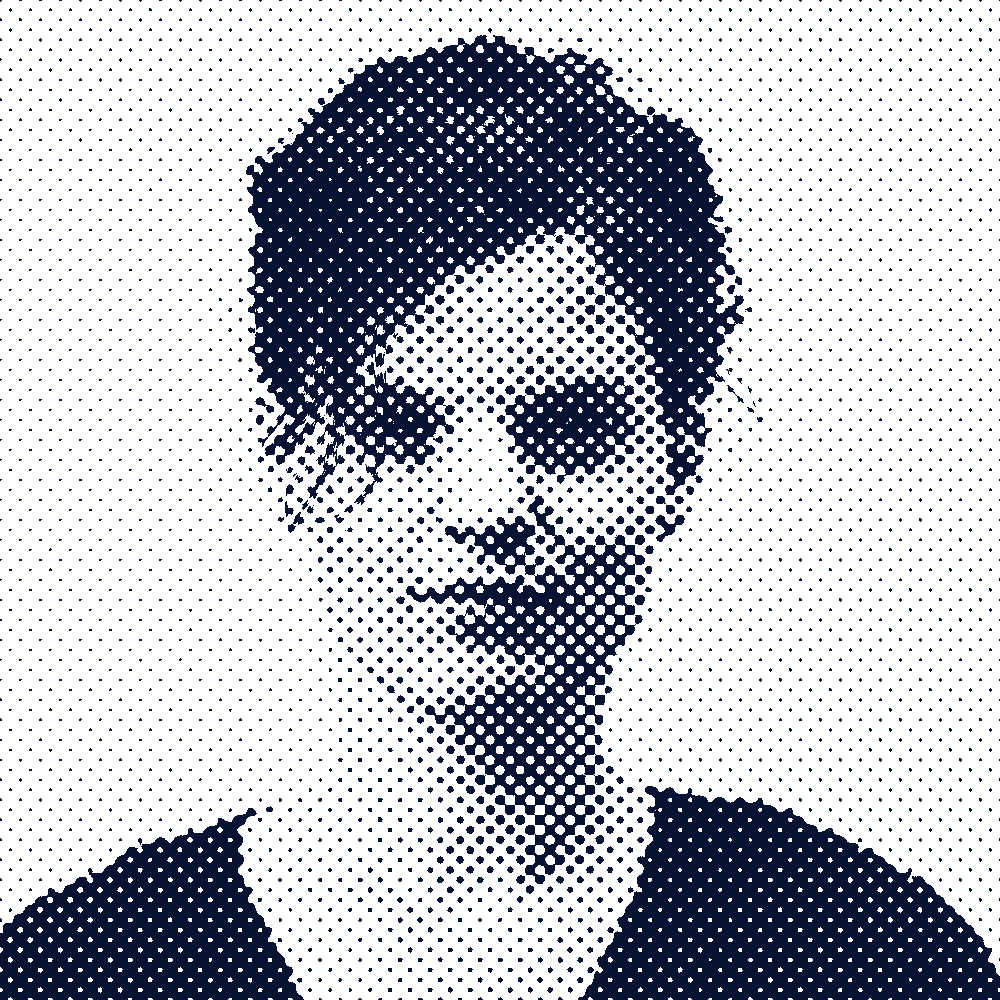Frau Hendriksen, in ihrem Buch „How To Be Enough“ schreiben sie, dass viele Menschen Perfektionist:innen sind, das aber selbst nicht merken. Wie ist Ihnen das aufgefallen?
Ich arbeite in einer Klinik, die auf Angststörungen spezialisiert ist. Schon zu Beginn meiner Tätigkeit fiel mir etwas Interessantes auf: Bei den meisten meiner Klient:innen stand Perfektionismus im Zentrum ihrer Probleme. Doch niemand sagt beim ersten Gespräch: „Ich bin Perfektionist, bei mir muss alles perfekt sein.“ Stattdessen höre ich Sätze wie: „Ich fühle mich ständig wie ein Versager“, oder „Ich komme einfach nicht voran im Leben.“
Mit der Zeit wurde mir klar, dass es sich nicht um Einzelfälle handelte, sondern um eine stille Epidemie. Perfektionismus betrifft erstaunlich viele Menschen, ohne dass sie es selbst erkennen.
Als ich Ihr Buch das erste Mal in der Hand hatte, dachte ich: „Das hat mit mir nichts zu tun. Ich bin viel zu chaotisch, um perfektionistisch zu sein.“ Ich lag falsch.
Das ist ein typisches Missverständnis. Perfektionismus ist eigentlich ein irreführender Begriff, denn im Kern geht es darum, sich nie gut genug zu fühlen. Menschen mit Perfektionismus sind nicht in allen Lebensbereichen perfektionistisch. Ich neige zum Beispiel dazu, bei meiner Arbeit und meinem sozialen Verhalten perfektionistisch zu sein. Aber nicht, was die Unordnung in meiner Wohnung oder meinen Kleiderschrank angeht.
Was viele Menschen nicht wissen: Perfektionismus hat eigentlich einen positiven Kern. Er wurzelt in Gewissenhaftigkeit, in unserem Gespür für richtig und falsch. Gewissenhaftigkeit ist an sich konstruktiv, macht uns zuverlässig, sorgfältig, produktiv. Als Persönlichkeitseigenschaft ist das ziemlich nützlich.
Aber Gewissenhaftigkeit kippt in Perfektionismus um, wenn wir beginnen, unsere Leistung mit unserem Wert als Mensch gleichzusetzen. Man nennt das „Überbewertung“.
Wir beginnen dann, unseren Wert als Mensch an äußeren Maßstäben zu messen: Spitzenleistungen in Schule und Beruf, das vermeintlich „richtige“ Gewicht, ein souveränes Auftreten, ein tadellos gepflegtes Zuhause. Plötzlich sind das nicht mehr einfach Wünsche oder Ziele, sondern Bedingungen für unser Selbstwertgefühl. Genau da fängt ungesunder Perfektionismus an.
Kommt mir bekannt vor. Wie können wir es schaffen, mit uns selbst weniger hart ins Gericht zu gehen?
Mir persönlich hat am meisten geholfen zu begreifen, dass manche Gehirne einfach darauf programmiert sind, selbstkritischer zu denken – ähnlich wie manche Menschen optimistischer oder pessimistischer, introvertierter oder extrovertierter sind. Mein Gehirn produziert vielleicht besonders viele selbstkritische Gedanken, aber das macht sie nicht automatisch wahr. Ich muss nicht darauf reagieren. Es kann helfen, diese Gedanken wie eine Hintergrundmusik in einem Café wahrzunehmen, die ich zwar höre, die mir aber nicht unbedingt wichtig sein muss.
Ich bemerke meine selbstkritischen Gedanken vor allem in Situationen mit anderen Menschen. Wenn meine Wohnung unordentlich ist, fühle ich mich regelrecht beobachtet und bewertet – sogar, wenn ich ganz allein bin. Wie hängt dieses seltsame Gefühl mit Perfektionismus zusammen?
Soziale Angst und Perfektionismus sind wie Geschwister. Beide wurzeln in derselben fehlerhaften Selbstwahrnehmung – einem Gefühl der Unzulänglichkeit, das uns von anderen trennt. In beiden Fällen tun wir viel, um Situationen zu vermeiden, in denen diese empfundene Unzulänglichkeit sichtbar werden könnte.
Interessant ist, wie unterschiedlich das aussehen kann: Bei sozialer Angst neigen wir eher dazu, wenig oder gar nichts zu tun. Wir sagen Treffen ab oder stehen bei einer Party schweigend am Rand. Perfektionismus dagegen treibt uns häufig zur Überkompensation: Wir arbeiten zu viel, bereiten uns bis ins kleinste Detail vor, erscheinen overdressed auf der Party oder verhalten uns übermäßig freundlich. Doch letztlich verstecken beide Strategien dasselbe tieferliegende Gefühl: nie wirklich gut genug zu sein.

Ellen Hendriksen
ist klinische Psychologin und Mitglied des Forschungsteams am Center for Anxiety and Related Disorders (CARD) der Boston University. Sie absolvierte ihre klinische Ausbildung an der Harvard Medical School.
Hendriksen beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Angststörungen, Perfektionismus und dem inneren Kritiker. Sie ist Autorin der Bücher „How to Be Enough“ und „How to Be Yourself“, in denen sie wissenschaftlich fundierte Ansätze zur Selbstakzeptanz und zum Umgang mit sozialer Angst aufgreift.
Ich wollte kürzlich jemandem erklären, dass People-Pleasing eigentlich eine Strategie ist, um zu kontrollieren, wie andere uns wahrnehmen. Er reagierte verblüfft und leicht genervt: „Moment mal, jetzt darf ich nicht einmal mehr nett sein, ohne egoistisch zu sein?“
Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen echter Nettigkeit und Nettigkeit, die darauf abzielt, die Wahrnehmung anderer zu steuern. People-Pleasing gibt sich oft als Rücksichtnahme aus, ist aber tief im Kern Kontrollverhalten. Wir machen unser Selbstwertgefühl von den Reaktionen anderer abhängig und geraten so schnell in eine anstrengende Spirale ständiger Anpassung und unterdrückter Bedürfnisse.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass manche Menschen aus Perfektionismus ständig aktiv und produktiv sind, während andere eher Dinge aufschieben. Kann es also sein, dass jemand, der dauernd Aufgaben vermeidet, eigentlich ein heimlicher Perfektionist ist?
Absolut. Perfektionismus ist oft ein Alles-oder-nichts-Phänomen. Einerseits können wir alle Register ziehen, wirklich hart arbeiten und alles schaffen. Oder wir haben sehr hohe und strenge Maßstäbe, glauben aber gleichzeitig, dass wir sie nicht erfüllen können. Also legen wir die Hände in den Schoß und sagen: „Warum es überhaupt versuchen?“
Ein Beispiel: Wir beide könnten dieselbe Vorstellung von einem perfekt sauberen Haus haben. Sie arbeiten hart daran, den Standard zu erreichen, ich dagegen kapituliere und lebe im Chaos. Beide Strategien sind Ausdruck desselben Problems: Perfektionismus.
Woran merke ich, dass ich meine Leistung und mein Selbstwertgefühl in einen Topf werfe?
Stellen Sie sich einen Schüler vor, der unbedingt eine Eins erreichen will und das Ziel knapp verpasst. Ein gewissenhafter Mensch denkt vielleicht enttäuscht: „Schade, das hätte besser laufen können.“ Ein Perfektionist dagegen denkt sofort: „Ich bin unfähig.“ In diesem Moment wird das Scheitern unmittelbar mit persönlichem Versagen gleichgesetzt. Man denkt nicht bloß: „Ich habe versagt“, sondern: „Ich bin ein Versager.“
Genau hier liegt der Unterschied zwischen gesundem Bedauern („Ich habe schlecht abgeschnitten“) und schädlicher Selbstverurteilung („Ich bin schlecht“).
Ich würde gerne jemand sein, der Rückschläge nicht persönlich nimmt. Aber in einer Welt, in der wir ständig mit den perfekten Leben anderer online konfrontiert werden, fällt mir das schwer.
Das geht nicht nur Ihnen so. Tatsächlich zeigen etliche Studien, dass Perfektionismus zunimmt.
Aus meiner Sicht spielen hier zwei Dinge eine besondere Rolle. Erstens hat Perfektionismus genetische Ursachen und entwickelt sich durch frühe Erfahrungen und familiäre Prägungen weiter. Doch er wird auch entscheidend von unserer Kultur verstärkt.
Der britische Forscher Andrew Hill spricht in seiner Arbeit von einem sogenannten „perfektionistischen Klima“. Früher beobachtete er das vor allem im Leistungssport oder wenn Musiker:innen für wichtige Orchester vorspielten. Heute jedoch greift diese Atmosphäre auf viele weitere Lebensbereiche über, auf soziale Medien, universitäre Eliten, in den USA sogar auf den Kindersport.
Und das führt zum zweiten Punkt: Perfektionismus nimmt im Laufe der Zeit tatsächlich zu. Hill und sein Kollege Thomas Curran haben in einer großangelegten Studie (PDF) Daten aus über 27 Jahren ausgewertet und festgestellt, dass eine bestimmte Art von Perfektionismus, der sozial vorgeschriebene Perfektionismus, exponentiell gestiegen ist. Also der Druck, von anderen gestellte Erwartungen erfüllen zu müssen und harte Kritik zu fürchten, wenn uns das nicht gelingt.
Heutzutage ist ja fast alles, was man tut, mit Bewertungen und Rankings verbunden. Selbst beim Kauf einer Zahnbürste schaue ich mir erstmal die Bewertungen an.
Genau das beschreibt unsere heutige Realität. Jeder Aspekt unseres Lebens ist quantifizierbar geworden: Likes und Follower in den sozialen Medien, Bewertungen und Rankings. Wenn Anerkennung sich in Zahlen messen lässt, wird alles zu einem Wettbewerb. Wir wollen nicht nur gute Leistungen, sondern vor allem besser sein als andere.
In Ihrem Buch fordern Sie dazu auf, sich an persönlichen Werten statt an Zahlen zu orientieren. Aber das ist ziemlich schwierig, wenn immer alles gemessen wird. Nachdem dieses Interview veröffentlicht ist, werde ich natürlich schauen, wie viele Menschen es lesen und wie viele es in den sozialen Medien liken werden …
(lacht) Klar, ich überprüfe auch die Verkaufszahlen meiner eigenen Bücher. Kürzlich wurde in einer Populace/Gallup-Umfrage untersucht, was Menschen unter Erfolg verstehen. 97 Prozent definierten Erfolg so: Sie wollen ihren Interessen und Talenten folgen und gut darin werden. Gleichzeitig glaubten aber 92 Prozent, dass die meisten anderen Menschen Erfolg ausschließlich an Reichtum, Prestige und Berühmtheit messen.
Diese Differenz zeigt, wie tief Perfektionismus in unserer Kultur verankert ist. Die meisten von uns behaupten, nach inneren Werten und persönlichem Wachstum zu leben, glauben aber gleichzeitig, dass alle anderen sich nur um äußeren Erfolg sorgen. Wenn wir denken, dass uns Menschen umgeben, denen es nur auf Geld oder Status ankommt, dann wird es umso schwieriger, den eigenen Werten treu zu bleiben.
Sie sprechen hier auch aus eigener Erfahrung, oder?
Oh ja, absolut. Es ist interessant, wie stark mein persönlicher Weg sich mit meiner klinischen Arbeit verbunden hat. Einen Großteil meines Lebens habe ich selbst sehr stark darunter gelitten, dass ich mein Selbstwertgefühl zu sehr von meinen Leistungen abhängig gemacht habe. Wie gut meine Noten waren, wie viele soziale Kontakte ich im Studium hatte oder wie produktiv ich später in meinem Beruf war. Mein erstes Buch über soziale Ängste war das Buch, das ich vor zwanzig Jahren selbst gebraucht hätte. Und jetzt ist mein Buch über Perfektionismus genau das, was ich heute brauche. Dieses Buch hat mir geholfen, Muster bei mir selbst besser zu erkennen und damit auch eine bessere Therapeutin zu werden.
In Ihrem Buch sprechen Sie über sogenannte innere Regeln – diese oft unsichtbaren Überzeugungen, was wir tun oder lassen müssen, um uns okay zu fühlen. Zum Beispiel die Regel, dass wir uns nie in Gesprächen unwohl fühlen dürfen. Viele merken sogar, dass solche Regeln sie stressen oder behindern, trotzdem fällt es ihnen unglaublich schwer, sie abzuschütteln. Warum eigentlich?
Regeln erfüllen eine wichtige psychologische Funktion: Sie reduzieren Unsicherheit. Weil Angst vor allem durch Ungewissheit ausgelöst wird, funktionieren starre Regeln wie eine Art Sicherheitsnetz. Wenn wir unsere Regeln exakt einhalten, ganz gleich ob beim Essen, bei der Arbeit oder bei sozialen Interaktionen, fühlen wir uns kontrollierter und sicherer.
Genau darum fällt es meinen Klienten oft so schwer, ihre Regeln loszulassen oder wenigstens etwas flexibler zu gestalten. Für sie fühlt es sich dann an, als sollten sie ihre Ansprüche verringern, und das erscheint gefährlich. Dabei empfehle ich gar nicht, dass sie ihre Regeln komplett aufgeben sollten. Es geht eher darum zu prüfen, ob eine Regel im konkreten Kontext noch sinnvoll ist. Wie wäre es zum Beispiel, wenn ich mir erlaubte, mich in 15 Prozent meiner Gespräche mal etwas unwohl zu fühlen?
Wenn unsere perfektionistischen Leser:innen nur einen Gedanken aus diesem Gespräch im Kopf behalten – welcher sollte das sein?
Die üblichen Ratschläge lauten ja oft: „Senke deine Ansprüche“, oder „Sei zufrieden, wenn es gut genug ist.“ Aber die hohen Ansprüche sind eigentlich nicht das Problem. Im Gegenteil: Greifen Sie ruhig weiter nach den Sternen! Setzen Sie sich anspruchsvolle Ziele. Gleichzeitig aber: Machen Sie Frieden mit Fehlern, Unvollkommenheiten und gelegentlicher Unsicherheit – nicht weil Sie schwach oder unzulänglich sind, sondern einfach, weil genau das zum Menschsein dazugehört. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Anspruch und Akzeptanz macht doch ein erfüllendes Leben aus.
Redaktion: Nina Roßmann, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert und Iris Hochberger