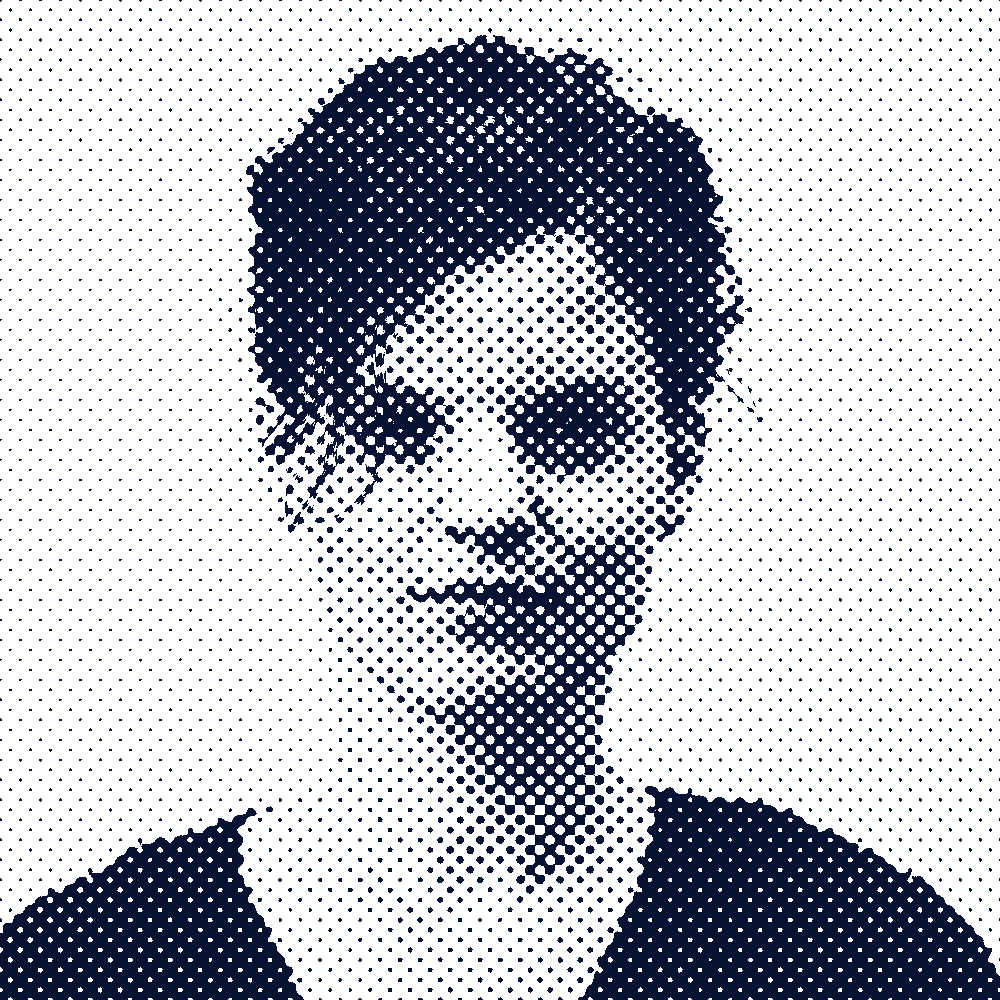Viele gehen davon aus, dass Frauen besonders empathisch sind – so selbstverständlich wie sie erwarten, dass Kaffee wach macht.
Manche, wie der reichste Mann der Welt, Elon Musk, halten Empathie für „die grundlegende Schwäche der westlichen Zivilisation“. Andere feiern sie als Schlüsselkompetenz der Zukunft, die wir brauchen, um gegen KI zu bestehen. Aber kaum jemand zweifelt daran, dass Empathie „typisch weiblich“ ist. Ich habe das auch geglaubt. Nickte innerlich zustimmend, wenn auf Social Media von Männern die Rede war, die Gefühle einfach nicht kapieren, weil sie Empathie halt nicht ganz so gut können. Ist doch allgemein bekannt, oder? Die Idee ist jahrhundertealt. Forschung scheint sie immer wieder zu bestätigen.
Dann aber las ich drei Studien, die mir gezeigt haben, dass ich mir die Welt zu einfach gemacht hatte. Empathie ist keine feste Größe, kein angeborener Chip, der bei Frauen standardmäßig leistungsfähiger ist als bei Männern. Wie stark Menschen in Empathietests abschneiden, ist nämlich nicht nur eine Frage von Veranlagung oder Erziehung. Sondern auch davon, wie empathisch wir überhaupt sein wollen. Geld, Sex und Ego können beeinflussen, wie gut wir uns in andere einfühlen.
Was, wenn Empathie sexy macht?⬆ nach oben
Die Psychologen Geoff Thomas und Gregory Maio hatten für die erste Studie, die ich gelesen habe, eine ziemlich gute Idee. Sie vermuteten: Vielleicht sind Männer ja gar nicht weniger empathisch. Vielleicht fehlt ihnen einfach nur der richtige Grund, diese Fähigkeit zu zeigen. Um das zu testen, zeigten sie Studierenden Videos von Paaren, die Beziehungsprobleme diskutierten. Die Teilnehmenden sollten die Gedanken und Gefühle der gezeigten Personen erraten. Doch bevor es losging, spielten die Forscher mit den Erwartungen ihrer Proband:innen.
Sie teilten die Teilnehmenden in Männer und Frauen auf. Den Frauen gaben sie einen Text, in dem stand, dass für Erfolg im Leben emotionale Intelligenz sehr wichtig sei. Die meisten Leute würden denken, dass Frauen emotional intelligenter seien. Neue Forschungen würden aber Zweifel daran wecken.
Die Forschenden nahmen an, dass dieser Text die Teilnehmerinnen motivieren würde, ihre emotionale Intelligenz zu zeigen. Eine Kontrollgruppe von Studentinnen bekam stattdessen einen Text vorgesetzt, der die eigentliche Aufgabe als eine Art statistische Analyse darstellte, statt sie mit typisch weiblichen Geschlechterrollen zu verbinden. Es klappte: In dem folgenden Empathietest schnitten die Frauen besser ab, die den ersten Text gelesen hatten. Als wollten sie beweisen, dass Frauen eben doch besonders emotional intelligent waren.
Das zweite Experiment konzentrierte sich auf Männer. Hier wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen unterteilt. Einer Gruppe wurde gesagt, Männer seien generell unempathisch. Der anderen Gruppe hingegen vermittelten die Forschenden, dass empathische Männer attraktiver und sexuell anziehender für Frauen seien. Was dann passierte, ist lustig und aufschlussreich: Plötzlich entwickelten die Teilnehmer der zweiten Gruppe einen völlig anderen Blick auf die Menschen, deren Gefühle sie verstehen sollten. Sie analysierten genauer, zogen verschiedene Erklärungen in Betracht, dachten tiefer über die Gefühlswelt der anderen nach. Die Wissenschaftler schlossen aus ihren Experimenten, dass sowohl Männer als auch Frauen empathischer werden – wenn man sie richtig motiviert.
Was, wenn man Empathie einfach anders nennt?⬆ nach oben
Die zweite Studie, die ich mir angesehen habe, ist von 2021. Sie zeigt, wie wichtig Sprache ist. Die Forscherinnen Charlotte Löffler und Tobias Greitemeyer hatten eine clevere Idee: Was passiert eigentlich, wenn wir Empathie einfach anders nennen?
Sie nutzten den „Eyes-Test“, das heißt eine Reihe von Fotos, die nur die Augenpartien von Menschen zeigen. Die Aufgabe klingt einfach: Erkenne die Emotion in den Augen. Ist die Person verspielt, besorgt, genervt oder gelangweilt? Der clevere Teil: Die Forscher kündigten den gleichen Test verschiedenen Gruppen unterschiedlich an. Einmal als Test der „empathischen Fähigkeit“, einmal als Test der „sozial-analytischen Fähigkeit“.
Die Forschenden wussten, dass viele Menschen „Empathie“ automatisch mit „Frauen“ verbinden. Sie dachten, dass dieses „weibliche“ Etikett Männer abschrecken könnte. Ihre Hypothese war: Wenn sie den Test als „sozial-analytische Fähigkeit“ bezeichnen (ein neutraler, technischer klingender Begriff), würde dieser Abschreckungseffekt für Männer wegfallen oder zumindest geringer ausfallen.
Das Ergebnis verblüffte die Forschenden: Als der Test als „sozial-analytische Fähigkeit“ angekündigt wurde, verringerten sich die Geschlechterunterschiede nicht, sondern wurden sogar deutlicher. Und zwar bei den Frauen. Sie schätzten ihre Fähigkeiten nicht nur höher ein, sondern schnitten auch tatsächlich besser ab. Ein Wortspiel reichte aus, um die Leistung zu verändern. Bei den Männern änderte die geänderte Formulierung nichts.
In einer weiteren Versuchsreihe testeten die Forscher noch etwas anderes: Sie erklärten allen Teilnehmer:innen, wie wichtig Empathie für erfolgreiche Beziehungen und ein gelungenes Leben sei. Jetzt schätzten sich Frauen im Vergleich zu Männern als noch viel empathischer ein. Doch beim tatsächlichen objektiven Test (bei dem sie anhand von Augenpaaren einschätzen sollten, wie Menschen sich fühlten) schnitten sie nicht besser ab. Das zeigt: Nicht jeder Motivationsschub führt automatisch zur Steigerung der tatsächlichen Leistung. Manchmal beeinflusst er eben nur, wie wir uns selbst einschätzen. Es kommt stark darauf an, wie motiviert wird. Das zeigt extrem die dritte Studie, die ich mir angesehen habe.
Was, wenn Empathie sich auszahlt?⬆ nach oben
Diese Studie ist vielleicht die ernüchterndste von allen. Sie zeigt, was passiert, wenn man den ultimativen Motivator ins Spiel bringt: Geld.
Die Psychologinnen Kristy Klein und Sara Hodges wollten es genau wissen. Sie ließen College-Studierende Videos von Menschen anschauen, die über ihre persönlichen Probleme sprachen. Die Aufgabe war die gleiche wie in den anderen Studien: Erkennt, was die Menschen wirklich denken und fühlen.
Zuerst lief alles wie gewohnt. Die Teilnehmerinnen schätzten die Gefühle der Menschen ein, die Teilnehmer auch. Dann kam der entscheidende Moment: Die Forscherinnen legten Geld auf den Tisch. Für besonders präzise Einschätzungen gab es eine Belohnung.
Was dann geschah, war bemerkenswert. Als es ums Geld ging, verbesserte sich die Leistung sowohl bei Männern als auch bei Frauen signifikant. Mehr noch: Die viel zitierte weibliche Überlegenheit in Sachen Empathie verschwand. Als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Sobald Geld im Spiel war, waren Männer und Frauen plötzlich gleich gut darin, die Gedanken und Gefühle anderer zu erkennen.
All die scheinbar naturgegebenen Unterschiede, die jahrhundertealten Annahmen über die empathischen Fähigkeiten von Männern und Frauen – sie waren auf einmal nicht mehr so wichtig, sobald der richtige Anreiz da war.
Und wenn Frauen trotz allem doch empathischer sind?⬆ nach oben
Natürlich sollte man diese drei experimentellen Studien mit studentischen Teilnehmenden nicht überbewerten. Ihnen gegenüber steht etwa eine riesige Studie von 2023, bei der mehr als 300.000 Menschen aus 57 Ländern den „Eyes-Test“ machten, bei dem sie aus Fotos der Augenpartien von Menschen deren Gefühlszustände ablesen sollten.
Das Ergebnis war eindeutig: In allen untersuchten Ländern, über alle Altersgruppen hinweg (von 10 bis über 70 Jahre), waren Frauen im Durchschnitt besser darin, die Emotionen in den Augen zu lesen.
Das heißt: Wenn ein Forscher zufällig einen Mann und eine Frau auswählen würde, wäre die Frau in diesem Test mit einer höheren Wahrscheinlichkeit diejenige, die die Emotionen in den Augen besser erkennt. Der typisch weibliche Empathie-Gehirnchip scheint auf den ersten Blick also doch zu existieren.
Aber genau hier wird es interessant: Denn selbst dieser scheinbar objektive Test findet nicht im luftleeren Raum statt. Auch wenn die Teilnehmenden nur Augenpaare bewerten mussten, wussten sie doch, dass es um das Erkennen von Emotionen geht. Und dieses Wissen allein könnte ihr Verhalten bereits beeinflusst haben. Die drei experimentellen Studien zeigen nämlich, dass Menschen nicht immer gleich einfühlsam sind. Ihre Leistung ändert sich nach Kontext und je nachdem, wie motiviert sie sind. Dazu kommt: Ein Mann kann trotzdem empathischer sein als eine Frau.
Um das besser zu verstehen, können wir uns das wie den Unterschied in der durchschnittlichen Sprintgeschwindigkeit von Männern und Frauen vorstellen.
Im Durchschnitt sind Männer schneller. Aber eine trainierte Sprinterin kann deutlich schneller sein als ein untrainierter Sprinter. Und wenn ein untrainierter Mann plötzlich für einen Wettkampf motiviert und trainiert wird, kann er seine eigene Leistung erheblich verbessern, auch wenn er im Durchschnitt immer noch nicht so schnell ist wie der durchschnittliche männliche Profisprinter. Anders gesagt: Die Fähigkeit ist vorhanden, aber ihre Ausprägung hängt stark von Training, Motivation und Kontext ab.
Empathie ist nicht das, wofür wir sie halten⬆ nach oben
Vielleicht ist es also gar nicht wichtig, ob Männer oder Frauen empathischer sind. Sondern, was sie antreibt. Wenn Empathie bei Frauen als besonders wertvoll gilt, werden sie Wert darauf legen, sie zu zeigen. Wenn Männer lernen, dass sie nicht empathisch sein brauchen, werden sie weniger motiviert sein, sich in andere einzufühlen. Und alle wollen Geld.
Wenn wir von Empathie sprechen, denken viele automatisch an Mitgefühl, an Hilfsbereitschaft, an Menschen, die sich liebevoll um andere kümmern. Aber das ist ein Missverständnis. Empathie bedeutet zunächst einmal nur eines: die Fähigkeit zu erkennen, was andere Menschen denken und fühlen. Was wir mit diesem Wissen machen, ist eine ganz andere Frage.
Wer sich gut in andere einfühlen kann, ist also nicht automatisch ein Altruist. Sondern einfach jemand, der ein bestimmtes Talent hat, so wie andere besonders gut Choreografien tanzen oder komplizierte Torten dekorieren können.
Was bedeutet das für unser Verständnis von Männern und Frauen? Vielleicht sollten wir aufhören so zu tun, als wären Frauen die besseren Menschen, nur weil sie in manchen Situationen besser Gefühle erkennen können. Und vielleicht sollten wir aufhören so zu tun, als wären Männer emotionale Analphabeten. Empathie ist keine fixe Eigenschaft, die ein Geschlecht hat und das andere nicht. Sie ist eine Fähigkeit, die wir alle besitzen und die unter den richtigen Bedingungen aktiviert werden kann. Die spannende Frage ist also nicht, wer empathischer ist. Sondern: Wann und warum entscheiden wir uns dafür, unsere Empathie zu nutzen?
Redaktion: Rebecca Kelber, Schlussredaktion: Susan Mücke, Audioversion: Iris Hochberger