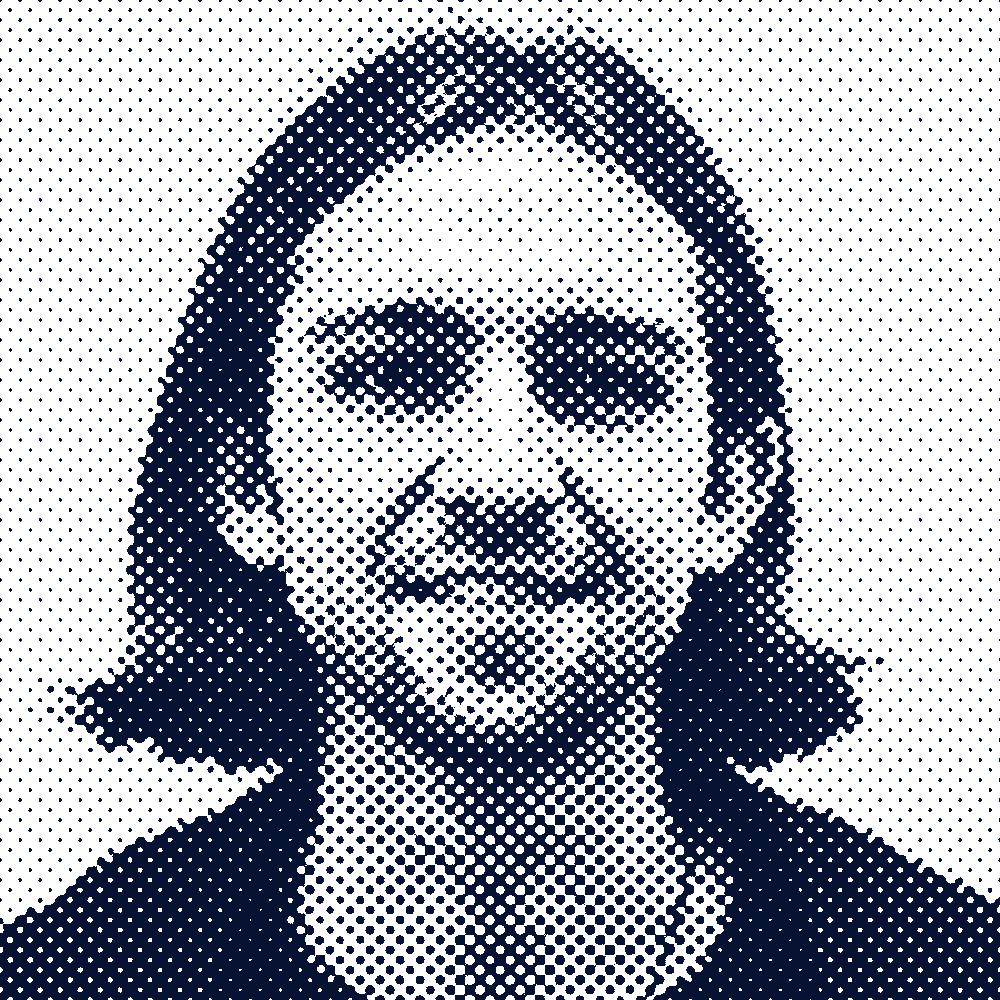Es war auch ein Treffen bei der Fastfood-Kette KFC, das Stefan zum Umdenken brachte. Er war 17 Jahre alt und hatte sich zuvor eineinhalb Jahre lang im Internet radikalisiert. An dem Tag traf er sich mit seinem Teenie-Crush. Während sie mehrmals den Burger zurückgehen ließ, weil immer der falsche gebracht wurde, redete er: über einen Migrationsstopp. Über dichte Grenzen. Und über Boote, die im Mittelmeer untergehen sollten. Bis heute erinnert er sich an die Situation: „Sie hat mich total schockiert angeguckt und meinte einfach: Das ist schon verdammt kalt von dir.“
Das war eines von mehreren Erlebnissen, die Stefan dazu gebracht haben, sein Weltbild zu ändern. Davor lag jedoch seine Radikalisierung über Facebook. Eine, wie sie heutzutage täglich in anderen sozialen Netzwerken wie Youtube oder Tiktok stattfindet.
Seit 2024 formieren sich in Deutschland zahlreiche neue rechtsextreme Jugendstrukturen. Sie nennen sich „Elblandrevolte“, „Deutsche Jugend voran“ oder „Division Nord“, sind extrem gewalttätig, dezentral organisiert und jünger denn je. Gleichzeitig steigt auch die Anzahl rechtsextremer Straftaten: 2024 zählte das Bundeskriminalamt 1.477 rechtsextreme Gewalttaten. Die AfD, die als stärkste Oppositionspartei im Bundestag über 100 Neonazis und Identitäre beschäftigt, ist bei jungen Menschen besonders erfolgreich. Vor allem bei Männern.
Wer heute aufwächst, stößt in sozialen Netzwerken regelmäßig auf rechtsextreme Inhalte. So wie Stefan damals. Er hat mir erzählt, wie ihn der Algorithmus innerhalb kürzester Zeit in einen rechtsextremen Strudel zog. Und wie er es schaffte, wieder aus der Szene herauszukommen.
Er interessierte sich für Politik und Umweltschutz. Und hielt sich selbst „ein bisschen für schlau“⬆ nach oben
Stefan ist Ende Zwanzig und in einer bayerischen Kleinstadt aufgewachsen. Er heißt eigentlich anders, möchte aber anonym bleiben. Am Telefon erzählt er, wie alles begann: Als er von der Grundschule aufs Gymnasium kam, wurde er gemobbt. Seine Noten verschlechterten sich, er musste eine Klasse wiederholen. Mit den neuen Mitschüler:innen kam er anfangs besser zurecht, dann wurde er wieder zum Außenseiter. „Tennie Drama“, sagt er knapp.
Damals, im Herbst 2012, hing Stefan viel auf Facebook herum. Dort wurden ihm Seiten in den Feed gespült, die Naturschutz mit Patriotismus verbanden. Eine hieß „Der Patriot“. Eine andere war die Gruppe „Anonymous Deutschland“. Stefan stieß zunächst zufällig auf Beiträge, die behaupteten, dass Migrant:innen die Umwelt verschmutzen. Oder dass Ausländer:innen zu viele Kinder kriegen und deshalb schlecht für die Umwelt sind.
„Das hat mich gecatcht“, sagt Stefan. Er habe sich schon immer für Politik und Umweltschutz interessiert und sich selbst „ein bisschen für schlau gehalten.“ Die Beiträge weckten in ihm das Interesse weiterzulesen. Und je mehr er las, desto tiefer rutschte er in die rechte Medienblase hinein. Innerhalb kurzer Zeit landete er in der sogenannten Alt-Right-Pipeline.
Alt-Right steht für „Alternative Right“ und meint rechtsextreme, ultra-nationalistische Communitys im Netz. Die Pipeline ist eine Metapher. Sie steht dafür, wie die Algorithmen von Social-Media-Plattformen ihre Nutzer:innen von harmlos wirkenden Inhalten zu immer extremerem, rassistischem oder faschistischem Content weiterleiten und Menschen so innerhalb kürzester Zeit radikalisieren.
Wer als Teenager:in ein Video anschaut, in dem sich eine Youtuberin über „Wokeness“ lustig macht, hat am Tag darauf die Startseite voll mit ähnlichen Reels. Wer dabei zuhört, wie AfD-Politiker Maximilian Krah über Männlichkeit sinniert, bekommt danach wahrscheinlich Inhalte von anderen AfD-Politiker:innen vorgeschlagen. Und wer diese anschaut, stößt wahrscheinlich relativ schnell auf extremere Accounts aus dem AfD-Vorfeld.
Am Anfang sind es nur Witze – am Ende steht Entmenschlichung⬆ nach oben
Die Radikalisierung in der Alt-Right-Pipeline läuft in drei Schritten ab, wie der Kulturwissenschaftler Luke Mann in einer Studie festhielt. Schritt eins: Man gewöhnt sich an leicht rassistische Inhalte oder humorvoll verpackten Extremismus. Schritt zwei: Die Inhalte werden immer extremer und werden schließlich zu einem Online-Ökosystem aus Hass und Abwertung. Am Ende des Prozesses steht die Entmenschlichung ganzer Personengruppen, die als Feinde gelten: nicht-weiße, queere und linke Menschen.
Rechte Memes, Witze und Videos dienen als Einstieg in eine Turbo-Radikalisierung, der immer mehr Teenager:innen verfallen. Das beobachtet auch Moritz Heisterkamp vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Er heißt eigentlich anders, möchte aber anonym bleiben, weil er Menschen beim Ausstieg aus der rechtsextremen Szene begleitet.
Seit einigen Jahren werden seine Klient:innen immer jünger: „13 oder 14 ist ein Alter, das sehr häufig bei uns aufschlägt“, sagt er. Er und seine Kolleg:innen hätten immer wieder mit Personen zu tun, die sich radikalisierten, ohne dass das direkte Umfeld etwas davon mitbekomme. „Seit die Szene zunehmend im digitalen Raum aktiv ist, haben wir den Eindruck, dass viele Radikalisierungen deutlich schneller ablaufen als zuvor“, sagt Heisterkamp. Vom ersten Kontakt bis zur ersten Straftat dauere es manchmal nur wenige Wochen.
Wie einfach und schnell so etwas geht, zeigt eine Umfrage, die ich auf Reddit geteilt habe. Dort habe ich gefragt, wie Menschen in der rechten Online-Szene landen. Knapp 300 Antworten habe ich erhalten, die meisten von jungen Männern. Die Mehrheit erzählt, dass sie als Teenager in die rechte Online-Szene geraten sind. Oft zuerst durch Memes und Humor. Also zum Beispiel durch Comedians, die sich über politische Korrektheit lustig machen. Oder durch Inhalte, die an ihre Lebensrealität als junge Männer anknüpfen.
Viele erwähnten Seiten wie 4chan, pr0gramm, 9GAG oder Youtube-Videos von Shlomo Finkelstein, Ben Shapiro oder Jordan Peterson, die sie zur rechten Szene brachten. Am Anfang stand oft das gute Gefühl anzuecken. Anders zu sein. Dann ging es Schritt für Schritt in die algorithmusgetriebene Echokammer aus immer extremeren Inhalten. So lief es auch bei Stefan.
„Der Algorithmus hat mich zur rechtsextremen Szene gebracht“⬆ nach oben
Innerhalb kurzer Zeit wurden Stefans Ansichten radikaler. Er kommentierte und likte die Posts von anderen und knüpfte erste Online-Kontakte. Dann als eine große rechtsextreme Facebook-Seite mit mehreren Zehntausend Follower:innen neue Moderator:innen suchte, bewarb er sich und wurde angenommen. Damals war er 15 Jahre alt.
Fortan verbrachte er möglichst viel Zeit in seinem Online-Netzwerk. Er kam von der Schule nach Hause, aß, erledigte seine Hausaufgaben und verbrachte anschließend Stunden am PC. Die Facebook-Seite wurde sein Lebensmittelpunkt. In Whatsapp-Gruppen, Video-Calls und Chats organisierte er mit seinen Mitstreitern Posts und Inhalte. Die meisten waren Teenager oder junge Erwachsene, viele liebäugelten mit der NPD.
Stefan und seine Mitstreiter nahmen Artikel aus klassischen Medien, kommentierten sie und rissen sie aus dem Kontext, verbreiteten Hass und provozierten mit rechtsextremen Witzen. An Details erinnert er sich kaum noch. Es seien aber häufig Artikel der Süddeutschen Zeitung gewesen, die er geteilt und kommentiert habe. „Meistens mit dem Vorwurf, dass die Politiker gegen das eigene Volk Politik machen“, sagt er. „Uns war klar, dass wir manipulativ arbeiten.“ Sein erfolgreichster Post war ein Judenwitz, der viral ging. Heute lässt der sich nicht mehr zu ihm zurückverfolgen. „Gottseidank“, sagt er. Während des Gesprächs betont er immer wieder, wie unangenehm ihm seine Vergangenheit heute ist.
Weil Stefan sich vor allem für Umweltschutz aus rechtsextremer Perspektive interessierte, verbreitete er auf der Seite regelmäßig den Mythos der Überbevölkerung. Demzufolge bekämen Menschen aus dem Globalen Süden zu viele Kinder, was wiederum schlecht für die Umwelt sein soll.
Er wurde immer islam- und migrationsfeindlicher. Obwohl er nie schlechte Erfahrungen mit Migrant:innen im echten Leben gemacht hatte. „Bei uns in Bayern auf dem Land war die Bevölkerung extrem weiß“, sagt er.
Stefans Radikalisierung lief komplett im Internet ab. Er hat sich nie szenetypisch angezogen, ist auf keine Demos gegangen und hatte keinen Kontakt zu Gleichgesinnten im analogen Leben. Auch die anderen Moderatoren der Facebook-Seite hat er nie getroffen.
„Der Algorithmus hat mich mit zur rechtsextremen Szene gebracht“, sagt er heute. „Von mir aus hätte ich nicht angefangen, nach diesen Themen zu suchen.“ Doch in den Posts, Kommentaren und Gruppenchats fand er schließlich etwas, was ihm im echten Leben fehlte: Zugehörigkeit.
Das Umfeld macht den Unterschied⬆ nach oben
Früher verbrachten Menschen oft Jahre in der rechtsextremen Szene. Sie gingen auf Demonstrationen, lasen die Texte rechtsextremer Vordenker, besuchten Szenekneipen und hörten Rechtsrock. In Fällen, in denen das eigene Umfeld nur aus Rechtsextremen besteht, ist der Ausstieg aus der Szene kompliziert. Stefan wiederum hatte Glück.
Weil seine Noten sich nicht verbesserten, wechselte er schließlich auf eine Realschule in einer anderen Stadt. Dort wurde Stefan neben einen Mitschüler gesetzt, der türkische Wurzeln hatte. Ein gläubiger Muslim. „Und ein total lieber Kerl“, sagt er. „Jedes Mal, wenn ich etwas Dummes gesagt oder meine islamfeindlichen Ansichten preisgegeben habe, hat er mich korrigiert.“ Stefan freundete sich mit seinem Mitschüler an. Wenn er rassistische Witze machte, nahm sein Kumpel ihn zur Seite und fragte: „Was soll der Scheiß?“ Nach kurzer Zeit ließ er seine radikalsten Ansichten fallen.
Zugleich verknallte Stefan sich in eine Mitschülerin. Die, mit der er dann bei KFC saß und die ihm zu verstehen gab, wie wenig sie von seinen Ansichten hielt. Stefan erinnert sich bis heute an die Abscheu in ihren Augen. „Das hat mich total erschüttert“, sagt er.
Sein neues Umfeld führte dazu, dass er seine Positionen hinterfragte. Und sein Wechsel auf die Realschule bedeutete vor allem eins: ein Freundeskreis. Stefan hing weniger Zeit auf Facebook herum und verbrachte mehr Zeit mit seinen neuen Freund:innen. Die Konflikte mit den anderen Moderatoren seiner Facebook-Seite nahmen zu. Er fremdelte öfter mit deren Ansichten. Widersprach. Verkrachte sich mit ihnen. Und als die Seite eines Tages gehackt wurde, ließ er schließlich alles hinter sich.
„Ich habe tatsächlich Kontakt zu Frauen und Menschen im Reallife bekommen“⬆ nach oben
Stefans Ausstieg zeigt, wie wichtig Umbrüche im eigenen Leben und das soziale Umfeld sein können. Davon berichten auch andere Aussteiger, die auf meine Reddit-Umfrage geantwortet haben. Viele schrieben, dass Erfahrungen im echten Leben ihr rechtes Online-Weltbild ins Wanken gebracht haben.
Ein Nutzer erzählt, er habe einen syrischen Mitbewohner bekommen. „Zu sehen, wie sehr er und seine Freunde sich anstrengen, Deutsch zu lernen und studierten oder arbeiten. Da war der Hate ziemlich cringe.“ Andere erwähnen vor allem Frauen, die ihnen den Ausstieg ermöglicht haben. „Ich habe tatsächlich Kontakt zu Frauen und Menschen im Reallife bekommen und war nicht mehr permanent online“, schreibt ein Nutzer. Wiederum ein anderer lernte eine Partnerin kennen, bei deren Familie immer die ZDF Heute-Show lief. Zunächst regte es ihn auf, dass Moderator Oliver Welke sich ständig über die AfD lustig machte. Irgendwann konnte er die Argumente nicht mehr ignorieren.
Wie wichtig das soziale Umfeld und eine vertrauensvolle Beziehung zu anderen für radikalisierte Menschen sein können, weiß auch Moritz Heisterkamp vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg. „Unsere Beratung lebt von der Beziehungsarbeit“, sagt er. Vertrauen sei die Grundvoraussetzung, um Menschen bei ihrem Ausstieg aus der rechtsextremen Szene zu begleiten. Aber es ist schwierig, das online aufzubauen, wenn Menschen sich in kurzer Zeit radikalisieren.
Zugleich bedeutet eine Turbo-Radikalisierung, dass auch eine Turbo-Deradikalisierung stattfinden kann. „Unsere jungen Klienten sind oft gar nicht super tief in der Ideologie drin, sondern funktionieren eher erlebnisorientiert“, sagt Heisterkamp. „Dahinter stecken persönliche Motive: Neugier oder die Suche nach Zugehörigkeit.“ Deshalb kann auch der Ausstieg schnell klappen. Besonders, wenn die eigene Familie, der Freundeskreis oder Lehrer:innen aufmerksam sind.
Für Menschen, die in ihrem Umfeld eine Radikalisierung beobachten, hat er einen Tipp: „Sobald man anfängt, sich mit Argumenten durchsetzen zu wollen, hat man verloren.“ Er und seine Kolleg:innen gehen deshalb stets mit einem „neugierigen Interesse“ in das Gespräch. Es sei nicht so wichtig, was die Person denkt – sondern warum. Anstatt über Fakten und Argumente zu streiten, sollte man lieber über die persönliche Enttäuschung, Ängste und Sorgen der Person sprechen. „Manche Dinge muss man einfach hinnehmen, auch wenn es schmerzhaft ist“, sagt er.
Auch Stefan sagt heute, dass er auf Argumente nicht reagiert hätte: „Einem Rechtsextremen kannst du Argumente an den Kopf werfen, wie du willst, die hängen in ihrem eigenen Weltbild fest.“ Einmal, als sein Vater ihm widersprochen habe, habe er seinen Vater bloß blöd angemacht. Was stattdessen hilft? Erfahrungen im echten Leben. „Die Stimmung im Netz war den ganzen Tag voller Hass, Hetze und Angst“, sagt er heute. „Dann saß ich plötzlich abends mit meinen Freunden im Schrebergarten mit ein paar Halben und wir haben gegrillt.“ Er merkte schnell: „Das war das echte Leben.“
Die Beratungsstelle „konex“ in Baden-Württemberg bietet kostenlose Beratungen für Menschen in ganz Deutschland an. Von Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr. Sie richtet sich an Angehörige von radikalisierten Personen und an Menschen, die aus einem extremistischen Umfeld aussteigen wollen.
Hotline: 0711 279-4555
Mail: ausstiegsberatung@konex.bwl.de
Whatsapp (erste Kontaktaufnahme): 0162-2530543
Mehr Informationen gibt es hier auf der Website.
Redaktion: Isolde Ruhdorfer, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Philipp Sipos