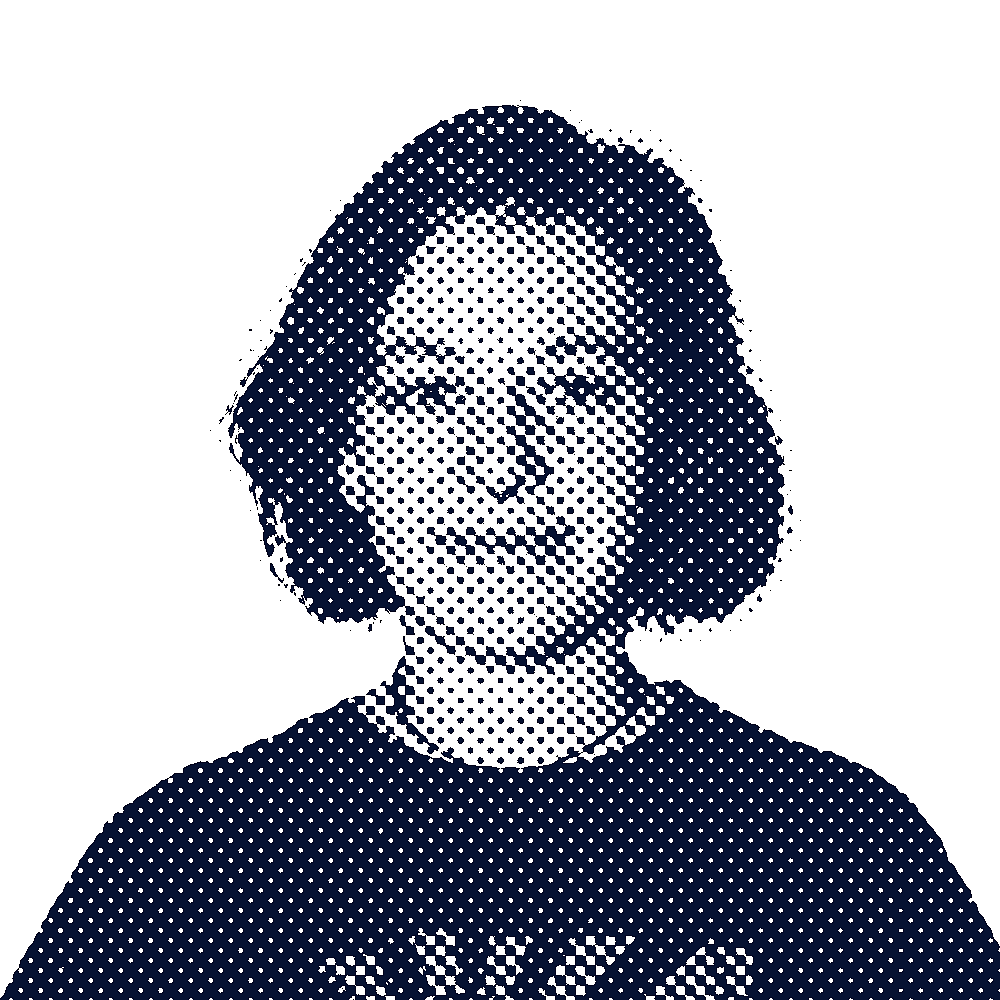Herzrasen, Schlaflosigkeit und Angstzustände. Diese Symptome beobachtete der Medizinstudent Johann Hofer im 17. Jahrhundert bei Schweizer Söldnern, die im Ausland kämpften. Sie begannen unter den Symptomen zu leiden, sobald jemand den Kuhreigen anstimmte, ein Volkslied aus den Alpen. Hofer diagnostizierte erstmals ein seltsames Leiden: die „Nostalgie“. Unbehandelt würde die Krankheit tödlich enden, war er überzeugt. Hofer verschrieb striktes Kuhreigen-Verbot und wenn gar nichts half: Heimfahrt in die Schweizer Berge.
Auch heute noch ist Nostalgie überall: Taylor Swift singt in „I hate it here“ davon, dass sie viel lieber in den 1830er Jahren leben würde (ohne die ganzen Rassist:innen, versteht sich). Serien wie „Stranger Things“ und „Dark“ spielen mit dem Charme der 1980er Jahre. Und Disney fährt über eine Milliarde US-Dollar Gewinn an den Kinokassen ein mit Remakes von Klassikern von „Aladdin“ oder „König der Löwen“. Anscheinend wären wir überall lieber als genau hier, genau jetzt.
Gleichzeitig haftet der Nostalgie ein schlechter Ruf an. Sie gilt als krankhaft, als rückwärtsgewandt. Seit einigen Jahren sogar als rechtspopulistisch. Was, wenn nicht nostalgisch, ist schließlich der Slogan „Make America Great Again“, mit dem US-Präsident Donald Trump seine Präsidentschaft erkämpft hat?
Schade, denn ich bin gerne nostalgisch. Nostalgie ist sogar eines meiner Lieblingsgefühle.
Deswegen habe ich mich gefragt: Können wir in einer Zeit, in der Populisten die Vergangenheit für sich beanspruchen, überhaupt nostalgisch sein? Die Antwort der Wissenschaft ist überraschend: Nicht nur können wir, vielleicht sollten wir sogar. Nostalgie kann richtig gesund für das Gehirn sein, wenn man eine andere Art Nostalgie einsetzt als die Rechtspopulisten.
Was die Nostalgie von der Erinnerung unterscheidet⬆ nach oben
Vor ein paar Wochen ging ich in die Volksküche am Hamburger Hafen. Zu Beginn meines Studiums war ich dort an fast jedem Montagabend. Abendessen in der Volksküche, dann Tischtennis-Rundlauf beim Punker-Stammtisch und gegen Mitternacht leicht angeschwipst ins Bett fallen, so lief fast jeder dieser Abende ab. Seit Jahren war ich nicht mehr da gewesen.
Kaum hatte ich die Tür aufgestoßen, überfiel es mich: ein warmes Gefühl von Heimkommen, gleichzeitig eine Wehmut über die Zeit, die vergangen war. Für einen Augenblick war es gleichzeitig 2025 und 2016, Gegenwart und Vergangenheit flossen in einen einzigen Moment zusammen. Ich hielt das Gefühl kaum aus.
Nostalgie zu spüren ist eine ambivalente Erfahrung, oft gleichzeitig schön und bedrückend. Eine Umfrage unter den KR-Mitgliedern hat mir gezeigt, dass der schöne Anteil jedoch überwiegt. 80 Prozent beschreiben Nostalgie als überwiegend angenehmes Gefühl.
Diese bittersüße Sehnsucht nach der Vergangenheit ist mehr als eine simple Erinnerung. Mithilfe von Erinnerungen verwaltet unser Gehirn, was wir täglich erleben. Nostalgie ist ihre poetische Kameradin, die Erinnerungen mit Leben füllt. Erinnerungen lassen sich beliebig abrufen, Nostalgie überfällt dich häufig ohne Vorwarnung. Wie bei KR-Mitglied Alex: Wenn er die Fernsehserie „X-Factor - das Unfassbare“ schaut, dann „bringt mich das sofort zurück auf den Teppichboden in der Wohnung meiner Eltern, auf meine Ellbogen gestützt vor dem Röhrenfernseher.“
Der Schweizer Medizinstudent Johann Hofer hätte Alex empfohlen, schnellstmöglich den Fernseher abzuschalten. Aber heute gilt die Nostalgie nicht mehr als gefährliche Krankheit. Die moderne Neurowissenschaft zeigt: Nostalgie ist ein erstaunlich gesunder mentaler Mechanismus.
Der Autobiograph in deinem Gehirn⬆ nach oben
Tim Wildschut und sein Kollege Costantine Sedikides haben zu Beginn der 2000er Jahre die Nostalgie aus dem Abstellschrank der Psychologie geholt. Sie sind die Koryphäen dieses Forschungszweiges. (Ja, ich wusste bis jetzt auch nicht, dass Nostalgie ein richtiges Forschungsfeld ist!) Wenn wir uns in Nostalgie verlieren, läuft das Gehirn auf Hochtouren, fand Wildschut in einer gemeinsamen Untersuchung mit Neurowissenschaftler:innen heraus.
Nostalgische Erinnerungen aktivieren gleich mehrere Bereiche im Gehirn, wie den mittleren präfrontalen Kortex und den Hippocampus. Diese Bereiche im Gehirn sind unter anderem für Selbstreflektion und das autobiographische Gedächtnis zuständig. Dieses arbeitet wie ein Autobiograph, der in deinem Kopf sitzt: Er schreibt aus all den Erlebnissen, die dir täglich widerfahren, eine Lebensgeschichte zusammen. Eine wahrheitsgetreue Dokumentation ist das nicht, er kürzt, bündelt und verschnörkelt das, was wirklich passiert ist. Diese Geschichte ist sehr wertvoll für deine psychische Gesundheit.
Nostalgische Erinnerungen sind für den Autobiographen in deinem Kopf besonders wichtig, denn bei ihnen bist du die Hauptperson. Der Scheinwerfer ist auf dich, auf deine Wahrnehmung und deine Gefühle gerichtet. Und stellt sie meistens in ziemlich gutes Licht, haben die Neurowissenschaftler festgestellt. Andere Formen des Erinnerns, zum Beispiel Grübeln oder „Was wäre, wenn“-Szenarien durchzuspielen, lassen oft Groll und Verbitterung in uns aufkommen. Nostalgische Erinnerungen, schreibt Wildschut, stärken unser Selbstwertgefühl und unsere Verbundenheit zu anderen Menschen.
Mehr noch: Gerade weil Nostalgie zwischen Freude und Schmerz schwankt, trainiert sie unsere emotionale Beweglichkeit. Denn wenn du dich nostalgisch fühlst, wechselt das Gehirn schnell zwischen „Mmm, angenehm!“ und „Autsch, schmerzhaft!“ hin und her. Menschen, die häufiger nostalgische Momente erleben, können daher besser mit widersprüchlichen Gefühlen umgehen. Obendrein aktiviert Nostalgie auch noch das Belohnungszentrum. Dadurch motiviert sie dich, den wichtigen Zielen in deinem Leben nachzugehen.
Wenn Nostalgie also ein so nützlicher psychologischer Mechanismus ist, warum hat sie dann heute so einen schlechten Ruf? Die Antwort liegt in unserer hypermodernen Gegenwart.
Das Leben war noch nicht so komfortabel wie jetzt. Was soll die Sehnsucht nach früher?⬆ nach oben
Noch nie war es so einfach, spontane Wünsche zu erfüllen: Heute Abend einen Spanischkurs anfangen, über Tinder ein Date für nächsten Samstag organisieren oder herausfinden, wie viele Gummibärchen in eine Badewanne passen (circa 85.000, wenn du sie bis zum Rand füllst): All das geht mit ein paar Klicks. Wer schon immer davon geträumt hat, in Gelatine zu baden, kann sich die 85.000 Gummibärchen sogar an die Haustür liefern lassen. Unser Leben hat sich vielleicht noch nie so komfortabel, so modern angefühlt wie jetzt.
Und wir? Sind besessen von der Vergangenheit. In der Taz rief ein Kolumnist gar die „Nostalgierepublik Deutschland“ aus.
Das ist kein Zufall, sagt die Zukunftsforscherin Lilith Boettcher. „Nostalgie ist eine Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft, die viel über das Hier und Jetzt erzählt.“ Was sie meint: Unsere Sehnsucht nach der Vergangenheit verrät mehr über unsere Gegenwart als über die Zeit, nach der wir uns sehnen.
Um zu verstehen, warum wir gerade so nostalgisch sind, müssen wir einen Schritt zurücktreten und etwas betrachten, das uns so selbstverständlich erscheint, dass wir es kaum bemerken. Das prägende Merkmal unserer Zeit ist ein simples Versprechen: Morgen wird besser sein als heute. Wir werden mehr verdienen als unsere Eltern, freier leben und noch dazu vor Krebs und Langeweile geschützt sein. Dieser Fortschrittsglaube sitzt so tief in unserem kollektiven Bewusstsein, dass wir ihn kaum noch wahrnehmen.
Der Fortschrittsglauben ist wie ein Motor, der alles um uns herum antreibt: politische Entscheidungen (immerhin gab sich die Ampel-Koalition den Titel „Fortschrittskoalition“), den Wettbewerb unter Unternehmen oder die Forschung an grünen Technologien. Dream big, move fast and break things. Dank des unerschütterlichen Glaubens an den Fortschritt glaubt der Tech-Milliardär Bryan Johnson, seinen Alterungsprozess aufhalten zu können. Der Tod ist für ihn bloß ein lösbares, technisches Problem. Wegen des Fortschrittsglaubens plant die saudi-arabische Regierung NEOM, eine Stadt in Form einer 1,7 Kilometer langen Linie mitten in der Wüste – einfach, weil sie es kann.
Dem Fortschrittsglauben sind aber nicht nur durchgeknallte Tech-Milliardäre und saudische Kronprinzen unterworfen. Auch du selbst gibst dich wahrscheinlich nicht damit zufrieden, wie sportlich, schön oder schlau du gerade bist. Die meisten Menschen streben danach, eine bessere Version ihrer Selbst zu werden.
Wie wir die Kontrolle über den Fortschrittsglauben verlieren⬆ nach oben
Ziemlich lange Zeit war der Traum vom Fortschritt genau das: bloß ein Traum. Es fehlte schlicht an der Technologie, um den Traum zur Wirklichkeit zu machen.
Und heute? Das Internet in deiner Hosentasche! Künstliche Intelligenz! Sustainability! Longevity! Bitcoins! Die Menschheit lebt ihren Fortschrittstraum. Das bedeutet auch: Innerhalb eines Menschenlebens verändert sich so viel, dass unser natürliches Bedürfnis nach einer sinnstiftenden Lebensgeschichte ins Wanken gerät. Vieles verschwindet, ohne dass du es überhaupt bemerkst. Aber wenn du zurückblickst, ist doch alles ganz anders.
Der Autobiograph in unserem Kopf ist damit überfordert. Denn die Komplexität und Schnelligkeit der Gegenwart machen es ihm ziemlich schwer, aus Erfahrungen eine sinnstiftende Lebensgeschichte zu stricken.
Die Folge: Mehr Menschen sind nostalgisch. Sie suchen nach Ankern in der Vergangenheit oder wie KR-Mitglied Elke sagt: „Ich fühle mich der Gegenwart nicht so ausgeliefert, wenn ich alte Serien schaue.“
So profitieren Rechtspopulist:innen von dem enttäuschten Fortschrittsversprechen⬆ nach oben
Die Gegenwart fühlt sich an wie ein Kapitel aus der Kinderbuch-Serie „Eine Reihe betrüblicher Ereignisse“: Covid-Pandemie, Wirtschaftskrise, Krieg in der Ukraine, Krieg in Gaza, Krieg im Kongo, darfs noch eine Klimakatastrophe dazu sein? Mein Kollege Gabriel Yoran schreibt, dass ein Ereignis besonders prägend war: „Wenn meine Generation nach dem 11. September 2001 etwas lernen konnte, dann das: Fortschritt ist kein Naturgesetz.“ Der Fortschrittsglauben hat einen ordentlichen Knacks bekommen.
Das wurde mir spätestens klar, als ich auf die eigentlich ziemlich offene Frage an unsere Leser:innen etwa 120-mal die gleiche Antwort bekam. Die Frage lautetet: „Was vermisst du von früher?“ Die Antwort, immer wieder: Unbeschwertheit, Leichtigkeit und das Gefühl, ganz viel Zeit zu haben. Hanne schreibt, sie vermisse „Zukunftsfreude und die Sicherheit eines Lebens ohne Krieg in Europa“, Bettina „das Gefühl, dass wir alle ein gemeinsames Ziel verfolgen und eine Utopie verwirklichen.“
Die Gefühle von Angst und Misstrauen gegenüber der Zukunft, die Hanne und Bettina beschreiben und die ich auch kenne, sind eine normale Reaktion auf dieses gebrochene Versprechen. Wer wäre nicht gekränkt, wenn das Vertrauen in eine goldene Zukunft so heftig enttäuscht wird? Oder wie Gabriel schreibt: „Fortschritt will zu Lebzeiten erlebt werden, nicht nur abstrakt zur Kenntnis genommen in seiner historischen Dimension. Und wer ihn nicht erlebt, und zwar bezogen auf das, was ihm als wünschenswert erscheint, wird frustriert.“
Bei dieser Enttäuschung setzen Rechtspopulist:innen an. Sie erkennen die Kränkung und Enttäuschung, unter der viele Menschen in der Spätmoderne leiden. Dagegen haben sie ein einfaches Rezept: Sie entwerfen eine nostalgische Zukunft, die gespickt ist mit Anspielungen auf den versprochenen Wohlstand und das Sicherheitsgefühl.
Diese Strategie hat Nostalgie zu einem internationalen Phänomen gemacht. Egal ob in den USA, Indien oder der Türkei: Überall berufen sich rechtspopulistische Staatschefs auf eine vermeintlich glorreiche Vergangenheit.
How to Nostalgie – ohne rechte Verklärung⬆ nach oben
Ich habe diesen Text auch aus einem eigennützigen Grund geschrieben. Ich wollte wissen, ob ein liebevoller Blick in die Vergangenheit auch ohne Verklärung und Volkstümelei gelingt. Denn ich kenne die Sehnsucht nach Menschen und Orten aus der Vergangenheit ziemlich gut.
Es gibt ein hebräisches Sprichwort über Nostalgie, das übersetzt ungefähr bedeutet: „Es war schön – und es ist schön, dass es war.“ Tagträumen, Nachsinnen, ohne die eigene Erinnerung für die einzig mögliche Version der Vergangenheit zu halten – das nennt man reflexive Nostalgie, sagt Lilith Boettcher, die Zukunftsforscherin. „Mit ihr kann ich die Vergangenheit kritisch reflektieren und schauen, wie ich Schönes aus der Vergangenheit in das Hier und Jetzt übersetzen kann“, erklärt sie.
Wer reflexiv nostalgisch ist, weiß: Die Vergangenheit ist unwiederbringlich. Und das ist in Ordnung, denn wahrscheinlich war sie nicht so rosig, wie man sie in Erinnerung hat. Wer seiner Zeit an der Uni nachhängt, vergisst vielleicht, dass Filterkaffee in der Kantine meistens nach saurer Asche schmeckt. Und wie anstrengend es ist, sich von Kommilitonen den Nahost-Konflikt mansplainen zu lassen.
Trotzdem darf man sich vorübergehend in die Vergangenheit flüchten, erklärt Lilith Boettcher. „Mit reflexiver Nostalgie kann man ganz viel Stärke und Kraft sammeln. Das kann sehr identitätsstiftend und resilienzfördernd sein.“ Deswegen ist Nostalgie eines meiner Lieblingsgefühle. Nostalgisches Zurückerinnern ist für mich wie ein Spachtel, mit dem ich Brüche und Verluste glatt streiche.
Die Sehnsucht nach der Vergangenheit wiederum, die für die Rechtspopulist:innen typisch ist, nennt man restaurative Nostalgie: „Diese Nostalgie möchte die Vergangenheit wortwörtlich wieder herstellen. Restaurative Nostalgie ist rückwärtsgewandt und blendet alles Negative aus“, sagt Lilith Boettcher.
Häufig, wenn wir von den negativen Seiten der Nostalgie sprechen, meinen wir also eigentlich die restaurative Nostalgie.
Nostalgie ist wie ein Stück Schokolade⬆ nach oben
Richtig genutzt, kann Nostalgie bei einer ziemlich schweren Aufgabe helfen: Nämlich zu bewältigen, dass sich die Realität manchmal anfühlt wie Rodeoreiten ohne Griff am Sattel. Wir haben keine andere Wahl, als irgendwie einen Umgang damit zu finden. Es kann sehr heilsam sein, dabei liebevoll auf Erinnerungen aus der Vergangenheit zu blicken.
Vielleicht hilft es, wenn du dir nostalgische Erinnerungen wie ein mehrfach belichtetes Foto vorstellst: Jedes Mal, wenn du die Erinnerung hervorholst, lädst du sie mit Emotionen aus der Gegenwart auf. Die Erinnerung bleibt jedoch ein Foto eines vergangenen Moments, den du nicht mehr zurückholen kannst.
Oder, so wie Martin in meiner Umfrage schreibt, wie ein Stück Schokolade:
„Ich glaube, Nostalgie ist genauso wichtig wie hin und wieder ein Stück Schokolade.“
Aber jedes Kind weiß: Wer sich nur von Schokolade ernährt, bekommt am Ende Bauchschmerzen.
Redaktion: Theresa Bäuerlein und Bent Freiwald, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Philipp Sipos; Audioversion: Iris Hochberger
.jpg?compress=true&format=auto)