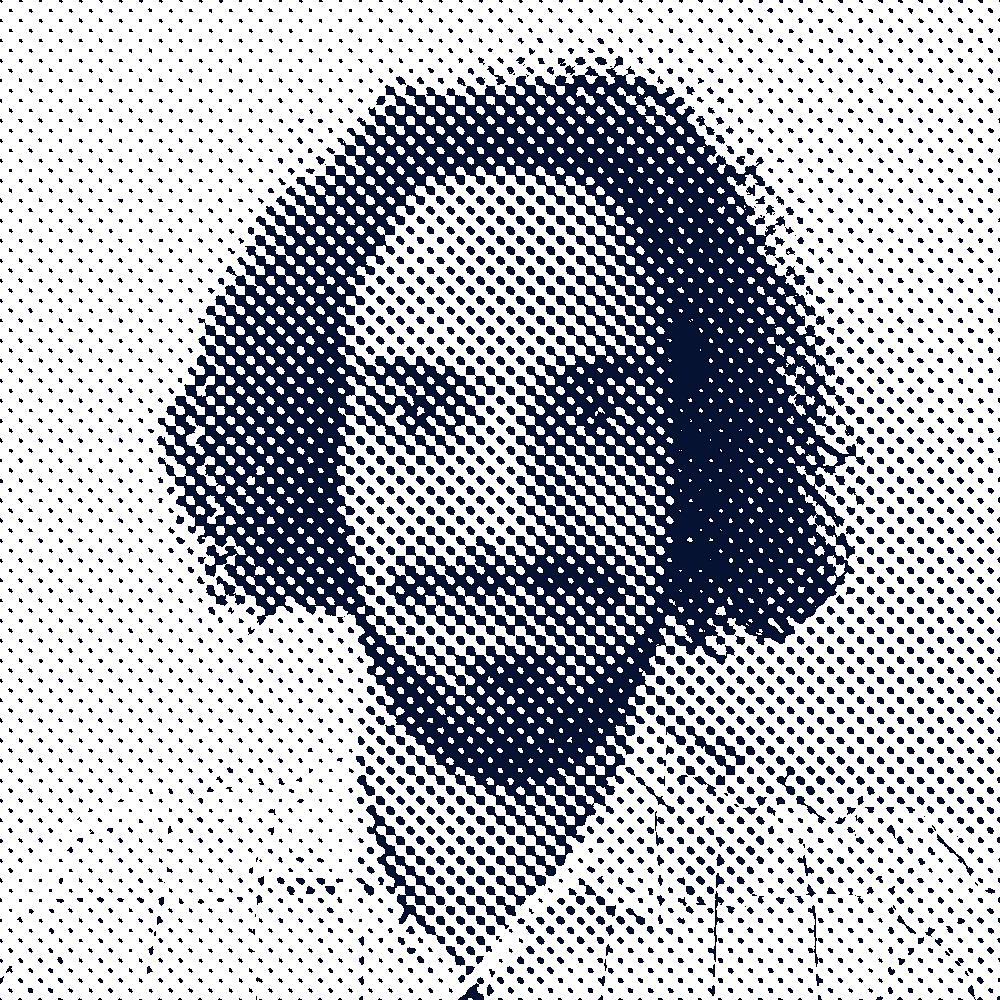Schon im Januar 2024 wiesen Sie auf die Nahrungsmittelknappheit in Gaza hin und warnten vor einer drohenden Hungersnot. Was ist heute anders, wird Gaza bald einen Kipppunkt erreichen?

Alex de Waal
Alex de Waal ist Direktor der World Peace Foundation an der US-amerikanischen Tufts University und weltweit einer der führenden Experten zum Thema Hungersnöte. Neben Gaza forscht er auch zu den Hungersnöten im Sudan, in Äthiopien und am Horn von Afrika. 2017 verfasste er das Buch „Mass Starvation: The History and Future of Famine“. Darin arbeitet er heraus, dass Hunger in den letzten Jahren immer öfter als Kriegswaffe eingesetzt wird.
Schon seit Beginn des jüngsten Krieges in Gaza sehen wir eine massive Zerstörung von Gütern, die für das Überleben unverzichtbar sind. Wir sehen Zwangsumsiedlungen und den Verfall der Gesellschaft. Dazu kommt die Belagerung, die seit dem 2. März 2025 den Zugang zu Nahrungsmitteln einschränkt.
Seitdem wurde zwar etwas Hilfe hineingelassen. Aber es ist diese Belagerung, die Gaza in eine Massenhungersnot getrieben hat. Die Unterernährung von Kindern und die Todesfälle werden bald exponentiell ansteigen, wir stehen kurz davor.
Wann wird eine Nahrungsmittelknappheit zu einer Hungersnot?
Hungersnot und Nahrungsmittelknappheit sind nicht dasselbe. Während einer Hungersnot haben einige Menschen in einer Gesellschaft nicht genug zu essen. Es kann also Hungersnöte geben, auch ohne, dass Nahrungsmittel knapp sind. Historisch gesehen war das oft der Fall. Und in so ziemlich jeder Hungersnot, über die wir Aufzeichnungen haben, wiegt Ungleichheit schwerer als alles andere.
Deswegen sieht man nicht nur Bilder von kranken und unterernährten Menschen aus Gaza, sondern auch von relativ gesunden.
Dasselbe Spektrum ist auf Bildern jeder Hungersnot in der jüngeren Geschichte zu sehen – sei es in Äthiopien, in Indien, im Warschauer Ghetto oder in Gaza. Man sieht, wie die Ärmsten und Schwächsten hungern, während die besser situierten Menschen es nicht tun.
Israel versucht, die Bilder von nicht hungernden Menschen für sich zu nutzen. Sie implizieren, dass es keine fehlende Nahrungsmittelversorgung geben kann. Und dass die nicht hungernden Menschen in Gaza Schuld daran sind, dass andere hungern. Das ist aber niemals der Fall. Hier ist ein Propagandamechanismus am Werk, der die Hungersnot eines Teils einer Gesellschaft den anderen Teilen anzulasten versucht. Dabei ist ganz Gaza besetzt.
Wie können wir die Ernährungssituation in Gaza messen?
Vor etwa 20 Jahren wurde das IPC (Integrated Food Security Phase Classification System) eingerichtet. Ziel war es, ein standardisiertes Messsystem für Nahrungsmittelkrisen zu schaffen. Es ging nicht in erster Linie darum, Definitionen für verschiedene Abstufungen von Hunger zu entwickeln. Die Definitionen sind nur ein Nebenprodukt. Der Zweck des IPC ist, Hungersnöte zu verhindern.
Es ist ähnlich wie bei der Völkermordkonvention: Sie dient dazu, Völkermord zu verhindern – nicht, abzuwarten, bis ein Völkermord stattgefunden hat, und dann zu sagen, wer schuldig ist.
Was sind die Kriterien dafür, dass gemäß dem IPC eine Hungersnot ausgerufen wird – die fünfte und höchste Stufe der Skala?
Dafür müssen drei Kriterien erfüllt sein. Das erste Kriterium misst den Zugang zu Nahrungsmitteln. Es ist erfüllt, wenn 20 Prozent der Bevölkerung unter einer dramatischen Nahrungsmittelknappheit leiden, praktisch gar nichts zu essen haben oder vollständig von humanitärer Hilfe abhängig sind. Dazu liegen uns gute Daten aus Gaza vor.
Das zweite Kriterium ist die Unterernährung von Kindern. Hier sind die Daten nicht mehr so gut. Gaza war ursprünglich in Sachen Ernährung von Kindern besser gestellt als beispielsweise Somalia oder der Südsudan. Das bedeutet, dass tatsächlich stärkerer Druck erforderlich war, damit die Kinder in Gaza so stark unterernährt sind.
Und das dritte Kriterium?
Das dritte Kriterium sind übermäßige Todesfälle. Das ist schwer zu belegen. Die Zahl der Menschen, bei denen Verhungern als Todesursache festgestellt wird, macht nur einen kleinen Teil derjenigen aus, die tatsächlich an den schlechten Bedingungen sterben. Das liegt teilweise daran, dass einige es nicht ins Krankenhaus schaffen – aber hauptsächlich daran, dass viele an Infektionskrankheiten sterben. Im Fall von Gaza haben sie vielleicht eine Wunde und können sich aufgrund ihrer Unterernährung nicht davon erholen. Die registrierte Todesursache ist dann möglicherweise nicht Unterernährung, sondern Verletzung oder Krankheit.
Ich denke, bis jetzt haben wir etwa 300 registrierte Todesfälle durch Hunger. Ich wäre sehr überrascht, wenn das mehr als 10 Prozent der tatsächlichen Todesfälle wären. Wahrscheinlich sind die Zahlen viel höher.
Am 22. August hat das IPC in Gaza erstmals eine Hungersnot festgestellt. Bis Ende September werden mehr als 640.000 Menschen im Gazastreifen davon betroffen sein. Warum konnte das IPC erst jetzt eine Hungersnot feststellen?
Seit Dezember 2023 fordert das IPC Israel dazu auf, zuzulassen, dass in Gaza mehr Daten erhoben werden können. Israel ist der Aufforderung nicht nachgekommen. Dadurch hat sich der Prozess verlangsamt, mit dem der IPC mit ausreichender Sicherheit feststellen konnte, dass alle drei Kriterien für eine Hungersnot erreicht wurden. Im August schließlich wurden die Fakten und Trends unübersehbar.
Was ändert sich, wenn Stufe 5 ausgerufen wird?
Rechtlich gesehen macht das keinen Unterschied. Eine Hungersnot gemäß der IPC ist kein Verbrechen. Es gibt keine tatsächliche Verpflichtung für irgendjemanden, wenn eine Hungersnot ausgerufen wird. Aber es gibt eine moralische Verpflichtung. In den letzten Jahren haben Regierungen die Stufe 5 der Skala als Schwelle für Maßnahmen angesehen. Implizit besteht dann die Verpflichtung zu handeln. Eigentlich sollte man schon handeln, wenn die Bedingungen für eine Hungersnot noch nicht gegeben sind. Man sollte handeln, um sie zu verhindern – nicht warten, bis sie eingetreten ist.
Wie lässt sich die Situation in Gaza mit anderen Hungersnöten vergleichen, beispielsweise im Sudan oder im Jemen?
Im Sudan sind mehr als 20 Millionen Menschen in Not. Gaza hat nur zwei Millionen Einwohner, das Ausmaß ist also geringer. Aber die Intensität der Not ist ebenso groß. In den am stärksten betroffenen Gebieten des Sudan ist die Not ähnlich groß wie in Gaza.
Ob die Hungersnot im Sudan oder im Jemen weitergehen wird, hängt von vielen Faktoren ab, von vielen verschiedenen kriegführenden Kräften, Regierungen, Rebellen, lokalen Warlords und der Leistungsfähigkeit des humanitären Systems. In Gaza ist die Lage viel einfacher. Die Möglichkeit, die Hungersnot zu beenden, liegt in den Händen eines einzigen Akteurs: Israel. Wenn Israel der UN und ihren Partnern ermöglichen würde, so zu arbeiten, wie sie es möchten, könnte die Ernährungssituation sehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Noch im Mai hätte Israel den Hunger innerhalb eines einzigen Tages beenden können. Jetzt würde es etwas länger dauern. Inzwischen gibt es Kinder, die so stark unterernährt sind, dass es sehr schwierig sein könnte, ihr Leben zu retten – egal was passiert.
Welche Teile einer Gemeinschaft sind besonders gefährdet?
Demografisch gesehen sind kleine Kinder und ältere Menschen am stärksten gefährdet. Aus wirtschaftlicher Sicht sind es die Ärmsten. Diejenigen, die keinen Zugang zu anderen Einkommens- oder Nahrungsquellen haben, die nichts mehr zu verkaufen haben, die keine Verwandten haben, die ihnen Geld schicken können.
Und wer kommt vergleichsweise glimpflich davon?
Die Menschen, die politisch gut vernetzt sind. In jedem Konflikt und jeder Belagerung sind Männer mit Waffen die letzten, die hungern. Sie haben Zugang zu illegalen Netzwerken und können den Markt kontrollieren.
Einer der Gründe, warum Hunger als Kriegsmethode verboten ist, ist folgender: Wenn man eine Stadt belagert und beispielsweise fünf Prozent der Bevölkerung bewaffnete Männer und 95 Prozent Zivilisten sind, muss man zuerst die 95 Prozent Zivilisten hungern lassen, bevor man die bewaffneten Männer trifft. Wenn Israel glaubt, dass es die Hamas aushungern kann, muss es zuerst alle Zivilisten in Gaza aushungern.
Welche körperlichen und kognitiven Schäden erleiden Hungerpatienten?
Wenn ein Erwachsener etwa 40 Tage lang in Hungerstreik tritt oder ausgehungert wird, verbraucht er die Fettreserven im Körper und einen Teil der Muskeln. Er müsste dann ins Krankenhaus, da er irreparable Schäden an seinen inneren Organen, der Darmschleimhaut, dem Herzen und der Leber entwickelt. Wenn er bereits Vorerkrankungen hat, werden diese ebenfalls ernsthaft getriggert. In diesem Stadium nimmt auch die Fähigkeit ab, normale Nahrung zu sich zu nehmen. Es besteht die Gefahr, dass Essen tatsächlich zum Tod führen kann. Die Ungleichgewichte im Körper können so groß sein, dass man nicht überleben kann.
Und wie sehen die psychologischen und sozialen Auswirkungen für die Patienten aus?
Die Gedanken und das Verhalten konzentrieren sich fast ausschließlich aufs Essen. Die soziale Diagnose einer Hungersnot lautet, dass Menschen grundlegende soziale Tabus verletzen, um an Essen zu kommen. Sie suchen im Müll nach Essen, verstecken Essen, stehlen Essen, kommen der Verpflichtung nicht nach, ihre Familienmitglieder zu ernähren. Man könnte es eine tägliche Grausamkeit nennen, die mit dem Versuch einhergeht, zu überleben.
Welche langfristigen Traumata verursacht Hunger in einer Gemeinschaft?
Menschen in einer Hungersnot beschreiben die Nahrungsmittelaufnahme nicht mehr als Essen, sondern als Fressen, wie bei Tieren. Sie fühlen sich dadurch sehr erniedrigt und gedemütigt. Bei ihnen entwickelt sich das Gefühl, dass sie ihre Würde verlieren, den Zusammenhalt, ihre Lebensart. Das ist wohl das Traumatischste daran.
Außerdem erinnern sich die Menschen an die Dinge, die passiert sind, aber sie wollen nicht darüber sprechen. In Irland herrschte nach der großen Hungersnot der 1840er Jahre in der Bevölkerung großes Schweigen. Die Menschen wollten nicht darüber sprechen, was passiert ist. Im Falle des Holodomor in der Ukraine wurde die Erinnerung an den Hunger für eine ganze Generation unterdrückt. Die Menschen wussten, dass Stalin letztendlich verantwortlich war. Trotzdem war für sie am schmerzhaftesten, was sie ihren Nachbar:innen angetan hatten.
Werden sich diese Muster in einigen Jahren auch in der palästinensischen Gesellschaft zeigen?
Wir sehen das jetzt schon. Menschen sprechen davon, dass sie zu Tieren degradiert wurden, von Entmenschlichung, Erniedrigung und Demütigung.
Die israelische Regierung erkennt zwar an, dass Gaza hungert – gibt aber der Hamas die Schuld dafür. Sie beschuldigt die Hamas, in großem Umfang Lebensmittel gestohlen zu haben.
Die Hamas trägt die Schuld für viele Verbrechen, aber nicht für den Hunger in Gaza. USAID hat letztes Jahr 156 Fälle von gestohlenen Hilfsgütern untersucht. Sie kam zu dem Schluss, dass es keine Beweise dafür gibt, dass die Hamas in großem Umfang stiehlt. Die New York Times hat hochrangige israelische Offiziere gefragt. Sie sagten: Die Hamas stiehlt nicht in großem Stil.
Seit März verwehrt Israel vielen NGOs die Einfuhr von Hilfsgütern. Auch das Verteilungssystem für Hilfsgüter der Vereinten Nationen (UN) ist zusammengebrochen. Stattdessen wurde mit politischer Unterstützung aus den USA und Israel die private Gaza Humanitarian Foundation (GHF) eingerichtet. Was macht die GHF anders als die UN?
Die Vereinten Nationen hatten zwischen 300 und 400 Verteilungsstellen. Sie überwachten so genau wie möglich, wer die Lebensmittel erhielt. Im Mai plante sie, ihre Überwachung und Kontrolle zu verschärfen.
Die Gaza Humanitarian Foundation verfügt nur über vier Verteilungsstellen. Sicher sind aber nur das Personal und die Hilfsgüter bis zum Zeitpunkt der Verteilung. Für die Menschen, die dorthin gehen, sind die Stellen nicht sicher.
Verfolgt die GHF besser als die UN, wohin die Lebensmittel gelangen?
Nein. Erst kürzlich hat die GHF angekündigt, dass sie ein Pilotprojekt startet, um bestimmte Hilfsgüter für Frauen und Kinder beiseitezulegen. Was davor passiert ist, kann man in Videos und auf Bildern sehen: Junge, kräftige Männer kamen und holten sich das Essen. Es war ein wilder Ansturm, die Starken bekamen etwas und die Schwachen nicht.
Diese jungen Männer könnten Mitglieder krimineller Banden gewesen sein. Sie könnten Mitglieder der Hamas gewesen sein. Ein Teil dieser Lebensmittel landete dann auf dem Markt – möglich war das durch das GHF-System. Und das war von Anfang an klar, als das System entwickelt wurde.
Was müsste jetzt in Gaza passieren, damit sich die Nahrungsmittelsituation verbessert?
Es müssten mehrere Dinge geschehen. Erstens muss man einfach sehr viele Lebensmittel dorthin bringen, um die Marktpreise zu senken und die Macht der Kartelle zu brechen, die Profit machen. Allmählich geschieht das auch. Es muss wieder ein Verteilungssystem für die Menschen vor Ort geben.
Außerdem braucht es viel mehr spezialisierte Pflege für die schwer unterernährten Kinder, von denen die meisten ins Krankenhaus müssen. Die Krankenhausversorgung muss massiv ausgebaut werden. Es braucht Wasser, sanitäre Einrichtungen und all die speziellen Hilfsmittel, die für Intensivstationen erforderlich sind.
Redaktion: Isolde Ruhdorfer, Schlussredaktion: Rebecca Kelber, Audioversion: Iris Hochberger und Christian Melchert, Fotoredaktion: Philipp Sipos