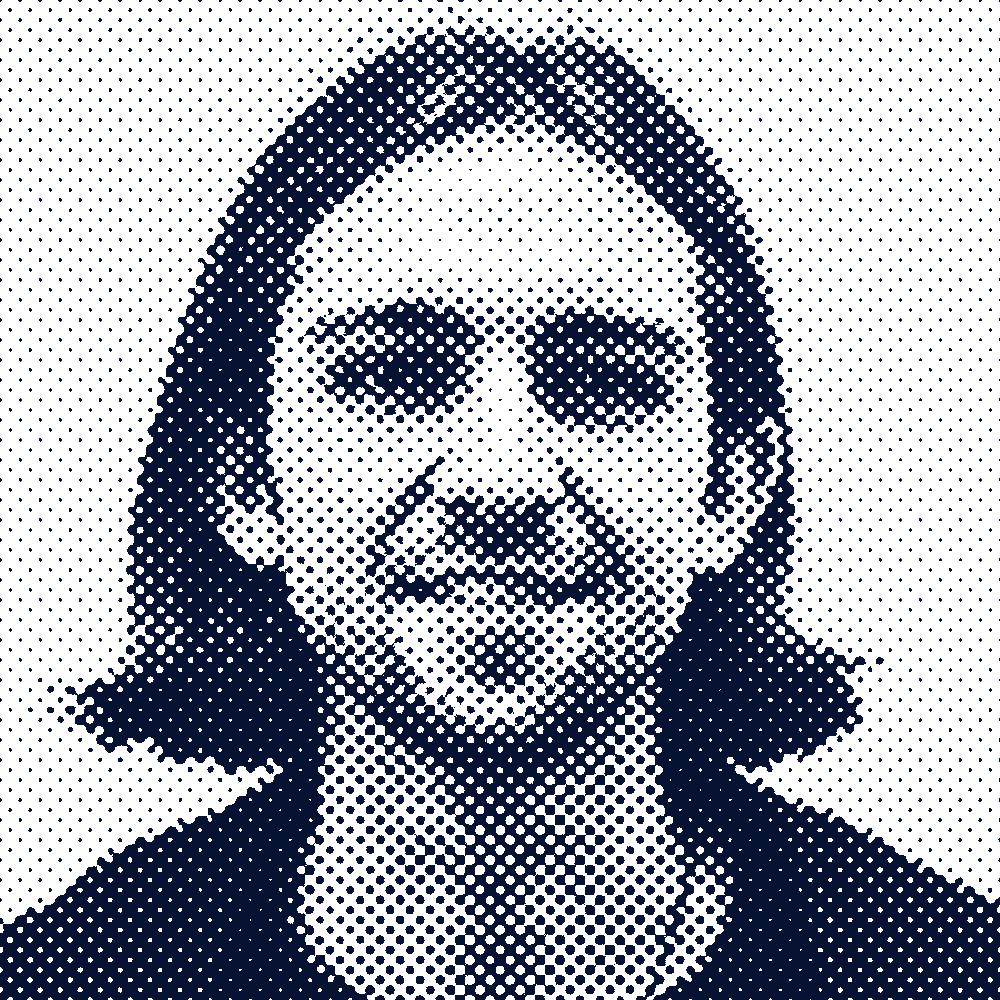Gendersprache verbieten und Regenbogenflaggen von Regierungsgebäuden verbannen. Einer respektierten Juristin die Wahl zur Richterin am Bundesverfassungsgericht nach einer rechtskonservativen Kampagne verweigern. Das erste Mal eine Parlamentsmehrheit mit Rechtsextremisten herstellen. Und ganz oben, an der Spitze ein Kanzler, der vor zwei Jahren Migranten als „kleine Paschas“ bezeichnet.
Was genau tut die Union da? Vollzieht sie eine längst überfällige Kurskorrektur nach rechts? Oder wird sie Teil eines globalen rechtspopulistischen Projekts zusammen mit Trump, Orbán oder Netanjahu, das die Demokratie aushöhlt? Solche Fragen erreichen uns in der Redaktion immer wieder.
Die Frage birgt Zündstoff, weil sie nicht eindeutig wie eine Matheaufgabe zu beantworten ist. Die politische Linke warnt seit Jahren vor einer autoritären Union. Auch bei uns sind Texte erschienen, die das tun. Die Verteidiger:innen der Union sagen: Alles halb so wild, sie macht bloß wieder konservative Politik.
Beides kann nicht gleichzeitig wahr sein. Es ist Zeit für eine nüchterne Bestandsaufnahme. Dafür habe ich mir die Argumente beider Seiten angeschaut: Was stimmt? Wo haben sie einen Punkt? Am Ende fasse ich diese Recherche zusammen und ziehe ein Fazit.
Die Union als Rechtstreiber: Was dafür spricht⬆ nach oben
Die Not der Union
Die Union befindet sich in einer Zwickmühle. Im Wahlkampf hat sie eine Politikwende nach rechts versprochen. Jetzt regiert sie und muss Kompromisse mit linken Parteien eingehen.
Währenddessen macht die AfD Druck von rechts. Dafür hat sie ausreichend Stoff: Noch bevor die Koalition stand, hat die Union ihr größtes Wahlversprechen gebrochen, die Einhaltung der Schuldenbremse. Die AfD könnte nun behaupten: Die Union hat euch einen Politikwechsel versprochen, aber da kommt nichts. Sie koaliert mit den linken Altparteien, bricht ihre Versprechen und betreibt sozialdemokratische Politik. Ein paar Zurückweisungen an der Grenze sind keine Migrationswende. Einen echten Politikwechsel gibt es nur mit der AfD.
„Diese Situation reibt die Union auf“, sagt der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher von der Goethe-Universität Frankfurt. Er beobachtet eine wachsende Frustration in der Union. Viele Mitglieder würden gern konservativere Politik machen, um ihre Wählerschaft zufriedenzustellen. Doch das sei nicht möglich, wenn man mit der SPD oder den Grünen zusammenarbeite.
Es gibt Kräfte in der Union, die sagen: Das wird die Partei zugrunde richten. Denn diejenigen, die eine wirkliche konservative Politikwende wollen, könnten sich langfristig zur AfD wenden.
Um das zu verhindern, betreibt die Partei einen provokanten Kulturkampf. Sie produziert Schlagzeilen, die ihre rechtskonservative Wählerschaft abholen sollen und öffnet so dem Rechtsruck die Tür.
Kulturkampf ist leichter als echte Politik
Kulturkampf ist der Treibsand, in dem der Konservatismus untergeht, je heftiger er um sich tritt. In Deutschland tut er das seit Monaten: Ministerin Karin Prien verbannt das Gendern aus dem Bildungsministerium. Julia Klöckner verbietet der Bundestagsverwaltung die Teilnahme am Christopher Street Day und untersagt das Hissen der Regenbogenflagge – in einer Zeit, in der die Angriffe auf Homosexuelle und Pride-Veranstaltungen zunehmen. Die Unionsfraktion macht mit einer kleinen Anfrage im Bundestag Stimmung gegen zivilgesellschaftliche Organisationen.
Die Liste an Beispielen könnte weitergehen. Doch die Motivation hinter dem Kulturkampf der Union wirkt klar. Es ist leichter, Gendersternchen zu verbieten, die Zivilgesellschaft zu attackieren und Regenbogenflaggen zu verbannen, als die großen Probleme der Bundesrepublik anzugehen: marode Schulen, Energiewende, Fachkräftemangel, Rentenreform.
Mit Kulturkampf fühlt es sich immerhin an, als ob etwas passiert.
Aber die eigene Anhängerschaft merkt irgendwann, dass bis auf Provokationen nichts passiert. Die Parteispitze muss die Enttäuschten dann auffangen – mit noch mehr Kulturkampf. Es folgt ein permanentes Aufpeitschen gegen den herbeifantasierten Gegner (auf den man gleichzeitig angewiesen ist, um Mehrheiten herzustellen). Gleichzeitig haben zahlreiche Studien gezeigt: Wer die Themen und Narrative von Rechtsextremisten übernimmt, macht diese groß, legitimiert ihre Positionen und stärkt sie am Ende.
Es gibt Kräfte in der Union, die die Partei nach rechtsaußen rücken wollen
Julia Klöckner schrieb Anfang 2025 auf Instagram an AfD-Wählende: „Für das, was Ihr wollt, müsst Ihr nicht AfD wählen. Dafür gibt es eine demokratische Alternative: die CDU.“ Carsten Linnemann forderte zeitgleich: „Das Nazi-Bashing gegen die und das Brandmauergerede müssen aufhören.“ Der Historiker und rechtskonservative CDU-Vordenker Andreas Rödder bezeichnete die Brandmauer als einen „eisernen Käfig, in dem das links-grüne politische Lager die Union […] in babylonische Gefangenschaft genommen hat.“
Es gibt Politiker:innen in der Union, die mit der AfD flirten. Zuletzt standen sie im Scheinwerferlicht, als die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf an das Verfassungsgericht scheiterte. Eine der prominentesten Gegenstimmen der Juristin war die CDU-Abgeordnete Saskia Ludwig. Die Brandenburger Politikerin war früher Mitglied der Werte-Union und warb schon vor der Bundestagswahl für eine Koalition mit der AfD. Anfang August traf sie bei einem Festival einer rechten Denkfabrik in Ungarn AfD-Chefin Alice Weidel. Ludwig ist in ihrer Partei in der Minderheit. Aber sie hat es nach einer ultrarechten Kampagne bei der Wahl von Brosius-Gersdorf geschafft, dass diese Minderheit gegen den Willen der Parteispitze das politische Geschehen bestimmt.
Solche Manöver, um die Partei nach rechts zu rücken, dürften während der Amtszeit von Merz zunehmen. Denn Merz ist ein schwacher Unions-Kanzler. Das zeigte der erste Wahlgang der Kanzlerwahl. Correctiv schrieb im Februar 2025: „Ein bestimmter Kreis von Personen treibt den Rechtsruck der Partei voran: aggressiv, Social-Media-affin, im Ton der AfD nahe – und überwiegend recht jung. Sie sind bestens vernetzt und agieren nicht direkt aus der Partei, sondern aus einem Schnittbereich von Parteinähe, Lobby und Thinktanks.“ Dieser Personenkreis könnte die Union in Richtung AfD führen.
Die Union als Rechtstreiber: Was dagegen spricht⬆ nach oben
Kulturkampf ist Symbolpolitik – und eine legitime Auseinandersetzung um Werte
„Eine Regenbogenflagge nicht auf dem Reichstag zu hissen, ist noch kein großer Schritt nach rechts“, sagt der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher. Denn Kulturkampf ist Symbolpolitik. Es geht darum, Zeichen zu setzen, weil man sich schwer tut, wirklich andere Politik zu machen.
Ähnlich argumentiert der rechtskonservative CDU-Vordenker Andreas Rödder. Er sagt: „Politik ist immer auch Kampf und Kultur immer auch Gegenstand von Auseinandersetzung.“ Kulturkämpfe halte er für einen „ganz regulären und normalen Gegenstand demokratischer Politik“. Erstens stehen hinter politischen Projekten und Gesetzen immer Werte. Egal, ob Grenzkontrollen oder Mietpreisbremse. Und über diese Werte müsse man streiten, fordert Rödder.
Zweitens sagt er: Die Union dürfe sich auf Dauer nicht permanent verrenken und Politik mit Parteien machen, mit denen sie programmatisch nichts gemein habe. Sie muss konservative Politik machen. Wenn eine Regierung nur das Ziel zusammenhält, die AfD zu verhindern, ist das langfristig keine Voraussetzung, um gute Politik zu machen. Solche Zweckgemeinschaften können die enttäuschte Wählerschaft geradewegs in die Arme der AfD treiben. Der einzige Ausweg für Rödder aus dem Dilemma: Eine Union, die auch rechtskonservative Positionen vertritt und vor Kulturkampf-Debatten keine Angst hat – dabei aber immer das Grundgesetz und die freiheitlich-demokratische Grundordnung respektiert.
Biebricher sagt: „Die Union muss Bilder produzieren und sichtbare Akzente setzen, weil sie schon vor dem Regierungsantritt ein Wahlversprechen gebrochen hat“.
So deutet er auch die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen, die laut des Verwaltungsgerichts Berlin rechtswidrig sind. Sie produzieren Schlagzeilen – trotz hoher Kosten für tausende Extra-Einsatzkräfte und mäßiger Wirksamkeit: In den ersten Monaten hat die Bundespolizei lediglich 311 Asylsuchende zurückgewiesen. Die Bundesregierung hält dennoch an den Grenzkontrollen fest. Sie inszeniert das als Migrationswende.
Das kann man kritisieren. Aber es ist kein Versuch, die Institutionen der Demokratie umzubauen. Wer Symbolpolitik und Kulturkampf verfolgt, schafft noch keine illiberale Demokratie. Das Verbieten von Gendersternchen ist noch kein Versuch, den Einfluss der Gerichte, des Parlaments oder des Bundesverfassungsgerichts auf die Politik einzuschränken. Es ist der Versuch, der Wählerschaft Handlungsfähigkeit vorzugaukeln und Debatten über Lebensentwürfe und Kultur zu führen. Das ist provokant, aber legitim.
Nur eine Minderheit der Union will mit der AfD zusammenarbeiten
Ja, es gibt Kräfte in der Union, die mit der AfD flirten und das Ende der Brandmauer fordern. Aber diese Leute sind eine verschwindend kleine Minderheit. Die aktuellen Spitzenpolitiker der Union – Friedrich Merz, Thorsten Frei, Carsten Linnemann, Jens Spahn – sind Demokraten. Sie mögen zuspitzen und provozieren, sie mögen die Grenzen des Sagbaren verschieben und Linke und Grüne zur Weißglut treiben wollen. Aber das ist ihr gutes Recht. Das ist ihre Aufgabe als Konservative. Das müssen all jene, die politisch links von ihnen stehen, aushalten.
„Es gibt keine CDU-Politiker in prominenter Position, die den Plan verfolgen, die Union systematisch in den Rechtsautoritarismus zu führen“, sagt auch Politikwissenschaftler Thomas Biebricher. Die Führungsriege der Partei wisse, wie gefährlich die AfD für die Union ist. Eine Zusammenarbeit mit der AfD würde die CDU „umbringen“, sagte Friedrich Merz vergangenes Jahr. „Wir dürfen denen, die uns politisch beseitigen wollen, nicht noch die Hand reichen.“
Selbst Andreas Rödder, Vordenker einer Rechtsaußen-CDU, forderte zuletzt eine „intellektuelle Auseinandersetzung mit der neuen Rechten.“ Und wer die AfD-Nähe der CDU-Abgeordneten Saskia Ludwig kritisiert, muss auch erwähnen, dass die Union sich nach ihrem Treffen mit Alice Weidel sofort von Ludwig distanzierte.
Die Stimmung im Land ist nach rechts gerückt
Im August 2015 sagten 60 Prozent der Deutschen, das Land könne die große Menge an Geflüchteten verkraften. Zehn Jahre später halten die Deutschen Migration für das wichtigste Problem der Gegenwart. Das ist Ausdruck einer größeren Entwicklung: Die Stimmung in Deutschland ist in den vergangenen Jahren konservativer geworden. Das Land rückt nach rechts, die Nachfrage nach konservativer Politik steigt. Die Union muss auf diese Nachfrage reagieren. Sonst tut die AfD es.
So betrachtet reagiert die Union aktuell lediglich auf einen – Achtung, Politiksprech! – Hegemoniewechsel: Es gibt Positionen, die rechts oder konservativ und in einer Demokratie legitim sind, die lange aber nicht gern gesehen waren in Deutschland. Das ändert sich jetzt.
Der Politikwissenschaftler Giovanni Capoccia untersuchte Anfang der 2000er Jahre, warum manche Demokratien in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts überlebten und der extremistischen Versuchung widerstanden. Seine Forschung zeigt: Entscheidend waren die großen Parteien, die eine Brandmauer gegen radikale Kräfte errichteten. Blieben sie standhaft, konnte die Demokratie fortbestehen.
Daraus folgt zweierlei. Erstens: Damit die Demokratie in Deutschland überlebt, braucht es eine Union mit einer intakten Brandmauer. Zweitens: Damit die Brandmauer hält, muss die Partei nach rechts rücken. Sie muss all jene auffangen, die sonst zur noch rechteren AfD abwandern würden.
Meine Einschätzung⬆ nach oben
Ein Blick in die Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt: Um an die Macht zu kommen brauchen Rechtsextreme die Unterstützung der Konservativen. Der gleiche Blick zeigt aber auch: Um zu überleben, braucht die Demokratie die Unterstützung der Konservativen.
Die Zukunft der Demokratie in Deutschland hängt also von der Union ab, die seit einigen Jahren nach rechts rückt, provoziert und Kulturkampf betreibt.
Aber es ist wichtig, das als das einzuordnen, was es ist. Manchmal ist es Symbolpolitik. Manchmal ist es der Versuch, Handlungsfähigkeit vorzutäuschen. Und manchmal das legitime Anliegen, konservative und rechte Positionen zu vertreten.
Klar, das kann gefährlich werden: Kulturkampf führt zu mehr Kulturkampf. Wer permanent Anerkennungskämpfe befeuert, um die eigene politische Handlungsunfähigkeit zu vertuschen, bringt die Demokratie und ihre Institutionen in Verruf. Er macht Themen groß, mit denen die AfD wirbt und stärkt sie so. Und deren Plan, um an die Macht zu kommen, baut genau auf dieses Vorgehen.
Laut eines aktuellen Strategiepapiers der Partei ist der Kulturkampf eines von drei Instrumenten, um die Brandmauer einzureißen. Die AfD will, dass sich die Gräben zwischen den demokratischen Parteien vertiefen. Sie setzt darauf, dass Linke, SPD und Grüne weiter nach links rücken – und so der Druck auf die Union steigt, sich für die AfD zu öffnen. Das soll der einzig vermeintliche Ausweg sein, um rechte oder konservative Politik in Deutschland zu machen.
Diese Strategie und die Gefahr des Kulturkampfes muss die Union berücksichtigen. Aber aktuell spricht nichts dafür, dass CDU/CSU ernsthaft daran arbeiten, Deutschland nach dem Vorbild Viktor Orbáns oder Donald Trumps umzubauen. Im Gegenteil.
Progressive sehen jede konservative Provokation als Ausweis einer beginnenden autoritären Machtübernahme: Markus Söders permanente Sticheleien gegen die Grünen, Genderverbote von CDU-Landesregierungen, oder ein Lob von Jens Spahn für Donald Trump. Dabei ignorieren sie Gegenargumente. Welche Beweise würden sie dafür akzeptieren, dass die Union aktuell nicht die Demokratie gefährdet? Wenn CDU/CSU linke Positionen vertreten? Das ist absurd.
Die Frage, ob die Union in den Autoritarismus abrutscht, ist deshalb selbst interessanter als meine Antwort. Sie ist Ausdruck eines großen Misstrauens gegenüber der CDU/CSU. Und zeigt, wie der Rechtsruck der Union zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird: Je lauter und empörter der Aufschrei über konservative Identitäts- und Symbolpolitik, desto mehr drängt man die Union in Richtung AfD. Wer ein Genderverbot als Ausdruck einer autoritären Übernahme sieht, verkennt das Recht einer konservativen Partei, konservative und auch rechte Politik zu machen.
Der Soziologe Steffen Mau sagt über die Union: „Wo programmatische Leere herrscht, wird eine Partei anfällig für den Sirenengesang des Kulturkampfs.“
Vielleicht gilt der Satz aber nicht nur für die Union, sondern auch für die politische Linke in Deutschland: Wo Inhalte fehlen, wird eine Partei besessen von Provokationen des politischen Gegners – und nutzt das Heraufbeschwören einer vermeintlichen Faschistisierung der Union als letztes Argument für die eigene Wahl.
Auch das ist genau die Situation, die die AfD herstellen will.
Redaktion: Rico Grimm, Schlussredaktion: Astrid Probst, Bildredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: synthetische Stimme