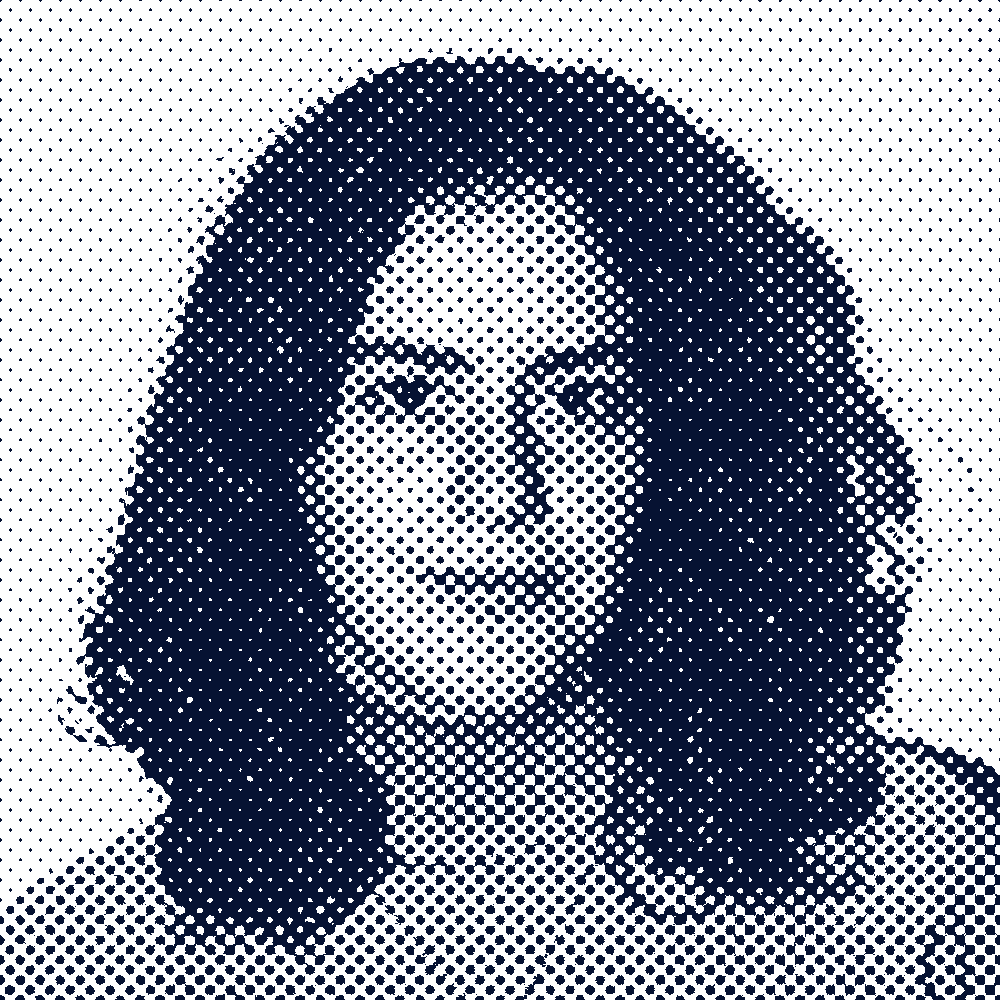Es kommt selten vor, dass ein Politiker die Wahlen gewinnen könnte, obwohl er nicht besonders sympathisch wirkt und seine Inhalte nur wenige interessieren.
Péter Magyar könnte genau das gelingen. Der 44-Jährige ist innerhalb kurzer Zeit zum größten Herausforderer von Ministerpräsident Viktor Orbán geworden. Magyars Partei „Tisza“ liegt in Umfragen schon das ganze Jahr über mehrere Prozentpunkte vor Orbáns Fidesz-Partei.
Ungarn ist korrupt und autokratisch, der große Störenfried in der EU. Es wirkte lange Zeit so, als würde sich daran nichts ändern. Orbán regiert schließlich seit 15 Jahren und nutzte diese Zeit, um Medien und Opposition in ihrer Arbeit einzuschränken. Manche befürchten, dass Ungarn ein Vorreiter ist in einem Europa, das immer weiter nach rechts rückt.
Doch der rasante Aufstieg von Péter Magyar und seiner Partei zeigen, dass sich auch in scheinbar gefestigten Regimen jederzeit etwas ändern kann. Im April 2026 sind Wahlen in Ungarn. Noch vor zwei Jahren hätte es niemand für möglich gehalten, dass eine andere Partei als Orbáns Fidesz die Wahlen gewinnen kann. Das sieht jetzt anders aus.
Wie sich Magyar in die Öffentlichkeit katapultierte⬆ nach oben
Alles begann im Februar 2024. Damals erschütterte eine Enthüllung die ungarische Öffentlichkeit: Die Präsidentin Ungarns, Katalin Novák, und Justizministerin Judit Varga hatten einen Mann begnadigt, der dabei geholfen hatte, sexuellen Missbrauch in einem Waisenhaus zu vertuschen. Als das öffentlich wurde, traten die beiden zurück.
Die Begnadigung an sich wäre in jedem Land ein Skandal. In Ungarn hat es ein besonderes Geschmäckle, denn Orbán und seiner Fidesz-Partei sind Kinder sehr wichtig. Zumindest behaupten sie das von sich selbst, um vermeintlichen Kinderschutz dazu zu benutzen, die Rechte queerer Menschen einzuschränken.
Seit 2021 gibt es ein Gesetz, das den Verkauf von Kinderbüchern einschränkt, die sich mit Homosexualität oder Transgeschlechtlichkeit befassen. Zum Beispiel dürfen Buchhandlungen ein Kinderbuch nicht offen auslegen, wenn darin ein schwules Paar vorkommt. In einem Umkreis von 200 Metern um Schulen und Kirchen darf so ein Buch nicht einmal verkauft werden. Die Pride Parade Ende Juni wollte Orbán auch verbieten, offiziell wegen „Kinderschutz“.
Dieser Skandal zeigte für viele Menschen in Ungarn, dass sich Orbán und seine Leute nur dann an ihren Werten orientieren, wenn es ihnen passt. Selbst diejenigen, die ihn unterstützen, müssen sich verraten gefühlt haben.
Noch im Februar veröffentlichte Magyar einen Post auf Facebook, in dem er ankündigte, von seinen Posten in staatlichen Unternehmen zurückzutreten. Er wolle nicht eine Minute länger Teil dieses Systems sein, schrieb er. Der Post hat mehr als 30.000 Likes. Magyar war nämlich bis 2023 mit Judit Varga verheiratet, der Justizministerin, die zurücktreten musste. An ihrer Seite war er viele Jahre lang in den einflussreichen Kreisen Ungarns unterwegs. Er war zwar längst nicht so bekannt wie seine Frau, profitierte aber trotzdem von lukrativen Jobs.
Kurz nach seinem Facebook-Post gab er dem unabhängigen Youtube-Medium „Partizán“ ein Interview, in dem er die Orbán-Regierung und die Korruption im Land heftig kritisierte. Das Video hat inzwischen 2,7 Millionen Aufrufe. Zum Vergleich: Ungarn hat zehn Millionen Einwohner:innen.
„Die Erzählung ist, dass er eine bequeme Position im System aufgegeben hat“, sagt Gergely Rajnai, Politikwissenschaftler am „Centre for Fair Political Analysis“, einem Thinktank in Budapest. Es gebe Magyar Glaubwürdigkeit, dass er den Machtzirkel rund um Orbáns Regierung verlassen habe.
Das war der große Knall, mit dem sich Magyar in die Öffentlichkeit katapultierte. Er übernahm den Vorsitz einer kleinen Partei namens Tisza, weil keine Zeit blieb, eine neue Partei zu gründen. Tisza erreichte bei den Europawahlen fast 30 Prozent. Dieser Erfolg bedeutet zwar nicht automatisch, dass Tisza die Wahlen im kommenden Jahr gewinnen kann, aber es ist so wahrscheinlich wie lange nicht mehr, dass Orbán die Wahlen verliert.
Seitdem tourt Magyar durch das Land, meist in Hemd und Krawatte, und versucht, Wählerstimmen zu sammeln. Entscheidend sind nämlich nicht die ohnehin Oppositionellen, die häufig in Budapest leben. Sondern konservative Menschen auf dem Land, die früher Fidesz gewählt haben. Magyar muss es schaffen, die Unzufriedenheit im Land zu nutzen. Und die reicht tief.
Das Klopapier steht symbolisch dafür, was in Ungarn alles schiefläuft⬆ nach oben
Es ist fünf vor sieben an einem Mittwochmorgen. László Gárdonyi steuert sein Auto durch das Zentrum von Budapest. Der 38-Jährige fährt zu einem „Zebra-Streik“, der seit zwei Jahren jede Woche stattfindet, ein lose organisierter Protest von Lehrer:innen und Eltern. Lászlós Sohn wird im September eingeschult und wie alle Eltern muss auch er dafür sorgen, die Schule in Schuss zu halten. Deshalb müsse er zum Beispiel die Wände des Klassenzimmers streichen oder sich um das Klopapier auf den Toiletten kümmern. „In Krankenhäusern ist das auch so“, sagt er.
Kein Klopapier in Schulen und Krankenhäusern, während Orbán und seine Clique extremen Reichtum anhäufen. Viele Kritiker:innen nennen Lőrinc Mészáros als Beispiel, ein Jugendfreund von Orbán, der doppelt so viel Geld hat wie die Popsängerin und Milliardärin Taylor Swift. Mészáros gründete 1990 ein Gasinstallationsunternehmen und wurde dank Regierungsaufträgen reich. Gleichzeitig ist der Lebensstandard in Ungarn gesunken, die Währung schwächelt, die Preise steigen. Für viele ein Zeichen, dass es mit Orbán so nicht mehr weitergehen kann.
Deshalb protestiert László mitten in Budapest, auf dem Ferenciek tere, dem Franziskanerplatz. Er begrüßt das knappe Dutzend Leute, das heute gekommen ist, schnappt sich ein Schild, auf dem „I stand with Ukraine“ steht und dann geht es los.
Sobald die Ampel für Autos auf Rot springt, läuft das Grüppchen über den Zebrastreifen. In der Hand halten sie verschiedene Plakate, die meisten hat ein Kunstlehrer gebastelt, und ein Banner mit der Aufschrift „Orbán und seine Oligarchen plündern EUCH aus!“ Knapp sieben Sekunden stehen sie dort, ein paar Autofahrer:innen hupen zustimmend, dann springt die Ampel wieder um und das Grüppchen läuft zurück zum Straßenrand. So geht es eine knappe halbe Stunde lang.

©Isolde Ruhdorfer
László ist gegen die Orbán-Regierung und will deshalb bei den kommenden Wahlen für die Tisza-Partei von Magyar stimmen. An dem Gurt, mit dem er sich eine Bluetooth-Box umgeschnallt hat, hat er einen Button der Tisza-Partei befestigt. Er zeigt ein Unendlichkeitszeichen in den Farben Rot und Grün, zusammen mit dem weißen Hintergrund ergibt das die Nationalfarben Ungarns.
„Ich bin nicht wirklich ein Magyar-Fanboy“, sagt László. So etwas sei generell ungesund in der Politik. Doch auch wenn es keine Garantie dafür gebe, „bin ich fest davon überzeugt, dass sie unter den derzeitigen Umständen unsere beste Chance für einen friedlichen Übergang weg von der Fidesz-Herrschaft sind.“
So etwas Ähnliches höre ich immer wieder, beispielsweise auf einer Demonstration gegen die Einschränkung von Meinungsfreiheit. „Ich glaube, dass er Narzisst ist“, sagte ein Demonstrant über Magyar. Trotzdem werde er ihn wählen.
So sind Magyar und seine Parteikolleg:innen drauf⬆ nach oben
Vor ein paar Jahren, als Péter Magyar und die damalige Justizministerin Judit Varga noch verheiratet waren, luden sie ein befreundetes Paar zu sich nach Hause ein. Das Gespräch drehte sich irgendwann um Politik. Magyar und seine Frau waren sich in einem Punkt uneinig. Sie begannen so sehr zu streiten, dass es den Gästen peinlich war und sie gingen.
So berichtet es „Direkt36“, ein ungarisches Investigativmedium. Sie sprachen mit fast 40 Weggefährt:innen von Péter Magyar, um dessen Charakter und Entscheidungen über die Jahre nachzuvollziehen. Aus den vielen Erzählungen ergibt sich, dass Magyar ziemlich streitlustig ist und sich nie mit Kritik zurückhält – auch nicht an Fidesz-Politiker:innen. Einmal soll er sich so abfällig und persönlich über einen Fidesz-Politiker geäußert haben, dass es fast zu Gewalt gekommen sein soll.
Péter Magyar stammt aus einer konservativen Familie, und die meisten Medien bezeichnen ihn als „mitte-rechts“. Doch auch Politikwissenschaftler:innen fällt es schwer, Tisza in ein politisches Lager einzuordnen. Auf der Website der Partei sind 21 Punkte aufgelistet: Tisza will die Renten erhöhen, Pflegepersonal und Sozialarbeiter:innen besser bezahlen, die Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse auf fünf Prozent herabsetzen oder ein günstiges Steuersystem für kleine und mittlere Unternehmen einführen. Also Forderungen, die bei den meisten Menschen in Ungarn populär sein dürften.
„Wenn Sie etwas sehr Ideologisches sagen, könnten Sie einige Ihrer potenziellen Wähler verprellen“, erklärt Politikwissenschaftler Rajnai. Wahrscheinlich versucht Magyar aus den Fehlern des Oppositionskandidaten der vergangenen Wahlen zu lernen. Der vertrat überzeugt libertäre Positionen – und verlor. Magyar dagegen scheint sich zu bemühen, nicht anzuecken.
Er positioniert sich vor allem zu Themen, die populär sind, etwa Kritik an Orbán oder Korruption. Im März organisierte Tisza ein nationales „Referendum“, bei dem Wähler:innen mehrere Fragen beantworten sollten. Als Magyar diese Befragung ankündigte, stellte er auch einige inhaltliche Punkte vor. Zum Beispiel: „Wir werden null Toleranz gegenüber allen Formen von Korruption erklären.“ Oder: „Wir werden die Unabhängigkeit der Justiz wiederherstellen.“
Auch die Fragen gehen in diese Richtung. Etwa: „Sind Sie der Meinung, dass ein Ministerpräsident bis zu zwei Amtszeiten, höchstens jedoch acht Jahre, im Amt sein sollte?“ Viktor Orbán ist schon die vierte Amtszeit in Folge Ministerpräsident. Die Frage bekam wie die meisten anderen mehr als 90 Prozent Zustimmung.
Péter Magyar selbst hatte keine Zeit für ein Interview mit mir. Genauso wenig wie andere Tisza-Politiker und die Organisatoren von Ortsgruppen, sogenannte Tisza-Inseln. Das ist wahrscheinlich Teil der Strategie, keine Fehler zu machen und für viele Menschen „wählbar“ zu bleiben.
Dass er sich bei seinen Äußerungen an der öffentlichen Meinung orientiert, verdeutlicht seine Haltung zu Russland und vor allem zur Ukraine. Denn die ist für Péter Magyar heikel. Zwar spricht er sich klar für die EU aus. Doch vor allem den Russland-Ukraine-Krieg behandelt er mit einiger Vorsicht. Er kritisiert eindeutig Russland, äußert sich aber auch kritisch zur Ukraine.
Bei dem „Referendum“, das Magyar im März durchführte, bekam die Frage, ob die Ukraine der EU beitreten sollte, weniger als 60 Prozent Zustimmung, deutlich weniger als alle anderen Fragen. Vermutlich deshalb spart Magyar das Thema weitgehend aus.
Um wirklich konkrete Inhalte geht es aber wahrscheinlich sowieso nicht. „Ich glaube nicht, dass sich viele Wähler viel aus der Politik machen“, sagt Politologe Rajnai. „Es geht nur darum, ob das System geht oder bleibt.“
Was der Tech-Millionär dazu sagt⬆ nach oben
Um besser zu verstehen, was genau diese Wahl für oder gegen das System bedeutet, habe ich mit Gábor Bojár gesprochen. Bojár ist Unternehmer, der noch zu sozialistischen Zeiten die Softwarefirma „Graphisoft“ gegründet hat. Der 76-Jährige ist gerade auf Geschäftsreise in New York und willigt spontan in ein Videotelefonat ein. Er lächelt freundlich in die Kamera und rollt das R, wenn er Englisch spricht.
Bojár hat kurz vor unserem Gespräch einen Kommentar für das ungarische Wirtschaftsmagazin „HVG“ verfasst, in dem er schrieb, dass man Magyar nicht mögen, ja ihm nicht einmal zustimmen müsse. Aber man ihn trotzdem wählen sollte.
„Magyar hat nur einen Programmpunkt, nämlich die Wahl gegen Orban zu gewinnen“, sagt Bojár, „alles andere ist zweitrangig.“ Viktor Orbán werde Ungarn früher oder später aus der EU herausführen, erklärt er mir. „Das wäre ein historisches Verbrechen gegen diese Nation und wir müssen alles tun, um das zu verhindern“, sagt er. „Das ist meine Mission.“
Europa versus Russland, darin sieht Bojár die entscheidende Frage. Als Unternehmer beurteilt er die EU ausnahmslos positiv und auch persönlich fühlt er sich mit Europa verbunden. Der Tag, als Ungarn der EU beitrat, sei einer der besten seines Lebens gewesen, sagt er. „Ich möchte kein Verbündeter für Russland, für Putin sein“, sagt Bojár. Er habe die ersten 40 Jahre im kommunistischen System verbracht. „Ich möchte nicht in diese Zeit zurückkehren.“
Was passiert, sollte Magyar Erfolg haben, weiß niemand. Magyar könnte sich als unfähig herausstellen oder so wie Orbán seine Macht ausnutzen. Niemand, mit dem ich geredet habe, war der Meinung, dass unter Péter Magyar automatisch alles besser wird. Schließlich war auch Orbán am Anfang ein beliebter Politiker.
Die Menschen in Ungarn betrachten die Lage nicht naiv. Aber auch nicht resigniert. Denn zum ersten Mal seit langer Zeit könnte sich etwas ändern.
Redaktion: Rebecca Kelber, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert