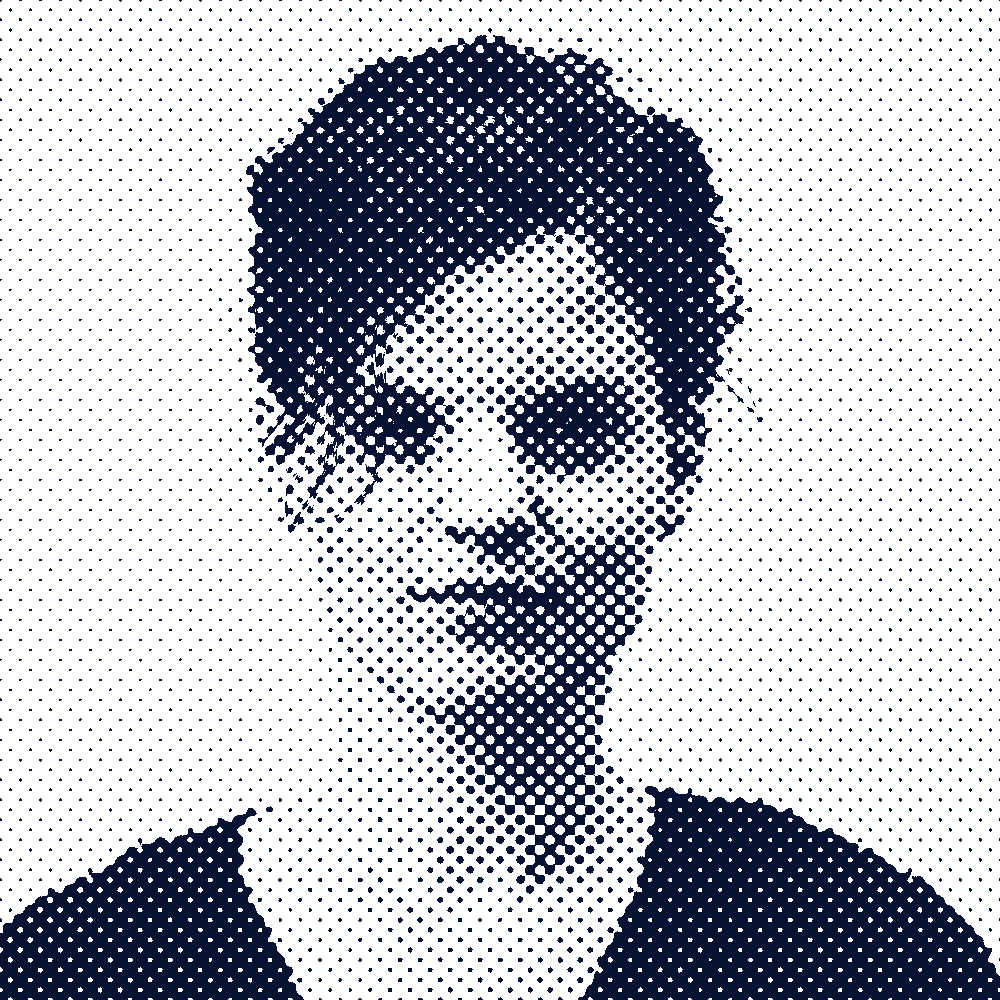Im Juli 2025 haben Ugandas Gerichte eine Klage abgewiesen, die Polygamie für unrechtmäßig erklären sollte. Als Begründung reichte ihnen der Verweis auf Religions- und Kulturfreiheit. Für viele Sozialwissenschaftler:innen und Politiker:innen, die Polygamie schon lange als „schädliche kulturelle Praxis“ sehen, war das frustrierend, wenn auch kaum überraschend. Für sie ist die Entscheidung ein Rückschlag auf dem Weg zu sozial stärkeren und gerechteren Gesellschaften.
Polygamie bedeutet in den meisten Fällen, dass ein Mann mehrere Ehefrauen hat. Genauer gesagt handelt es sich dabei um Polygynie – ein Begriff, der sich aus den griechischen Wörtern „poly“ (viele) und „gynē“ (Frau oder Ehefrau) ableitet. Die seltene umgekehrte Form, bei der eine Frau mehrere Männer hat, heißt Polyandrie (von „anēr“ für Mann oder Ehemann) und kommt weltweit äußerst selten vor.
Kritiker:innen bringen vor allem zwei Punkte gegen Polygamie ins Spiel. Erstens: Sie verzerrt den Heiratsmarkt und drückt Männer mit niedrigem Status an den Rand, mit Folgen wie mehr Spannungen, Kriminalität und Gewalt gegen Frauen. Zweitens: Sie belastet Frauen und Kinder, weil das Vermögen eines Mannes auf mehr Menschen verteilt werden muss.
Diese Überlegungen haben zum Beispiel die Politikwissenschaftlerin Rose McDermott dazu gebracht, Polygamie als ein Übel zu bezeichnen. Und andere, wie der Anthropologe Joseph Henrich, gehen noch weiter: Für sie hat gerade die christliche Ablehnung der Polygamie einen wichtigen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg westlicher Gesellschaften.
Drei neue Studien, die methodisch sehr sorgfältig gearbeitet sind, widersprechen diesen Argumenten aber deutlich.
Ich selbst habe meine berufliche Laufbahn an der Schnittstelle von Anthropologie und globaler Gesundheit verbracht und untersucht, warum Familien so unterschiedlich aufgebaut sind und was das für das Wohlbefinden der Menschen bedeutet. Viele dieser Arbeiten habe ich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in Tansania durchgeführt, wo Polygamie ähnlich verbreitet ist wie in Uganda. Die neuen Studien bestätigen vieles von dem, was wir dort gesehen haben: Gute Absichten und Bauchgefühl helfen nicht unbedingt, wenn man die kulturellen Hintergründe nicht kennt und keine soliden Fakten hat.
Bleiben Männer unfreiwillig „übrig“?⬆ nach oben
Eine neue Studie, die im Oktober 2025 erschienen ist, liefert die erste wirklich umfassende Analyse dazu, wie Polygamie die Heiratschancen von Männern beeinflusst. Die Untersuchung stammt von dem Demografen Hampton Gaddy und den Evolutionsanthropologinnen Rebecca Sear und Laura Fortunato.
Die Forscher:innen arbeiteten mit demografischen Modellen und einem riesigen Datensatz: mehr als 84 Millionen Volkszählungseinträge aus 30 Ländern in Afrika, Asien und Ozeanien plus die komplette US-Volkszählung von 1880, als Polygamie in manchen Gemeinden noch üblich war. Ihr Fazit: Polygamie sorgt nicht dafür, dass viele Männer unverheiratet bleiben. In vielen Regionen ist es sogar eher so, dass Männer häufiger heiraten, wenn Polygamie verbreitet ist, als in Gegenden, in denen sie selten vorkommt.
Die Vorstellung, dass Polygamie viele Männer als „Überbleibsel“ zurücklässt, wirkt auf den ersten Blick plausibel. Wenn es ungefähr gleich viele Männer und Frauen gibt, scheint es logisch, dass ein Mann mit zwei Frauen einem anderen Mann die Chance nimmt. Überträgt man das auf eine ganze Gesellschaft, wirkt Polygamie schnell wie ein Rezept für viele frustrierte Single-Männer.
Ähnliche Argumente gibt es auch beim Thema Incel, ein Kofferwort aus „involuntary“ und „celibate“, das heißt „unfreiwillig zölibatär“, in monogamen Ländern wie den USA. Dort heißt es, dass Männer mit hohem Status Männern mit niedrigem Status die sexuellen Chancen nehmen und sie frustriert zurücklassen, was am Ende zu Gewalt führen könne.
Das Problem ist: Die tatsächliche Bevölkerungsstruktur ist viel komplexer. Frauen leben im Schnitt länger als Männer, Männer heiraten häufig jüngere Frauen, und in vielen Regionen wächst die Bevölkerung schnell. Dadurch gibt es für ältere Männer oft genug jüngere potenzielle Partnerinnen. Diese Faktoren, die in vielen heutigen afrikanischen Ländern typisch sind, sorgen insgesamt für einen Überschuss an Frauen auf dem Heiratsmarkt. Unter solchen realistischen Bedingungen können viele Männer mehrere Frauen heiraten, ohne dass ihre Altersgenossen leer ausgehen.
Tatsächlich zeigte sich in fast der Hälfte der untersuchten Länder, dass höhere Polygynie-Raten mit weniger unverheirateten Männern verbunden waren, nicht mit mehr. Nur wenige Länder entsprachen dem erwarteten Muster, und selbst dort war es über die Zeit hinweg nicht stabil.
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei historischen Mormonen-Gemeinden in Nordamerika. Als die Forschenden Bezirke mit dokumentierter mormonischer Polygynie mit anderen Bezirken der Volkszählung von 1880 verglichen, fanden sie in den polygynen Regionen weniger unverheiratete Männer. Gaddy und seine Kolleg:innen erklären das damit, dass Kulturen, die Polygynie unterstützen, meist auch kinderfreundlicher und familienorientierter sind und dadurch insgesamt die Heiratsraten in die Höhe treiben.
Bekommen Frauen und Kinder weniger ab?⬆ nach oben
Was ist mit dem Argument, dass Polygynie Frauen und Kindern schadet, weil das Vermögen eines Mannes auf mehr Menschen verteilt wird? Es gibt Studien, die einen Zusammenhang zwischen Polygynie und gesundheitlichen Problemen zeigen. Andere Stimmen halten dagegen: Korrelation ist nicht das Gleiche wie Kausalität.
Vor zehn Jahren haben meine Kolleginnen und Kollegen und ich mehr als 50 tansanische Dörfer verglichen. Dabei zeigte sich zunächst ein Zusammenhang zwischen Polygynie, mehr Ernährungsunsicherheit und gesundheitlichen Problemen bei Kindern. Das lag aber nicht an der Polygynie selbst. Der Effekt entstand, weil Polygynie vor allem in marginalisierten Maasai-Gemeinschaften vorkommt, die in dürregefährdeten Regionen leben und kaum medizinische Versorgung haben. Schaut man innerhalb der einzelnen Gemeinschaften auf die Familien, zeigt sich ein anderes Bild: Polygyn geführte Haushalte waren meist wohlhabender – ein wichtiger Grund dafür, dass Frauen diese Eheform wählen, und die Kinder hatten keine Nachteile.
Daran knüpft eine neue Studie der Anthropologin Riana Minocher an. Sie hat dafür Längsschnittdaten aus einer über 20 Jahre laufenden Untersuchung ausgewertet – und bei Tausenden von Kindern keinen Hinweis gefunden, dass eine monogame Ehe ihnen irgendwelche Vorteile bringt.
Zusammengenommen stützen diese Befunde das sogenannte Polygynie-Schwellenwertmodell. Vereinfacht heißt das: Wenn Frauen frei entscheiden können, wen sie heiraten, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie sich auf eine wirtschaftlich nachteilige Ehe einlassen. Sie wählen eher Männer, die genug besitzen, um mögliche Nachteile auszugleichen. Das trifft nicht auf alle Kontexte zu, aber die Studien widerlegen klar die pauschale Behauptung, Polygynie sei grundsätzlich schädlich.
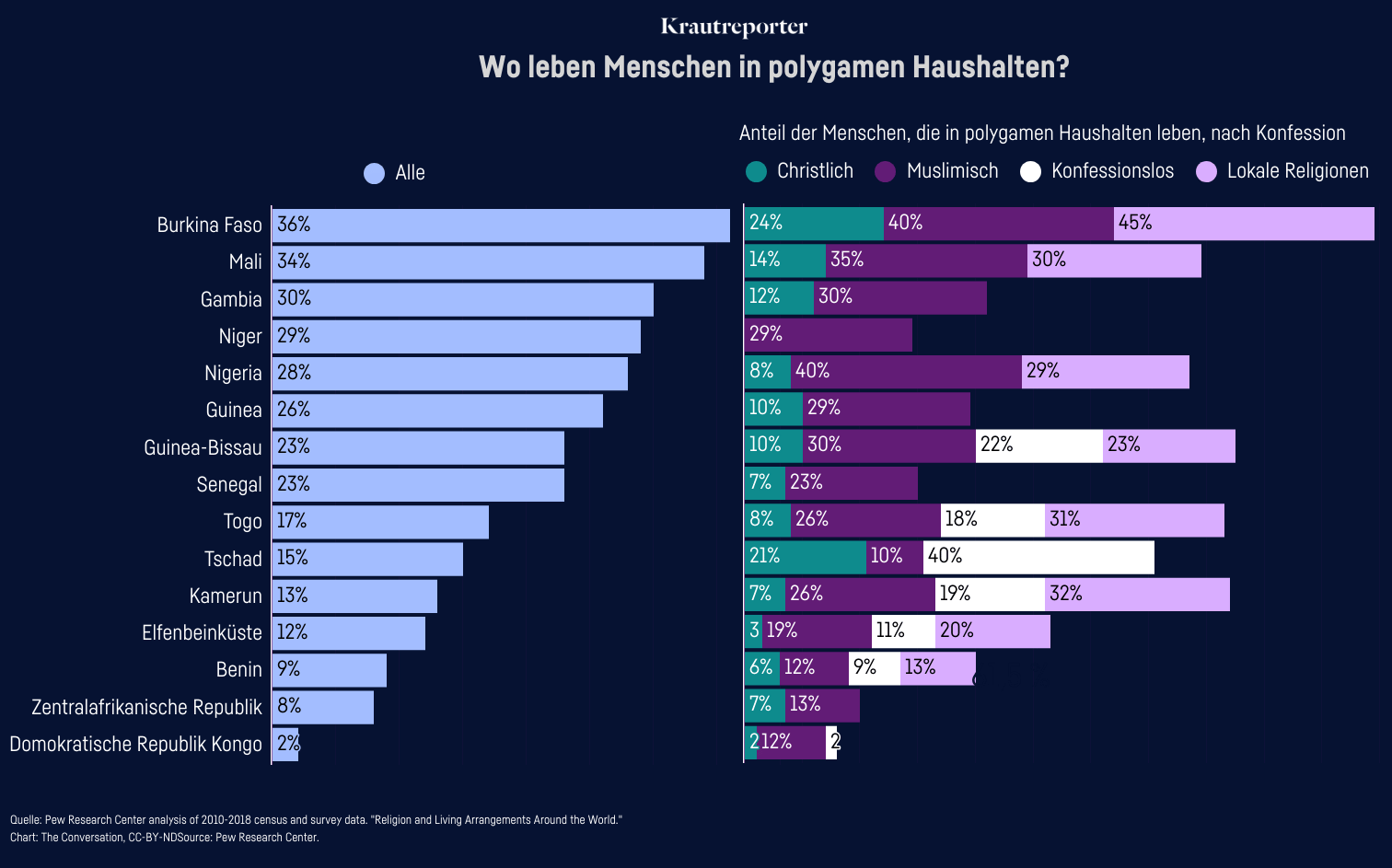
Was Polygamie überraschend gut kann⬆ nach oben
Eine weitere aktuelle Studie des Ökonomen Sylvain Dessy und seinem Team geht noch einen Schritt weiter: Sie legt nahe, dass Polygynie in schwierigen Zeiten unterschätzte Vorteile haben kann.
Für ihre Analyse kombinierten die Forschenden Ertragsdaten von mehr als 4.000 landwirtschaftlichen Haushalten in Mali mit Volkszählungsdaten zu Heiratsmustern und detaillierten Wetteraufzeichnungen. Ihr Ergebnis: In Dörfern, in denen Polygynie selten ist, lassen Dürren die Ernten stark einbrechen. In Dörfern, in denen Polygynie verbreitet ist, fällt der Einbruch deutlich milder aus.
Die Forschenden erklären das so: Polygynie vergrößert die Zahl der angeheirateten Verwandten und schafft damit stabilere Unterstützungsnetzwerke. Da die Ehefrauen oft aus unterschiedlichen Dörfern und Regionen stammen, können ihre erweiterten Familien im Krisenfall leichter Lebensmittel, Geld oder Arbeitskraft schicken, wenn die lokale Ernte ausfällt. Diese Art von Unterstützung macht polygyn lebende Gemeinschaften widerstandsfähiger in Dürrezeiten – und trägt dazu bei, dass sich diese Eheform über Generationen hält.
Ist Polygamie also harmlos?⬆ nach oben
Diese Studien zeigen nicht, dass Polygamie unproblematisch wäre. Es bleibt ungerecht, dass Männer – und nicht Frauen – mehrere Partner:innen haben dürfen. Das ist eindeutig Teil patriarchaler Strukturen. Und neuere Untersuchungen weisen darauf hin, dass polygame Ehen anfälliger für Gewalt in der Partnerschaft sein können.
Kurz gesagt: Es gibt viele mögliche Nachteile.
Die derzeit besten Daten deuten jedoch darauf hin, dass Polygamie kaum die Hauptursache sozialer Unruhen ist. Und in patriarchalen Systemen, in denen Frauen unabhängig vom Familienstand wenig wirtschaftliche und soziale Sicherheit haben, kann Polygamie für einige sogar eine bevorzugte Lösung sein mit echten Vorteilen für beide Seiten.
Vereinfachte Horrorszenarien über Polygamie wirken oft überzeugend, können aber in die Irre führen. Sie verstärken Vorstellungen kultureller Überlegenheit, behindern sinnvolle globale Gesundheitspolitik und lenken von wichtigeren Herausforderungen ab. Wer gesündere Gesellschaften aufbauen will, muss sich an die Daten halten und offen bleiben für die Möglichkeit, dass jede Form von Familienstruktur Schaden anrichten kann.
Dieser Artikel ist zuerst auf Englisch bei The Conversation erschienen. Hier könnt ihr den Originalartikel lesen.
Übersetzung: Theresa Bäuerlein, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Gabriel Schäfer