Als Mitglied hast du Zugriff auf diesen Artikel.
Ein Krautreporter-Mitglied schenkt dir diesen Artikel.
ist Krautreporter-Mitglied und schenkt dir diesen Artikel.
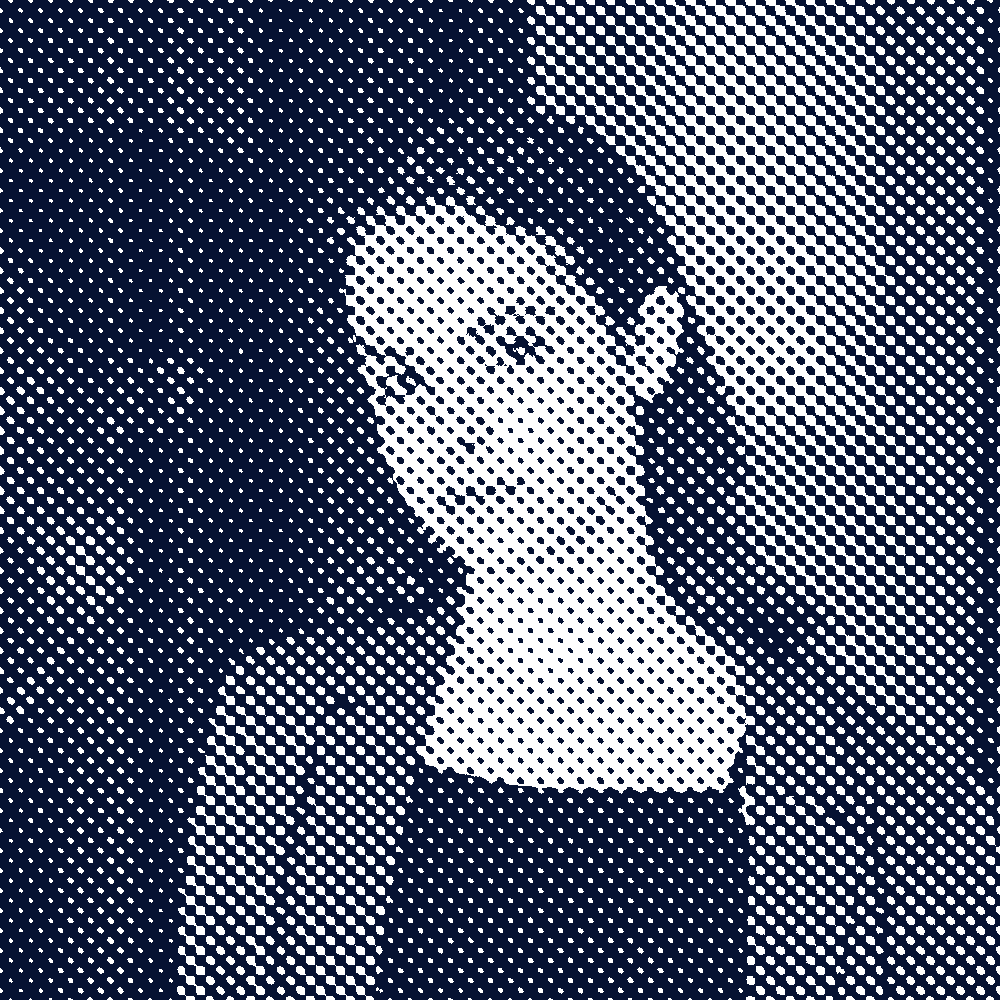
„So, ihr habt jetzt 60 Minuten Zeit“. Wenn ich an diesen Satz denke, erinnere ich mich auch daran, was vor, während und nach diesen 60 Minuten passierte: Viele meiner Mitschüler:innen schliefen schlecht vor den 60-minütigen-Klassenarbeiten. In der Pause vor der Klausur tauschten wir uns panisch darüber aus, was eventuell getestet werden würde. Manche fingen nach fünf Minuten an zu weinen, weil sie wussten, dass sie bei einer Frage nicht die volle Punktzahl erreichen würden.
Erwachsene schätzen Leistungsdruck mehrheitlich nicht als großes Problem ein. Das impliziert eine repräsentative Umfrage der Zeit. Menschen, die selbst Kinder haben, schätzen die Lage etwas ernster ein. Fragt man die Schüler:innen selbst, zeigt sich eine klare Entwicklung.
Im WHO-Europa-Bericht steigen die Zahlen zu schulischem Druck kontinuierlich. 2024 gaben mehr Kinder und Jugendliche an, unter Druck zu stehen als noch 2018. Fast zwei Drittel der 15-jährigen Mädchen und 43 Prozent der Jungen empfanden Leistungsdruck. Das aktuelle Deutsche Schulbarometer identifiziert Leistungsdruck sogar als die zweitgrößte Sorge der befragten Jugendlichen, direkt nach Kriegen.
Laut den Autoren des Schulbarometers gibt es bisher wenig Forschung zum Zusammenhang zwischen Schule und psychischer Gesundheit. Manche mögen das schade finden, ich halte es für fatal: Kinder und Jugendliche verbringen bis zu 13 Jahre in der Schule. Ich wollte deswegen herausfinden, was wir über Leistungsdruck wissen, woher er kommt und warum Kinder und Jugendliche ihn gerade heute so sehr spüren. Bei meiner Recherche für diese Newsletter-Ausgabe habe ich gelernt, welche Gruppen besonders darunter leiden – und eine Idee entwickelt, was gegen diesen Druck helfen könnte.
Warum der Leistungsdruck hoch sein kann, obwohl die Ergebnisse schlecht sind⬆ nach oben
Wenn jemand sich fragt, ob es zu viel Leistungsdruck in Schulen gibt und als einzigen Vergleich seine eigene Schulzeit hat, dann fällt das Urteil vermutlich eher milde aus. Denn der zunehmende Leistungsdruck ist nichts, womit Erwachsene in Berührung kommen. Studien und mediale Aufmerksamkeit fehlen, um ein Verständnis dafür herzustellen. Viel häufiger wird über schlechte PISA-Ergebnisse und immer bessere Abiturnoten berichtet. Und das assoziieren wir eher mit geringeren Ansprüchen statt mit Leistungsdruck. Dabei schließt sich das nicht aus.
Denn wer gestresster ist, liefert mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schlechtere Leistungen ab. Die Psychologen Siegfried Bäuerle und Helmut Kury fanden bereits 1980 heraus, dass Folgen von Leistungsdruck auch Störungen im Arbeits- und Sozialverhalten sind. Auch eine Studie von 2015 bringt größeren Stress mit erhöhter Prüfungs- und Leistungsangst, geringerer schulischer Bindung und schlechteren akademischen Leistungen in Verbindung.
Es kann natürlich auch sein, dass ein gewisser Druck als legitime Begleiterscheinung der eigenen Schulzeit gewertet wird. Dann passt es zusammen, dass bereits im Jahr 1980 die Studie von Kury und Bäuerle zu dem Ergebnis kam, dass „eine sehr große Anzahl von Schülern unter Schulstreß leidet“. Die Frage in der repräsentativen Umfrage der Zeit an Erwachsene „Glauben Sie, dass der Leistungsdruck in Schulen für Schüler und Schülerinnen zu hoch ist?“ beinhaltet eine Wertung. Der Leistungsdruck kann aus Sicht der Befragten hoch sein, ohne zu hoch zu sein.
Der Druck heute entsteht anders als in den 1980er Jahren⬆ nach oben
Außerdem ist Druck nicht gleich Druck. Ursachen des Leistungsdrucks sind heute nicht zwingend dieselben wie vor 50 Jahren. Die Psychologen Bäuerle und Kury stellten 1980 in den Raum, dass Eltern häufig Auslöser für Schulstress sein könnten, weil sie „zu hohe Anforderungen stellen und bei Versagen inadäquat reagieren“ würden. Auch pädagogisch weniger qualifizierte Lehrer:innen könnten laut den Forschern das Empfinden von Stress verstärken. Online-Lernplattformen empfehlen Eltern oft, ihren Kindern weniger Stress zu machen. Aber sind es wirklich nur Eltern und Lehrkräfte, die Stress auslösen?
Dem steht eine Schweizer Studie von 2015 entgegen, die die Ursachen von Leistungsdruck untersucht hat. 1.538 Teilnehmende und ihre Aussagen waren die Grundlage für die Studienergebnisse. Das Ergebnis: Schüler:innen machen sich selbst den meisten Druck. Die Autor:innen schreiben: „Die Schweizer Jugend […] scheint die Normen wie auch die Unsicherheiten unserer Leistungsgesellschaft verinnerlicht zu haben. Der Druck, der von aussen durch Eltern, Lehrer oder Vorgesetzte an sie herangetragen wird, spielt dabei keine bedeutende Rolle.“
90 Prozent der Jugendlichen geben in der Studie an, ihnen sei Erfolg in Schule, Ausbildung, Studium oder Beruf wichtig. Fast die Hälfte der gestressten Jugendlichen setzen sich selbst unter Leistungsdruck, „weil sie immer alles möglichst gut erledigen wollen“. Insgesamt sagen 44 Prozent der gestressten Jugendlichen, dass sie Angst um ihre berufliche Zukunft haben.
Die Ergebnisse aus der Schweiz sind nicht eins zu eins auf Deutschland übertragbar, aber die Studie ist die Beste, die wir haben, um uns einer Erklärung anzunähern. Die Wissenschaftler:innen betonen: Häufiger Stress und Leistungsdruck haben negative Auswirkungen auf die Psyche der Schüler:innen.
Darum haben wir Angst vor der eigenen Zukunft⬆ nach oben
1980 vermuteten Bäuerle und Kury die hohe Anzahl an Menschen auf dem Arbeitsmarkt als einen Faktor für den Leistungsdruck. Heute kommt die Angst vor der eigenen beruflichen Zukunft nicht mehr durch einen Überfluss an Bewerber:innen. Im Gegenteil: Der demografische Wandel sollte eher eine geringere Konkurrenz verursachen. Trotzdem ergibt es Sinn, dass Zukunftsängste auch heute der zentrale Dreh- und Angelpunkt sind.
Erinnern wir uns wieder an die Ergebnisse der deutschen Schulbarometer-Befragung: Im Sorgenkatalog kam Leistungsdruck auf den zweiten Platz. Die zwei anderen zentralen Angstauslöser waren die Klimakrise und Zukunftsängste. Und hier hatte ich zum ersten Mal einen „Full Circle Moment“ (auf Deutsch: einen erleuchtenden Moment, in dem alles Sinn gemacht hat). Durch die globale Erderwärmung im Rekordtempo und andere Katastrophen weltweit wissen wir nicht, wie und ob wir hier in 50 Jahren noch leben werden. Kriege, teils in Europa, sind nah und bedrohlich. KI soll bald fast alle Berufsfelder auf den Kopf stellen und tut es teils jetzt schon.
Die eigenen Leistungen kann man vermeintlich kontrollieren, die Zukunft nicht⬆ nach oben
Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Aber wir wissen, dass verschiedene Krisen die Situation verlässlich verschlechtern werden. Dadurch entstehen Zukunftsängste, denen wir irgendwie begegnen müssen. Eine unbekannte Zukunft ist unheimlich, aber eine ungesicherte Zukunft sorgt für einen gefühlten Kontrollverlust. Was ich damit meine: Etwas nicht zu wissen ist weniger schlimm, als sicher zu wissen, dass etwas nicht sicher ist.
Weil Kontrolle ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist, kann uns diese Unsicherheit krank machen. Wird uns die Kontrolle genommen, kompensieren wir sie gegebenenfalls. Das ist bei psychischen Erkrankungen wie Anorexie oder Zwangsstörungen häufig ein Auslöser. Die Betroffenen kontrollieren einen Aspekt ihres Lebens als Ersatz für einen empfundenen Kontrollverlust in anderen Bereichen. So ist es kaum verwunderlich, dass auch diese Formen der psychischen Erkrankungen zunehmen.
Die eigenen Leistungen – und so indirekt die eigene Zukunft – kann man auch vermeintlich kontrollieren. Dadurch Sicherheit zu gewinnen, wird wichtiger, wenn alles drumherum so ungewiss ist. Gleichzeitig steigt der Druck. Wenn man sich anstrengt und die Ergebnisse trotzdem nicht gut sind, kann das noch stärker belasten. Genauso ist es mit ungerechten oder ungleichen Bedingungen, unter denen geleistet werden soll.
Mädchen und Kinder mit Migrationsgeschichte leiden besonders unter dem Druck⬆ nach oben
Zwei Gruppen fielen schon in der Schweizer Studie 2015 stark auf: Zwei Drittel der Menschen mit Migrationsgeschichte gaben an, Angst um ihre berufliche Zukunft zu haben. Im Vergleich: Nur 41 Prozent der anderen Jugendlichen stimmten dieser Aussage zu. Ein weiteres Gefälle zeigt, dass 47 Prozent der Mädchen sich Leistungsdruck „selbst machen“, aber nur 39 Prozent der Jungen. 2024 wird das noch deutlicher. Die WHO berichtet, dass 63 Prozent der Mädchen sich durch Schularbeiten unter Druck gesetzt fühlen. Bei den Jungen sind es nur 43 Prozent.
Wie viel Stress wir uns „machen“, ist also auch von Privilegien abhängig. Daten des Nationalen Bildungspanels in Deutschland zeigen: Schüler:innen aus höheren „Schichten“ bekommen bei gleicher Leistung bessere Noten. Während der Pandemie hatten sie außerdem bessere Möglichkeiten der Teilhabe, weil sie technisch besser ausgerüstet waren und sie häufiger Unterstützung von ihren Eltern bekommen konnten.
In einem Schulsystem, das uns alle an einem bestimmten Zeitpunkt anhand unserer vermeintlichen Leistungsfähigkeit einteilt, messen wir Noten nicht nur einen hohen Wert für spätere Jobchancen bei. Die Noten sind ein Stück weit auch Teil unserer Identität. Noten bestimmen, ob wir studieren dürfen, unsere Wunschausbildung machen können oder die Chance bekommen, uns eigenständig finanzielle Ressourcen zu erarbeiten. Dass das besonders für Menschen mit sozioökonomisch schlechter gestellten Elternhäusern eine hohe Relevanz hat, leuchtet ein. Leistung ist hier dann nicht nur eine vermeintlich kontrollierbare Ressource, sondern auch der einzige Weg zu der Zukunft, die wir anstreben.
Leistungsdruck ist politisch⬆ nach oben
Die Zeit-Umfrage vom Anfang, ihr wisst schon, die, die Erwachsene über die Realität von Kindern befragt hat, zeigt einen deutlichen Unterschied im Bildungsgrad und der politischen Einstellung je nach Antwort. Es wurde zwar nur zwischen Hauptschulabschluss und Abitur unterschieden, trotzdem zeigte sich ein Unterschied in der Haltung. Menschen mit Hochschulzugangsberechtigung empfanden den Druck deutlich seltener als zu hoch als solche ohne Hochschulzugangsberechtigung.
Bildung hängt zwar nicht unbedingt, aber doch oft mit dem finanziellen Status zusammen. Es ist plausibel, dass Kinder von Eltern ohne Abitur sich selbst mehr Leistungsdruck machen. Um noch einmal auf die Studie von 1980 zurückzukommen: Die beiden Forscher stellten fest, dass Hauptschüler:innen mehr unter Prüfungsangst litten als Gymnasiast:innen und „Unterschichtkinder mehr als Mittelschichtkinder.“ In der Zeit-Umfrage gaben besonders Anhänger:innen der AfD an, der Leistungsdruck in Schulen sei zu groß. Tendenziell zieht die Partei eher Menschen mit niedrigerem sozioökonomischen Status an. Leistungsdruck ist also politisch relevant und die wachsende soziale Ungleichheit verstärkt die ungleiche Sicht darauf.
Wir machen uns den Druck nicht selbst⬆ nach oben
Leistungsdruck ist ein Symptom unseres leistungsorientierten Systems. Und da die Schule ein Abbild dieses Systems ist, sehen wir diesen Druck auch bei Kindern. Deshalb stört mich der Ausdruck des „selbstgemachten“ Drucks. Denn der entsteht nicht, weil Kinder ihn sich ausdenken. Er ist die Mitgift unserer Gesellschaft an uns alle.
Dass neben Leistungsdruck Kriege, Klimakrise und Zukunftsängste den Schüler:innen in Befragungen große Sorgen bereiten, zeigt die Wechselwirkungen der Probleme auf. Fehlende Sicherheit, gerade Zukunftsangst, sorgt für ein größeres Sicherheitsbedürfnis. Wir glauben, dass wir dieses Bedürfnis mit höherer finanzieller Sicherheit oder besseren Jobchancen befriedigen können. Aber was wir eigentlich brauchen, ist eine Zukunft, auf die wir hoffen dürfen. Es ist wichtig, das eigene Leben positiv beeinflussen zu können. Denn Erfolg auf Basis von Noten kann nur eine Zeit lang eine Illusion von Sicherheit geben.
Redaktion: Lea Schönborn, Schlussredaktion: Isolde Ruhdorfer; Audioversion: Iris Hochberger