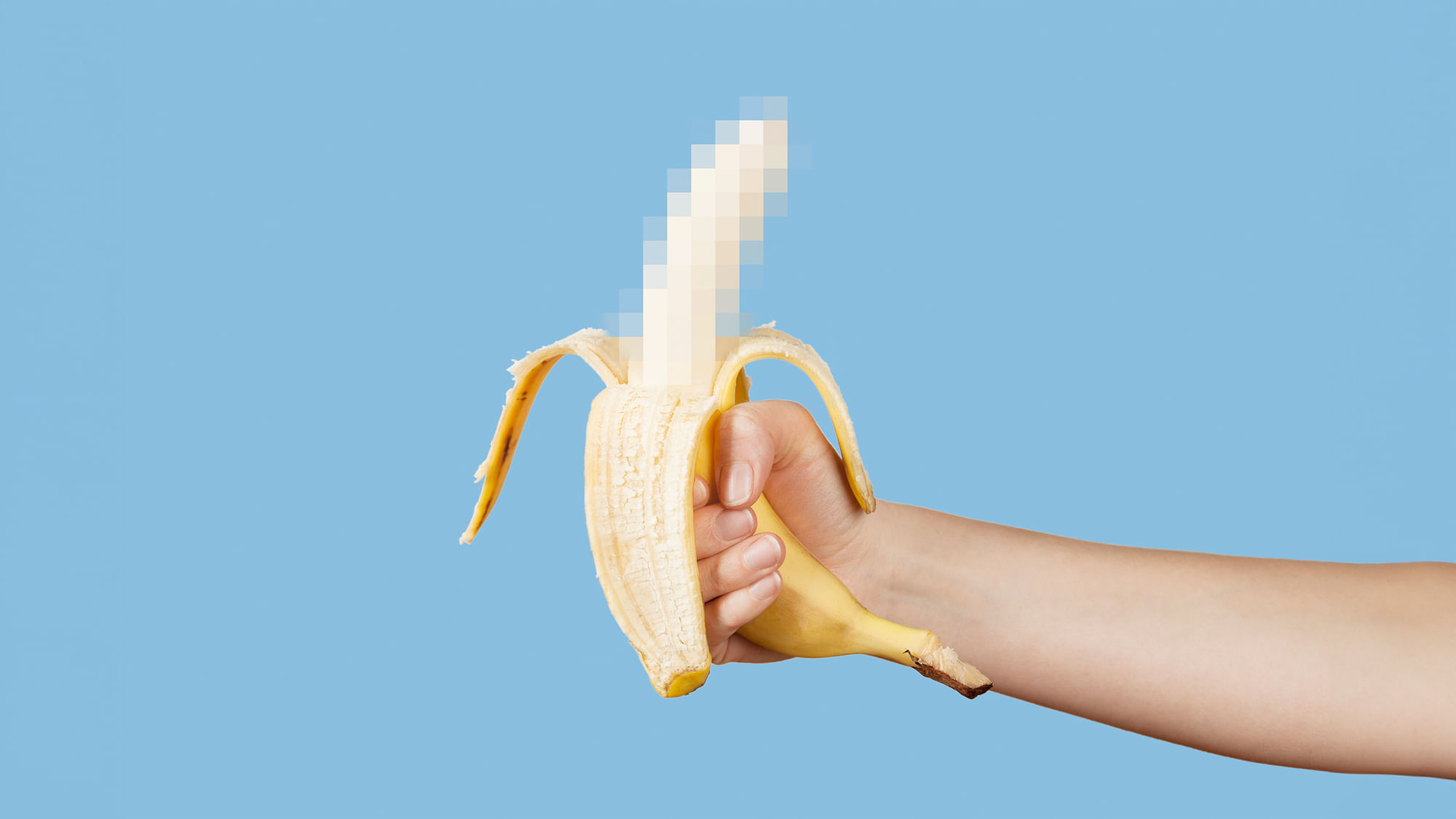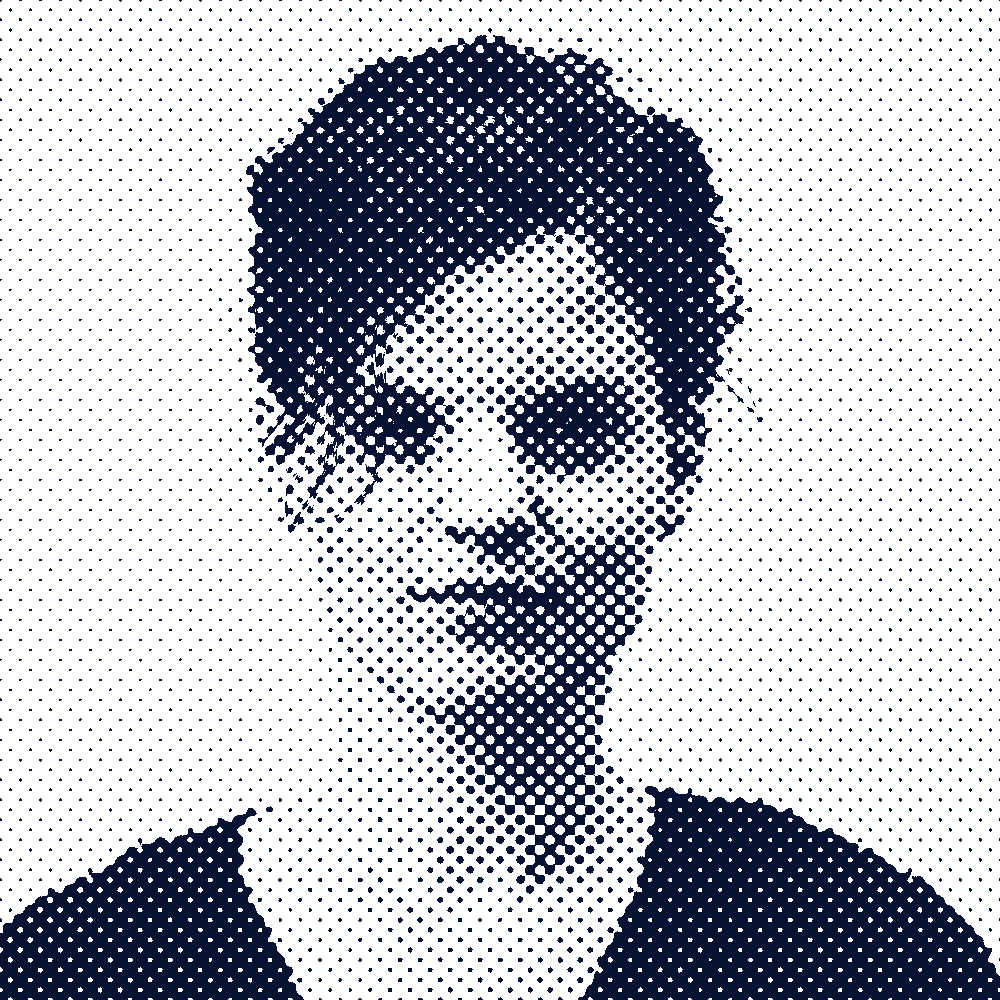Unser Bildredakteur fluchte. Er suchte ein passendes Foto für einen wissenschaftlichen Artikel über das Kamasutra und brauchte ein Bild, das irgendwie mit Sex zu tun hatte. Viele Foto-Datenbanken spucken zu diesem Thema standardmäßig Pfirsiche, Bananen oder Gurken mit daran herunterlaufenden Saucen aus. „Ich kann dieses Sex-Obst nicht mehr sehen“, murmelte er wütend.
Er hatte nicht nur einen schlechten Tag. Das Problem ist größer. Wer im 21. Jahrhundert über Sex reden will, muss Obst- und Gemüsemetaphern beherrschen.
Man sieht es daran, dass erwachsene Menschen, die über Sex und Geschlechtsteile sprechen, online zunehmend wie Kleinkinder klingen, die das mit dem Sprechen noch ein bisschen üben müssen. Sie sagen „Seggs“ oder „Knick-Knack“, „Cookie“ statt Vulva und tippen Pfirsiche ein, wenn sie Hintern meinen (🍑). Die Sexfluencerin Marie Joan, fast 700.000 Follower:innen allein auf Instagram, nennt sich „Queen of Rambazamba“. Einerseits ist das kreativ und gewitzt. Dahinter steckt aber auch ein Trend zu immer mehr digitaler Prüderie.

Vulva? Grapefruit? Hauptsache saubere Finger. | Adene Sanchez/Getty Images
Der kommt nicht von ungefähr. Die großen Plattformen wie Instagram, Tiktok oder Google regeln ihre Inhalte durch sogenannte „Community Standards“. Das ist ein freundlicher Euphemismus für Richtlinien, die festlegen, was sagbar ist und was nicht. Dahinter wirken Algorithmen, die Bilder scannen, Sprache bewerten, Hashtags filtern, Sichtbarkeit gewähren oder entziehen. Was nicht den moralischen Maßstäben ihrer Richtlinien entspricht, ob Darstellungen von Gewalt, manche politische oder sexuelle Inhalte, wird gelöscht, herabgestuft oder gar nicht erst ausgespielt.
Es ist pragmatisch, sich zu zensieren, bevor die Plattform es tut. Aber es ist auch ein Rückschritt. Sexualität wird in großen digitalen Räumen verniedlicht und umschrieben. Damit sorgen die Plattformen dafür, dass wir genau das Gegenteil dessen tun, was Expert:innen fordern.
Der Oh-la-la-Effekt⬆ nach oben
Wir schreiben das Jahr 1657 und der Maler Cornelis de Heem stellt ein Ölgemälde fertig. Auf dem Tisch drängen sich geöffnete Muscheln neben Rosen und Trauben, Kastanien wölben sich aus stacheliger Hülle. Mittig zeigt eine riesige, angeschnittene Melone, was sie zwischen den Schenkeln hat. Und damit wirklich der letzte kapiert, worum es geht, bespringen sich mittendrin noch zwei Vögel.
Das Bild heißt: „Prunkstillleben mit kopulierenden Spatzen“.

Laszives Obst mit vögelnden Vögeln. | Bild: gemeinfrei
Mit Obst und Gemüse Sexuelles anzudeuten, steht in einer langen Tradition. „Die Geschichte der fruchtigen Sexmetaphorik ist wohl so alt wie die Kommunikationsgeschichte selbst“, steht im Begleittext der Ausstellung „Apropos Sex“ des Kommunikationsmuseums Frankfurt. Aber heute wirken die Symbole anders. Während die barocken Früchte üppig und einladend waren, sind die heutigen Obst-Emojis seltsam harmlos. Nicht sinnlich und mehrdeutig, sondern verschämt und niedlich.
2018 haben Forscher:innen für eine Studie über 600 Personen dazu befragt, wie sie online Emojis verwenden, um sexuellen Kontext anzudeuten. 54 Prozent der Befragten gaben an, Emojis in solchen Nachrichten „manchmal“, „oft“ oder „immer“ zu verwenden. Die beliebtesten: Zunge (👅), Aubergine (🍆) und Tropfen (💦).
„Es entsteht diese besondere Note, wenn wir über etwas nicht reden können oder nur Anspielungen machen: es bekommt dann etwas Anzügliches, verbotenes, frivoles“, sagt die Sexarbeiterin Kristina Marlen. Ich nenne das den Oh-la-la-Effekt.“
Marlen hat auf Instagram rund 4.500 Follower:innen. Sie postet dort keine expliziten Inhalte, sondern politische Inhalte über queere Themen und Sexarbeit oder Bilder und Feedback aus ihrer Arbeit als Coach und Seminarleiterin. Die Menschen auf den Fotos sind bekleidet, die Sprache zurückhaltend – sie schreibt von S*ex, Lust und Sinnlichkeit.
Trotz aller Vorsicht hat sie schon mehrfach Shadowbanning erlebt. Eine verdeckte Form der Einschränkung also, bei der Beiträge formal online bleiben, aber von der Plattform algorithmisch unsichtbar gemacht werden. Sie tauchen dann nicht mehr in Hashtags, Suchen oder Empfehlungsfeeds auf. Marlens Facebookseite mit 5.000 Follower:innen hat Facebook einfach gelöscht.
Warum zwischenzeitlich sogar „Onlyfans“ sexuelle Inhalte verbieten wollte⬆ nach oben
Es ist fast ein bisschen tragisch: Jahrzehntelang haben Aufklärer:innen und Aktivist:innen das Reden über Sex und Körper mühsam aus der sprachlichen Unsichtbarkeit geholt. Wir könnten heute endlich an einem Punkt sein, an dem wir ohne peinlichen Krampf über Sex und Körper kommunizieren. Aber die Plattformen arbeiten dagegen.
Dahinter steckt teilweise eine puritanisch geprägte Auffassung von Sexualität, die aus dem US-amerikanischen Kulturraum kommt. Ein Beispiel: 2024 sorgte ein gut 14 Meter hohes digitales Plakat am New Yorker Times Square für Aufsehen. Eine Werbung für Kekse, die stillenden Müttern angeblich bei der Milchbildung helfen sollen. Das Plakat zeigte die schwangere Food-Influencerin Molly Baz in Glitzer-Bikini-Top und Jacke, die zwei große Kekse vor ihre Brüste hielt. Nach drei Tagen verschwand das Plakat. Der Betreiber der Werbefläche, Clear Channel, habe auf Beschwerden reagiert und das Motiv zurückgezogen, berichtete die New York Times.
https://www.instagram.com/p/C6q-Ts_MTou/?utm_source=ig_web_copy_link
Die Ironie dabei: Werbetafeln am Times Square zeigen regelmäßig Frauen in knappen Dessous, mit kaum mehr Stoff am Körper als Molly Baz. Im Frühling 2025 lag sogar eine 20 Meter lange, aufblasbare Kim-Kardashian-Puppe im Bikini mitten auf dem Platz, um für ihre Bademodenlinie zu werben. Aber: Sie war nicht schwanger, keine reale Frau mit Körperfunktionen.
Es ist eine merkwürdige Moral, in der Nacktheit, Lust oder weibliche Körperteile immer nur angedeutet werden dürfen. Alles andere gilt als sittenwidrig und schambesetzt. Das beeinflusst Plattformen, die weltweit agieren, aber nach kalifornischem Recht und Werbekodex funktionieren.
Aber es geht nicht nur um Prüderie, die Plattformen stehen unter realem Druck. Sie müssen pornografische Inhalte besonders streng regulieren, um Werbekunden nicht zu verprellen, Jugendschutzgesetze einzuhalten und sich gegen Klagen abzusichern. Etwa von Eltern, deren Kinder beim Scrollen auf Sexcontent stoßen. Der Blogdienst Tumblr verschwand 2018 aus dem Apple Store, weil bei einer routinemäßigen Überprüfung der Plattform Inhalte entdeckt wurden, die Kindesmissbrauch zeigten.
Auch Kreditkartenunternehmen wie Visa und Mastercard besitzen Richtlinien gegen „sexually explicit Content“. Um keinen Ärger mit den Firmen zu riskieren, regulieren Plattformen wie Meta, Google und Tiktok, aber auch Amazon, sexuelle Inhalte vorauseilend besonders streng. Sogar die Plattform „Onlyfans“, die besonders stark von unabhängigen Sexarbeiter:innen und erotischen Creator:innen genutzt wird, kündigte 2021 an, alle sexuellen Inhalte zu verbieten – auf Druck von Zahlungsdienstleistern. Nach massiver Kritik in der Öffentlichkeit ruderte Onlyfans zurück.
Sexuelle Inhalte zu zensieren, wäre vielleicht noch nachvollziehbar, wenn es nur darum ginge, pornografische und kriminelle Bilder und Texte in den sozialen Medien einzuschränken. Doch die Filter der Plattformen operieren weitgehend kontextblind. Sie unterscheiden nicht zwischen Pornografie und Aufklärung, nicht zwischen künstlerischer Nacktheit und sexualisierter Darstellung. Wer über Brustkrebs informiert und dabei Brüste zeigt, oder als Künstlerin eine Fotografie mit nacktem Hintern präsentiert, riskiert dieselbe Sanktion wie ein Pornoaccount.
Kinder sollen anatomische Begriffe lernen, Erwachsene sagen „Zipfel“⬆ nach oben
Das hat merkwürdige Folgen: Erwachsene verhalten sich online nun so, wie es Sexualpädagog:innen beim Umgang mit Kindern ausdrücklich nicht empfehlen. Fachgesellschaften betonen seit Jahren, wie wichtig es ist, dass Kinder anatomische Begriffe kennen – Vulva, Klitoris, Penis, Hoden – und keine verniedlichenden Umschreibungen wie „Muschi“ oder „Zipfel“. Denn wer seinen Körper nicht klar benennen kann, hat es auch schwerer, über Grenzen zu sprechen. Während man sich also darum bemüht, Jugendliche gezielt darin zu stärken, präzise und selbstbewusst über ihren Körper zu sprechen, rutscht das Netz zurück in die Rätselsprache und nennt die Vulva lieber „Cookie“.

Diese Gleichung bereitet unserem Bildredakteur körperliche Schmerzen. | Adene Sanchez/Getty Images
Neulich hat das Social-Media-Team von Krautreporter eine Umfrage auf Instagram gemacht. Die Frage: „Was sind die albernsten Synonyme für Geschlechtsteile, die du in letzter Zeit gehört hast?“ Zu den Antworten gehörten: „Milchzentrale“, „Empire State Building“, „Brötchen“ und „Wursttheke“. Jemand zitierte einen Erstklässler, der gesagt haben soll: „Der hat meine Privatsphäre angefasst!“
Das klingt lustig, ist aber ein bisschen traurig. Denn es macht Aufklärung und Informationen beim Thema Sexualität schwer. Das zeigt auch die CensHERship-Studie, eine laufende Erhebung zu digitaler Zensur im Bereich Frauengesundheit und Sexualaufklärung. Seit Februar 2024 sammelt die britische Initiative Erfahrungsberichte von Betroffenen, darunter Creator:innen, Mediziner:innen, NGOs, Marken und Kampagnen aus dem Gesundheitsbereich. Die Daten basieren auf einem offenen Fragebogen. Die letzte Auswertung (PDF) bezieht sich auf Daten, die bis Mai 2025 gesammelt wurden und hat 115 Fälle ausgewertet.
Zwar ist die Erhebung nicht repräsentativ, doch sie bietet Einblicke: 95 Prozent der Befragten berichten von mindestens einem Fall algorithmischer Einschränkung innerhalb des letzten Jahres, viele von deutlich mehr. Die Eingriffe reichen von gemeldeten Inhalten und gesperrten Anzeigen bis hin zu vollständiger Kontolöschung, oft ohne Vorwarnung oder nachvollziehbare Begründung. In einem Fall musste eine Brustkrebs-Aufklärungskampagne statt einer weiblichen Brustwarze eine männliche zeigen. In einem anderen Fall wurde ein Post zum „Vaginal Microbiome“ fünfmal abgelehnt – bis der Begriff entfernt war.
53 Prozent der Teilnehmenden gaben an, sich inzwischen aktiv selbst zu zensieren, indem sie Wörter wie „Sex“, „Vagina“ oder „Menopause“ durch Zahlen oder Slang ersetzen. „Ich kann nicht einmal die Begriffe für meinen eigenen Körper online verwenden“, sagt eine Teilnehmerin. Eine andere berichtet, sie habe zwei Jahre an Content verloren und damit 75 Prozent ihres Umsatzes.

Triggerwarnung: Grapefruit. | undefined/Getty Images
„Der Algorithmus ist zu einer Gottheit geworden“⬆ nach oben
Wer finanziell von der Reichweite abhängig ist, die Plattformen schaffen, hat gar keine andere Wahl, als sich zu zensieren. „Ich bin Freelancerin, Instagram ist meine Sichtbarkeit“, sagt Ana Ornelas, die sich selbst als „Pleasure Aktivistin“ bezeichnet. Erfolg bei Instagram hängt für sie mit beruflichem Erfolg zusammen. Niemand entschädige sie für gesperrte oder eingeschränkte Inhalte. „Es ist ein unsicheres, fragiles System“, sagt sie.
Ornelas schreibt online über sexuelle Aufklärung und Politik. Dazu postet sie lustige Videos, zum Beispiel eine Straßenumfrage, um herauszufinden, was Menschen über die Klitoris wissen (sehr wenig). Zwischendurch zeigt sie Fotos ihres Körpers, nicht aufreizender als eine standardmäßige Unterwäschewerbung. „Trotzdem wird mein Körper als gefährlich betrachtet“, sagt sie. „Ich muss meine Fotos stark zensieren.“ Auf einem von Ornelas Fotos sieht man sie von hinten, wie sie an einem Fenster steht. Sie trägt eine Fellweste und Socken. Ihr nackter Po ist nur zu erahnen, nicht zu erkennen. Ein verschwommener Filter liegt über dem Bild.
Für Creator:innen bleibt es ein ewiges Ratespiel, was man eigentlich sagen darf und was nicht. Die Regeln sind intransparent und ändern sich ständig. Es fehlt eine klare Unterscheidung zwischen Erotika, Pornografie und Sexualpädagogik. Gleichzeitig erfolgen viele Löschentscheidungen vollautomatisch, ohne menschliche Prüfung. „Man entwickelt Strategien gegen die Zensur, aber es ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Du findest eine Umschreibung für das Wort ‚Sex‘, zum Beispiel S*ex, aber der Algorithmus lernt mit, und dann musst du wieder neu anfangen“, sagt Ornelas. Das koste sie Energie, die in Inhalte und Recherchen fließen sollte.
„Der Algorithmus ist zu einer Gottheit geworden, den alle beobachten und zu verstehen versuchen“, sagt Sexarbeiterin Marlen. KI mache das Ganze noch schlimmer, denn jetzt werde sie für Posts von vor zwei Jahren bestraft.
Gleichzeitig verschieben die Plattformen selbst die Grenzen dessen, was noch als sagbar gilt. Dabei passen sie sich auch an politischen Machtverhältnisse an. Kurz vor Trumps Rückkehr ins Amt hat Meta 2025 seine Regeln gegen Hassrede gelockert. Aussagen, in denen queere Menschen als psychisch krank bezeichnet werden, sind dort nun erlaubt, solange sie als Teil des „gesellschaftlichen Diskurses“ gelten.
Das Wort „vaginal“ steht pauschal unter Pornoverdacht⬆ nach oben
Viele KI-Modelle wurden mit riesigen Mengen öffentlich zugänglicher Internetdaten gefüttert. Diese spiegeln bestehende Verzerrungen wider. Ein ehemaliger Technikleiter bei Amazon äußerte im Gespräch mit dem US-Magazin Wired die Vermutung, dass Begriffe wie „vaginal“ im Suchsystem seltener vorgeschlagen werden, weil sie in den Trainingsdaten häufig in Zusammenhang mit Pornografie auftauchen. Die Filter unterscheiden also nicht nur schlecht zwischen pornografischen Inhalten und Aufklärung. Sie regulieren auch noch Inhalte über Frauenkörper strenger.
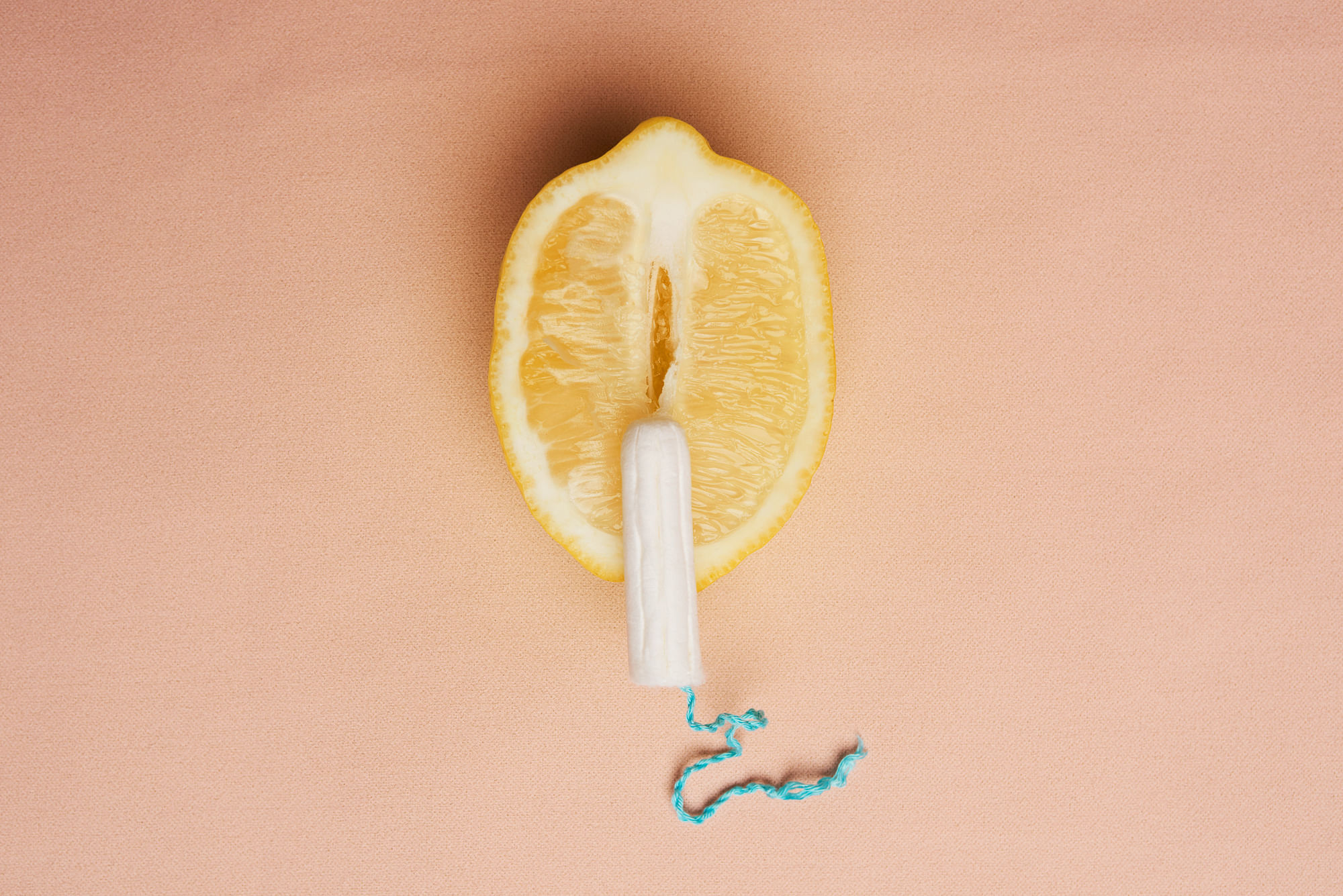
Saure Woche erwischt? | Adene Sanchez/Getty Images
Das Amazon-Beispiel ist kein Ausreißer. Ein Report der gemeinnützigen Organisation Center for Intimacy Justice dokumentiert über 150 Fälle weltweit, in denen Anzeigen und Inhalte aus dem Bereich Frauengesundheit, von Menstruation über Menopause bis hin zu queerer Aufklärung, blockiert wurden. Vergleichbare Inhalte zu Potenzpillen und Männergesundheit? Gingen durch.
Besonders perfide daran ist, dass die Plattformen selbst Milliarden mit den Posts verdienen, die User:innen für sie kostenlos erstellen. Und Inhalte, die Sex andeuten, haben eine hohe Reichweite. Andererseits blockieren die Filter sexuelle Aufklärung. Es sei denn, sie passt sich der Obstlogik an. Was einst als smarte Strategie von User:innen gedacht war, um das System auszutricksen – Aubergine statt Penis – ist längst Teil eines Systems geworden, das sexuelle Sprache nur duldet, wenn sie lächerlich klingt.
Redaktion: Isolde Ruhdorfer, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert