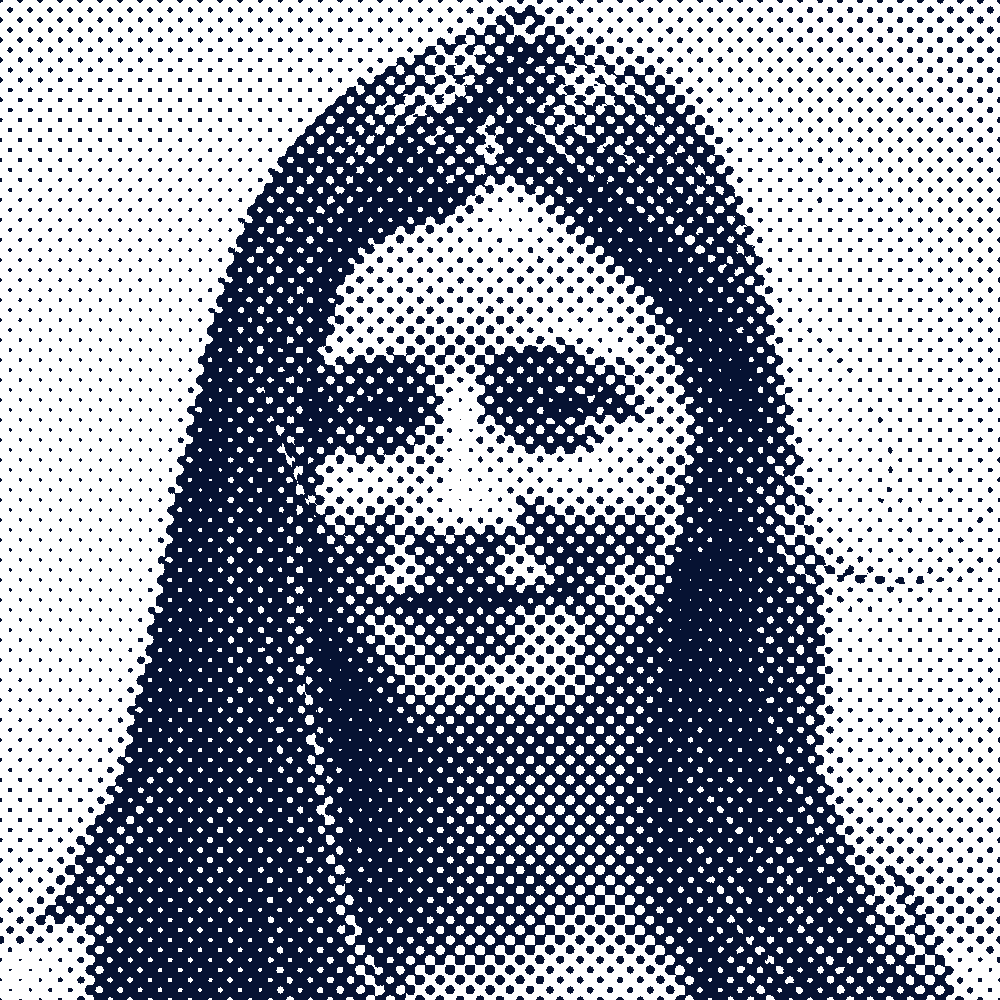Einmal habe ich einen kompletten Tag darauf verwendet, zwei Bilderrahmen zu kaufen. Ich maß die Poster aus, die ich aufhängen wollte, verglich diverse Rahmen in verschiedenen Läden. Als ich endlich welche gekauft hatte, gab ich sie dann doch zurück, weil die Farbe des Rahmens nicht so zu dem Motiv der Poster passte, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das war in einer Phase, in der ich viel Zeit hatte, weil ich gerade mit meinem Studium fertig war und mein neuer Job bei Krautreporter noch nicht begonnen hatte.
Vor ein paar Tagen habe ich wieder einen Bilderrahmen gekauft, dieses Mal war es eine Sache von 30 Sekunden. Ich stand an der Kasse in einem dieser Läden, die Notizbücher und farbiges Deko-Klebeband verkauften und legte den Rahmen kurzentschlossen zu den restlichen Sachen in meinem Korb, bevor ich bezahlte.
Daran musste ich denken, als ich ausgerechnet im Economist auf einen sehr lustigen Text von 1955 stieß: „Parkinsons Gesetz“. KR-Leserin Brigitte hatte mich auf ihn aufmerksam gemacht. Dort beschreibt der Brite C. Northcote Parkinson die von ihm entdeckte Gesetzmäßigkeit, die Tendenzen unserer Arbeitswelt so treffend beschreibt, dass Soziologen sie heute noch gern zitieren.
Meine sehr unterschiedlichen Bilderrahmenkäufe erklärt Parkinsons berühmtes Gesetz: Arbeit nimmt immer so viel Zeit in Anspruch, wie man zur Verfügung hat. Jeder weiß wahrscheinlich, dass sich eine Aufgabe wie Kaugummi dehnen kann. Das gilt zwar nicht für alle Jobs gleichermaßen, für die meisten Büroarbeiten aber besonders.
Parkinsons Regel war als Satire gemeint, aber sie trifft einen wahren Kern. Mir hat sie ein bisschen weh getan beim Lesen und mich an der Effizienz meiner Arbeit zweifeln lassen. Sein Gesetz erklärt, warum Verwaltungen anschwellen, auch wenn es gar nicht mehr zu verwalten gibt. Das gilt nicht nur für Behörden, aber eben auch.
C.N. Parkinson, der übrigens nichts mit der Parkinson-Krankheit zu tun hat, war eigentlich Historiker, der sich auf die Geschichte der Marine spezialisiert hatte. Effizienzprobleme schienen ihn persönlich nicht einzuschränken, zumindest veröffentlichte er in seinem Leben über 60 Bücher. Das wohl bekannteste ist eine schmale Essay-Sammlung, in der auch der Text aus dem Economist enthalten ist. Dort karikiert er die Auswüchse, die bürokratische Prozesse annehmen können.
Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er bei der britischen Navy und erlebte dort, wie die Armee in kürzester Zeit einen seiner Meinung nach übertriebenen bürokratischen Apparat aufbaute.
Danach zog er nach Singapur und lehrte dort an der Universität Malaya. Er war am Prozess beteiligt, aus Singapur ein unabhängiges Land zu machen. Parkinson schilderte der New York Times im Jahr 1978, wie er die Komitees, in denen er saß, irgendwann zusammengezählt hat und auf 32 kam. Man kann also sagen: Der gute Mann hat bürokratische Prozesse von innen kennengelernt.
Parkinson war der festen Überzeugung, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Output einer Behörde und der Zahl ihrer Angestellten geben muss. Denn man kann die gleiche Arbeit entweder möglichst effizient erledigen oder sich mit fünf Leuten abstimmen und komplizierte Prozesse bauen, die möglichst viele Leute beschäftigt halten.
Als Beispiel dafür nannte er in dem Economist-Artikel die Navy, für die er ja selbst tätig war. Dort arbeiteten zwischen 1914 und 1928 immer weniger Leute auf See und immer mehr an Land, die verwalteten. So sank die Zahl der Schiffe in der Navy um 67,7 Prozent, während die Zahl der Werft-Büroangestellten um 40,3 Prozent stieg.
Die zwei Regeln, warum in Organisationen immer mehr Leute arbeiten⬆ nach oben
Parkinson glaubte, dass es für seine Regel zwei Unterbedingungen gab: Erstens möchte jeder Beamte die Zahl seiner Untergebenen vergrößern und weitere Rivalen vermeiden. Deshalb will er immer mindestens zwei Untergebene haben. Und zweitens: Beamte schaffen sich gegenseitig Arbeit.
Parkinson stellt sich dafür einen Beamten vor, den er A nennt und der sich überarbeitet fühlt. A überzeugt seine Vorgesetzten davon, dass er tatsächlich überarbeitet ist, und bekommt nun zwei Untergebene, die jeweils einen Teil der Arbeit machen sollen, die er vorher erledigt hat. Einen gleichgestellten Kollegen oder nur einen einzelnen Untergebenen möchte A vermeiden, denn damit hätte er einen Rivalen um den Posten seines Chefs, sollte der irgendwann in Rente gehen. Doch auch diese Untergebenen stöhnen unter der Last der Arbeit und bekommen nun ebenfalls Untergebene. So machen nun sieben Mann die Aufgaben, die vorher ein einziger erledigt hat, ohne sich dabei zu langweilen.
Wie kann das sein? Hier greift Unterbedingung Nummer zwei: Beamte beschäftigen sich gegenseitig. Denn nun gehen Dokumente durch die Hände verschiedener Untergebener, die sie anpassen und gegenlesen, bis das Schreiben bei ihrem Chef, dem Beamten A landet. Der ist inzwischen eingenommen von den persönlichen Problemen seiner Untergebenen: Warum sieht der eine immer so fahl aus und weshalb reden zwei andere nicht mehr miteinander? Dazu kommt noch die große Frage, wen er als seinen Nachfolger vorschlagen soll, denn sein Chef geht in Rente und damit steht seine eigene Beförderung an.
Trotzdem bleibt er bis spät abends im Büro, um das Dokument zu überprüfen und es in einen Zustand zu bringen, in dem es auch gewesen wäre, wenn er es von Anfang an selbst geschrieben hätte. Dann fährt er in der Dunkelheit nach Hause, es leuchtet nur noch in wenigen Bürofenstern Licht und der Beamte A denkt wehmütig, dass Spätschichten genau wie graue Haare eine der Strafen des Erfolgs sind. So schildert es Parkinson.
Parkinson war ein konservativer Mann und schien davon auszugehen, dass nur Behörden auf diese Art wachsen würden, Unternehmen dagegen nicht. So zog er am Ende seines Lebens auch deshalb auf die Isle of Man, um moderate Steuern zahlen zu müssen. Und wie es sich für satirische Essays gehört, differenziert er nicht weiter, in welchen Momenten Bürokratie sinnvoll ist und in welchen nicht.
Bürokratie ist nervig, aber wichtig⬆ nach oben
Dabei ist eine moderne Gesellschaft ohne Bürokratie nicht vorstellbar. Viele Soziolog:innen sehen das Phänomen deshalb ambivalenter als Parkinson, so auch Dirk Baecker von der Zeppelin Universität. Er denkt zwar einerseits auch, dass wir mit der Bürokratie übertrieben haben. Aber er weist darauf hin, dass bürokratische Prozesse in modernen Gesellschaften wichtige Funktionen erfüllen, weil sie Entscheidungsfindungen versachlichen. Sie sorgen dafür, dass Beamte Baugenehmigungen erteilen, wenn die Bedingungen stimmen und nicht, wenn sie den Antragsteller mögen. Und sie sollen sicherstellen, dass die Rechte von Minderheiten geschützt werden.
Für Baecker ist Bürokratie nicht auf Behörden beschränkt: „Sobald Organisationen eine gewisse Größe überschreiten, werden Kompetenzen arbeitsteilig geordnet. Büros arbeiten anderen Büros zu. Wenn das hierarchisch geordnet wird, haben Sie Bürokratie.“ Organisationen entwickeln ein Eigenleben und so neigen Mitarbeiter:innen in bürokratischen Strukturen dazu, sich für ihre Arbeit den passenden Nachschub zu besorgen, wenn nicht sogar immer neue Aufgaben anzueignen. „Sie haben Dutzende Leute, die an Schreibtischen sitzen und ihre Arbeit anhand dessen gestalten, was sich Leute an anderen Schreibtischen ausdenken.“
Krautreporter-Mitglied Heike etwa arbeitet in einem kleinen Planungsbüro, das Unternehmen bei Bauvorhaben unterstützt. Sie verbringt sehr viel Zeit damit, Unterlagen zu erstellen oder Daten zu übermitteln, die Behördenmitarbeiter:innen anfordern – teilweise doppelt und dreifach, weil es, wie sie sagt, zu wenig Austausch zwischen den Ämtern gäbe. Damit hat ja nicht nur sie mehr Arbeit, sondern auch die Beamt:innen, die ihre Unterlagen prüfen müssen. Dazu kommen die ständigen rechtlichen Änderungen, die berücksichtigt werden müssen. Dabei ist die neue Vorschrift in der Regel umfangreicher und komplexer als der Vorgänger.
Es gibt auch deshalb so viele Gremien, weil Mitglied sein ein Statussymbol ist⬆ nach oben
Parkinson weist in seinem Essay darauf hin, wie wichtig die persönlichen Motive der Mitarbeiter:innen dafür sind, dass bürokratische Strukturen wuchern. Das erlebt Krautreporter-Mitglied Alexander bei seiner Arbeit.
Er begleitet als Consultant für Innovation und Digitalisierung Unternehmen dabei, bürokratische Prozesse abzubauen und bekommt dabei immer wieder den Widerstand von Angestellten zu spüren, weil die befürchten, dabei Privilegien zu verlieren. So berichtet er von einem Konzern, in dem es bis zu sechs Wochen gedauert hat, bis sich alle Entscheidungsträger zu einem Meeting zusammenfinden konnten, mehrere Assistent:innen waren zwischenzeitlich damit beschäftigt, diese circa 15 Personen an einen Tisch zu bekommen. In dem Meeting wurde darüber entschieden, welche externen Dienstleister sie beschäftigten. Warum es dafür überhaupt eine Abstimmung aller Abteilungen brauchte, war für Alexander bis zum Schluss nicht offensichtlich, denn theoretisch hätte jede Abteilung ihre eigenen Entscheidungen treffen können, oder sie hätten einen Katalog erstellen können, in dem die möglichen Lieferanten festgehalten waren.
In dem Meeting selbst wurde dann auch wenig diskutiert, die meisten Vorschläge für Lieferanten wurden einfach abgenickt. Alexander versuchte, Teile der Entscheidungen aus diesem Meeting auszulagern – und scheiterte. Denn für die Teilnehmer:innen hätte es ein Verlust von Privilegien bedeutet, das Meeting abzuschaffen. Es war ein Statussymbol, an diesem Meeting inklusive komplizierter Terminfindung teilzunehmen; wichtig, um in der hierarchischen Firmenkultur weiter aufsteigen zu können.
Bei hierarchischen Organisationen gibt es also auch deshalb langwierige Prozesse mit vielen Beteiligten, weil es eine Statusfrage sein kann, mitzuentscheiden oder in bestimmten Gremien zu sitzen. Das kann über das Fortkommen auf dem Karriereweg entscheiden.
Vielen Personen in Führungspositionen sind Status und Macht wichtig, sonst wären sie ja auch nicht bereit, den Preis zu zahlen, den ein Aufstieg hat.
Natürlich gibt es auch immer wieder Versuche, solche Prozesse zu verschlanken, sonst hätten Consultants wie Alexander keine Arbeit. Und in anderen Fällen war Alexander bei seiner Arbeit auch erfolgreich. So gelang es ihm, ein Unternehmen dabei zu unterstützen, den Produktentwicklungszyklus von zwei Jahren auf zehn Wochen zu reduzieren. Was dabei half: Die Unterstützung von ganz oben. Einer seiner Kollegen verbrachte viel Zeit damit, die Geschäftsführung davon zu überzeugen, dass es keinen Machtverlust bedeutet, wenn sie nicht mehr direkt über jedes Produktdetail entscheidet, sondern die Richtung vorgibt.
Parkinsons Essay liefert keine Antwort auf die Frage, an welchen Stellen Bürokratie überflüssig ist und wo sie wichtige Funktionen erfüllt. Manchmal dienen langwierige Abstimmungsprozesse vor allem dem Status einzelner Führungskräfte, in anderen Fällen sorgen sie dafür, dass Entscheidungen nachvollziehbar getroffen werden. Oft beides. Parkinsons Essay erinnert aber daran: Nur weil Angestellte denken, sie bräuchten dringend Untergebene, die ihnen Arbeit abnehmen, muss das nicht zwangsläufig stimmen. Man kann eben Stunden aufwenden, um eine Aufgabe zu erledigen – oder ein paar Minuten.
Transparenzhinweis: In der ersten Version des Artikels stand nicht, dass eine KR-Leserin mich auf den Text von Parkinson hingewiesen hatte. Das habe ich nachträglich ergänzt.
Vielen Dank an Pirmin, Rainer, Stefanie, Laura, Christian, Jerry, Bernd, Heiko, Evelyn, Andreas, Cornelia, Dirk, Dagmar, Dieter, Bernd, Kai, Annette, Brigitte und Heike für ihre Anregungen!
Redaktion: Nina Rossmann, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Iris Hochberger