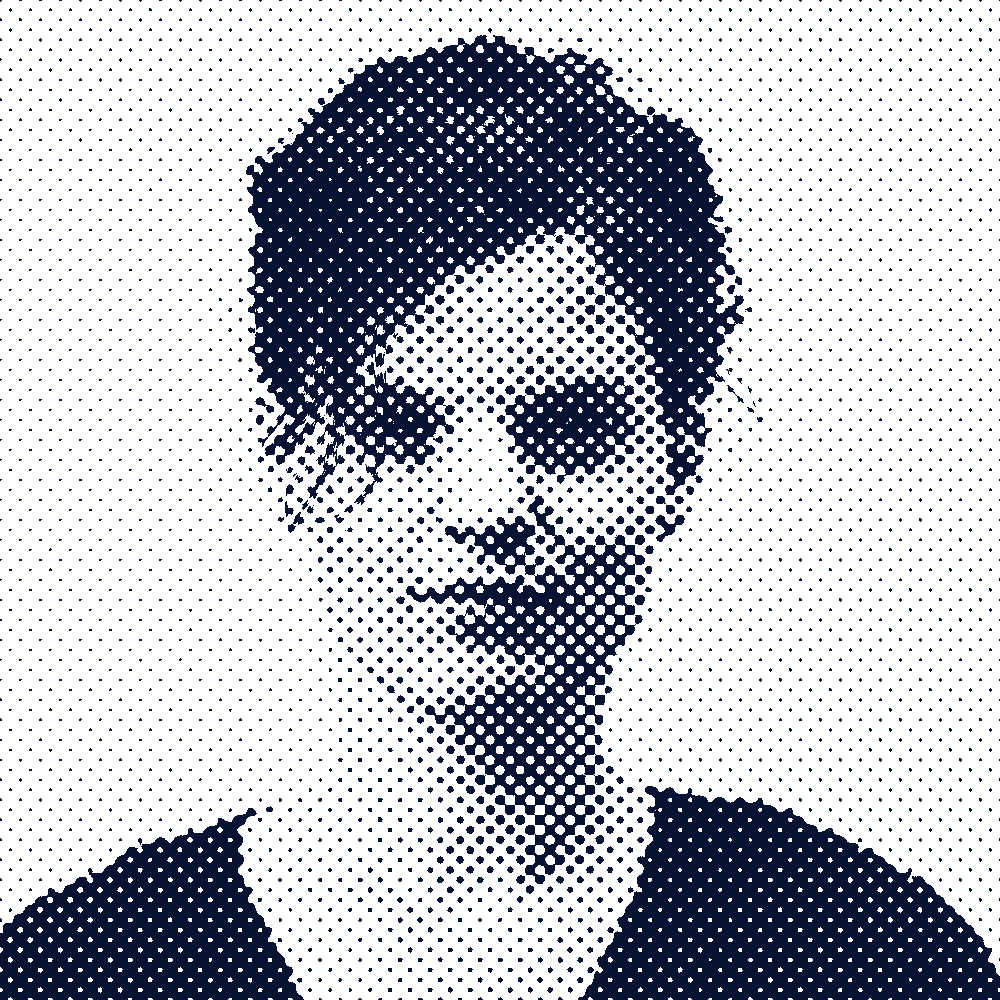Als Harriet Browns Psychologin ihr an einem stickigen Abend vor anderthalb Jahrzehnten vorschlug, sie könne doch einfach mal versuchen, sich mit ihrem Körper wohlzufühlen, statt ständig dagegen anzukämpfen, wurde Brown wütend. So wütend, dass sie fast aufgestanden wäre und die Praxis verlassen hätte. Sie wollte kein Körper-Akzeptanzprogramm, keinen Selbstliebe-Kursus. Sie war gekommen, um die Ursachen in ihrem Kopf dafür zu finden, dass sie es einfach nicht schaffte, schlank zu bleiben.
Was war das für ein absurder Vorschlag, dachte sie, ihren Körper anzunehmen, wo er doch offensichtlich nicht in Ordnung war - er war ja zu weich, es war zu viel von ihm da! Brown war sehr aufgebracht, aber sie entschied sich doch zu bleiben. Sie wusste es noch nicht, aber diese Entscheidung führte sie geradewegs dazu, eines der größten Ernährungsdogmen unserer Zeit in brillanter Weise zu hinterfragen: dass Dicksein ungesund ist.
Jetzt hat Brown darüber ein Buch geschrieben: “Body of Truth”. Denn nach diesem Sommerabend damals, an dem sie heiße Tränen über die Speckrollen an ihrem Bauch weinte, lernte sie, ihren Körper zu akzeptieren. Browns Buch, das bis jetzt nur in den USA erschienen ist, untersucht unsere kulturelle, wissenschaftliche und historische Besessenheit von Körperfett. Eine Besessenheit, die stärker denn je ist in Zeiten, in denen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von einer globalen Fettsucht-Epidemie spricht und in denen dem Übergewicht auf allen Kanälen von Politikern und echten und falschen Gesundheitsexperten der Krieg erklärt wird.
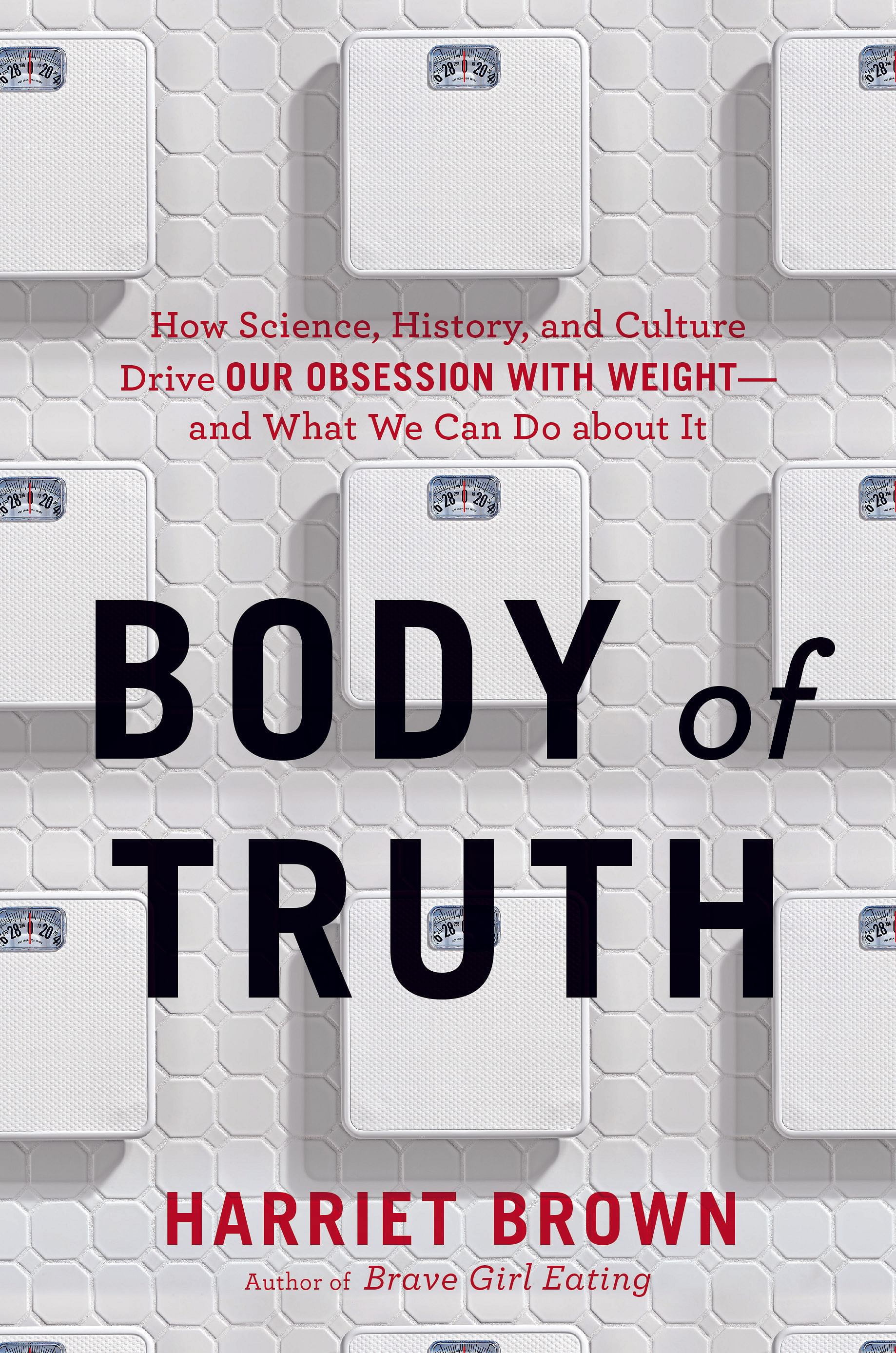
Bild: Da Capo Press
Viele meinen, dieser Kampf sei ehrenwert, ein wichtiges Ringen gegen ein gefährliches Problem einer Überflussgesellschaft, in der Menschen zu viel in Bildschirme starren und zu wenig Treppen steigen, zu viel Zuckerlimo trinken und Würste essen. Brown aber wirft einen sehr ernsten, sehr genauen Blick darauf, warum wir wirklich ein Problem mit Fett haben. Und kommt zu dem Schluss, dass der weithin propagierte direkte Zusammenhang zwischen Normalgewicht und besserer Gesundheit nicht der Realität entspricht, sondern kulturellen Normen. Diese Behauptung unterfüttert sie überzeugend mit Ergebnissen aus der Übergewichtsforschung.
Sterben Dicke früher?
Einen wichtigen Teil ihres Arguments stützt sie auf zwei Studien, von denen eine, verfasst von der Epidemiologin Katherine Flegal, nach ihrem Erscheinen vor zwei Jahren auch in Deutschland durch die Medien gegangen ist. Dass sie trotz aufsehenerregender Ergebnisse immer noch vor allem einem Fachpublikum bekannt ist, liegt wohl auch daran, dass Ernährungsberater, Hausärzte und Konsumenten den Ergebnissen nicht trauen. Zu sehr scheinen diese wichtigen Grundsätzen zu widersprechen. Es lohnt sich deshalb, sie zu wiederholen.
Nachdem Flegal festgestellt hatte, dass der durchschnittliche Amerikaner heute etwa neun Kilo schwerer und etwa zweieinhalb Zentimeter größer ist als 1960, fragte sie sich, wie sich das auf die Gesundheit ihrer Mitmenschen auswirkte. Wenn die Leute dicker wurden - starben sie dann auch früher?
Vielleicht dachte sie an die düstere Aussage, die der Gastroenterologe William Klish im Film Super Size Me getroffen hatte: Die heutigen Kinder, sagte er, könnten die erste Generation sein, die kürzer leben würde als ihre Eltern - weil sie zu fett sei.
Flegal wollte die Korrelation zwischen Gewicht und Sterblichkeit umfassend untersuchen. Dafür unterzog sie 97 Studien mit 2,88 Millionen Teilnehmern einer Meta-Analyse. Wider Erwarten stellte sie dabei fest, dass übergewichtige (nicht krankhaft fettleibige) Menschen ein um sechs Prozent niedrigeres Sterberisiko hatten als Normalgewichtige.
Die Veröffentlichung dieser Ergebnisse platzte in der akademischen Welt wie eine Bombe. Jeder Forscher, der sich in irgendeiner Weise mit Übergewicht beschäftigte, hatte zu Flegals Analyse eine Meinung. Viele überzogen sie mit wütender Kritik, allen voran der Harvard-Ernährungswissenschaftler Walter Willett, der sich gerne mit Gemüse im Arm ablichten lässt und der Forscherin nachlässiges Arbeiten vorwarf. Bis jetzt, allerdings, konnte niemand diese Behauptung erhärten. Flegals Ergebnisse bleiben stehen, aufrecht und für viele lästig wie ein Baum inmitten einer vielbefahrenen Straße.
Haben Dicke mehr Krankheiten?
Eine zweite wichtige Studie, über die Brown schreibt, ist das “Look Ahead”-Projekt, an der etwa 5.000 übergewichtige oder fettleibige Menschen mit Typ-II-Diabetes teilnahmen und in der geprüft werden sollte, ob diese weniger anfällig für bestimmte Krankheiten sein würden, wenn man sie per Diät und Sport verschlankte. Zwei Dinge waren an dieser Studie besonders: Erstens handelte es sich um eine Interventionsstudie. Das heißt, die Forscher griffen bei der Hälfte der Teilnehmer aktiv in deren Leben ein, hielten sie in Gruppen- und Einzelsitzungen dazu an, weniger Kalorien und Fett zu essen und Sport zu treiben. Die zweite Besonderheit ist die Dauer der Studie. Man folgte den Teilnehmern über ein ganzes Jahrzehnt (eine „Langzeitstudie“ dauert oft nur ein bis zwei Jahre).
Das Resultat war wieder überraschend: Obwohl die Teilnehmer in der Interventionsgruppe fitter waren und bei bestimmten Biomarkern, wie dem glykierten Hämoglobin (das den Glukose-Level im Blut anzeigt) deutlich besser abschnitten, gab es bei ihnen genauso viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Todesfälle wie bei den Teilnehmern, deren Lebensstil man nicht beeinflusst hatte. Die Studie wurde sogar vorzeitig abgebrochen, weil man keine großen Unterschiede zwischen den beiden Gruppen fand.
Allein diese Ergebnisse müssten jeden Leser stutzig machen, der schlanke Körper automatisch mit Gesundheit assoziiert (also eigentlich uns alle). Was die Autorin glaubwürdig macht, sind aber nicht unbedingt diese Studien. Sondern ein sehr geschickter Disclaimer, den sie in ihr Buch eingebaut hat.

Verbindung Krankheit-Speckgürtel
Natürlich, gibt sie zu, könnte man zu fast jedem Forschungsergebnis, das sie erwähnt, eine andere Studie finden, die das Gegenteil zeigt. Dafür gibt es eine Vielzahl an Ursachen - eine der wichtigsten ist, dass sowohl das Gewicht als auch die Gesundheit eines Menschen auf sehr komplexen körperlichen Mechanismen und Systemen basieren, die noch niemand vollständig versteht. Zudem ist die Übergewichtsforschung vor allem eine beobachtende Wissenschaft. Forscher können Versuchspersonen nicht einfach gezielt mästen, um auszuprobieren, ob sie davon krank werden. Sie können nur Menschen beobachten, die ohnehin schon einige Kilo mehr auf die Waage bringen. Auch deshalb seien Erkenntnisse zu Übergewicht, erklärt Brown, erstaunlich verwirrend und widersprüchlich.
Trotzdem werden sie einseitig wahrgenommen. Wenn man einen Hausarzt fragt, welche gesundheitlichen Risiken mit Übergewicht einhergehen, wird er wahrscheinlich Herzinfarkte, Schlaganfälle, Typ-II-Diabetes und eine Reihe anderer schwerer Krankheiten nennen. Was er wohl nicht erwähnen wird, vielleicht auch selbst nicht so differenziert, ist die Tatsache, dass die Studien, die das beweisen sollen, meistens über Korrelationen, nicht über kausale Zusammenhänge reden. Das ist ein wichtiger Unterschied, denn kausale Verbindungen zwischen Krankheiten und Speckgürteln sind immer noch schwer nachzuweisen.
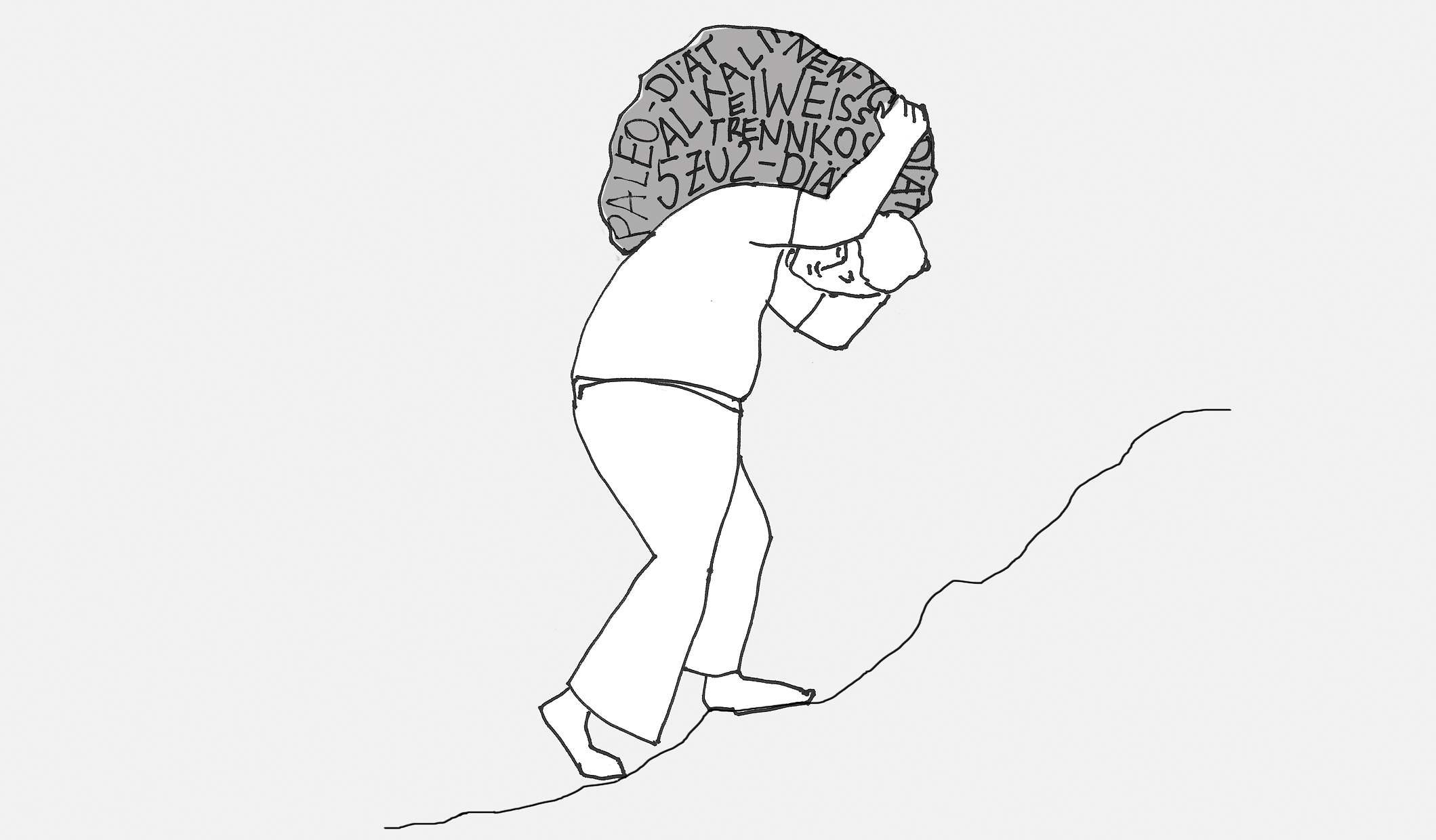
Bei manchen Risikofaktoren geht das einfacher: Rauchen etwa verursacht Lungenkrebs, das ist hinreichend erwiesen (trotzdem kriegt nicht jeder Raucher Krebs). Rauchen verursacht aber auch gelbe Zähne. Man kann also eine Korrelation zwischen gelben Zähnen und Lungenkrebs nachweisen, aber das heißt nicht, dass es zwischen Zahnfarbe und Krebs eine kausale Verbindung gibt. Ebenso kann man feststellen, dass Dicke öfter Diabetes II und Herzinfarkte bekommen. Aber das bedeutet nicht zwingend, dass Fett dafür die Ursache ist. So könnte, wie der Chirurg und Ernährungswissenschaftler Peter Attia meint, Übergewicht auch ein frühes Symptom von Diabetes sein. Mit anderen Worten: Wir wissen nicht sicher, was zuerst kommt, die Krankheit oder das Übergewicht. Außerdem könnte beides auch von unbekannten Drittvariablen verursacht werden. Stress, zum Beispiel.
Statistiken müssen interpretiert werden
Und schließlich ist da die Frage nach der Aussagekraft von Statistiken. “Es gibt drei Sorten von Lügen: Lügen, gemeine Lügen und Statistiken”, zitiert Brown Mark Twain. Und verweist darauf, dass Statistiken auf mathematischen Berechnungen basieren. Das erweckt den Eindruck, sie könnten präzise Beweise erzeugen. Doch egal, wie richtig die Berechnungen sind, das Ergebnis ist immer eine Sache der Interpretation, weil die Phänomene, die sie beschreiben, komplex sind. Deshalb widersprechen wissenschaftliche Studien einander so häufig. “Die meisten Leute halten Statistiken für schwarz-weiße, entweder-oder Statements: Entweder, dicker sein verkürzt das Leben, oder nicht. Aber so funktionieren weder das Leben noch Statistiken, letztere beschreiben normalerweise koexistierende Wahrheiten”, schreibt Brown. Deshalb kann man nachweisen, dass Übergewicht mit einer längeren Lebenserwartung einhergeht und auch, dass Adipositas das Leben verkürzt. Ein Forscher kann behaupten, dass Fett gefährlich ist, während der nächste meint, Hüftgold sei lebensverlängernd. Und in gewisser Weise würden beide Recht haben.
Der springende Punkt bei Brown ist nicht, dass sie eine endgültige Antwort geben kann. Sie will auch keine Studien widerlegen. Was sie zeigen will, ist, dass die Komplexität dieser Zusammenhänge nicht zu unserem Weltbild gehört. Wir haben ein sehr einfaches Bild: Fett ist schlecht. Jeder sollte abnehmen, bis er sein Normalgewicht hat. Dass dieser Normbereich quasi willkürlich definiert ist – geschenkt. Dass wir nicht wissen, ob Fett wirklich krank macht – egal.
Die stillschweigende Annahme lautet, dass Abnehmen ja auf keinen Fall schaden kann. Und schöner macht es sowieso.
Wir hassen Diäten, aber wir wollen sie
Hier liegt aber ein wichtiger Denkfehler. Denn wenngleich wir nicht sicher wissen, ob Schlanksein gesünder ist, gibt es in einer Sache Gewissheit: Diäten sind ineffizient und sie schaden durchaus. Wahrscheinlich hat jeder, der diesen Text liest, schon einmal in irgendeiner Schlagzeile den Satz „Diäten funktionieren nicht“ gelesen. Viele haben das auch intellektuell begriffen. Aber an unserer Wahrnehmung ändert das wenig.
Wir hassen Diäten, aber wir wollen sie unbedingt. In jedem Drogeriemarkt kann man Pulver für Abnehmshakes kaufen, Redakteure von Frauenzeitschriften (und zunehmend auch von Männermagazinen) wissen, wie wichtig Diäten für den Verkauf der Blätter sind. Was ziemlicher Wahnsinn ist, wenn man bedenkt, dass noch keine Studie beweisen konnte, dass Menschen, die mit einer Diät abgenommen haben, langfristig ihr Gewicht halten konnten. Egal, wie man seine Ernährung umstellt, ob man Kohlenhydrate weglässt, sich von Ananas und Reiscrackern ernährt oder vegan lebt: „Die Chance, dass man einen signifikanten Gewichtsverlust länger als fünf Jahre oder mehr halten kann, ist etwa gleich groß wie die Chance, metastasierenden Lungenkrebs zu überleben: 5 Prozent“, schreibt Brown. Mittlerweile gehen manche Ärzte und Biologen davon aus, dass jeder Körper einen „Setpoint“ hat, ein Gewicht also, das der Körper anstrebt. Dieser programmierte Punkt lässt sich, wenn überhaupt, nur mit großem Aufwand ändern. Ansonsten kehrt der Körper über kurz oder lang wieder zu seinem Normalgewicht zurück – das nicht unbedingt dem Normalgewicht entspricht, welches die BMI-Skala vorschreibt.
Das allein wäre noch nicht schlimm, denn es spricht im Prinzip nichts dagegen, mit Sport und einer der derzeit hippen Diäten (deren Grundlagen sich natürlich alle paar Jahre völlig ändern) immer mal wieder ein paar Kilos zu verlieren, wenn man unbedingt dünner sein möchte, als der eigene Körper es vorsieht, oder weil ein wohlmeinender Arzt dazu geraten hat. Man sollte allerdings wissen, dass dieser Kampf nicht aufhören und mit dem Älterwerden sogar härter werden wird, weil man mit den Jahren meistens auch Kilos zugewinnt.
Schwerer aber wiegt die Tatsache, dass wiederholte Diäten zahlreiche unschöne Nebenwirkungen haben können: In Studien hat sich zeigt, dass Jo-Jo-Diäten Herz-Kreislauf-Krankheiten vielleicht sogar stärker begünstigen als Übergewicht. Mal abgesehen von der psychischen Belastung, die ständige Diäten beziehungsweise ein dauerndes Unwohlsein mit dem eigenen Körper verursachen. Paradoxerweise fördern Diäten auf diese Weise sogar Übergewicht, weil die menschliche Psyche in der ihr eigenen rätselhaften Logik Mechanismen baut, die dazu führen, dass man unbewusst mehr isst, wenn man gehungert hat.
Dünnsein ja – Diät nein
Wenn man das alles zusammendenkt, wie Brown es getan hat, kommt man zu einem eigenartigen Schluss: Selbst wenn man beweisen könnte, dass Dünnsein gesünder ist, wäre es wahrscheinlich keine gute Idee, eine Diät zu machen. Brown meint, dass deswegen längst ein Umdenken hätte stattfinden müssen. Das allerdings ist nicht passiert. Und hier ist der Punkt, bei dem ihr Buch wirklich an Kraft gewinnt – und anfängt, ungemütlich zu werden. Denn die Autorin bringt eine Reihe recht überzeugender Argumente dafür, dass wir, Laien wie Fachleute, unsere Vorurteile gegen Fett nicht aufgeben wollen, weil wir aus unterschiedlichen Gründen ein Interesse daran haben, sie zu behalten.
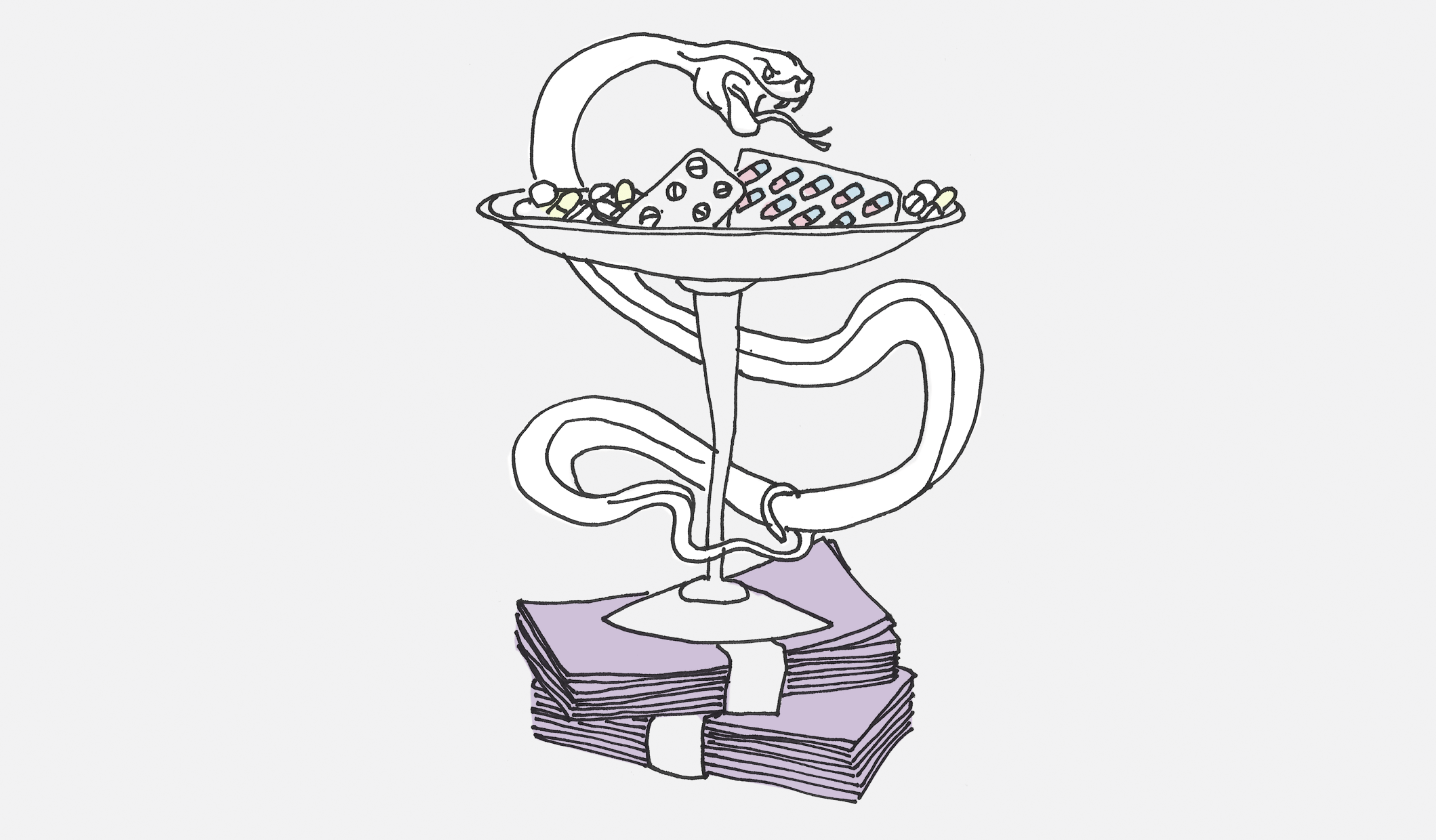
Das Fett-ist-böse-Dogma sei so stark, meint Brown, dass Ärzte und Forscher anderslautende Ergebnisse mit aller Kraft ignorieren oder irgendwie relativieren würden. Warum sonst, fragt sie, würden Ärzte übergewichtigen Patienten weiterhin reflexartig empfehlen, Gewicht zu verlieren? Wieso kriegt jeder Politiker verlässlich Sympathiepunkte, wenn er „den Kilos den Kampf“ erklärt oder „Übergewicht zur Chefsache“ macht (oder einen ähnlichen schlagzeilentauglichen Slogan verkündet)? Und warum ist es für Forscher so leicht, Gelder für Studien zu kriegen, deren Thema in irgendeiner Weise mit Übergewicht zu tun hat?
Diät-Produkte als Milliardengeschäft
Ein Motiv, das Brown nennt, ist so einfach wie unangenehm: finanzielle Interessen. Es gibt unterschiedliche Schätzungen darüber, wie hoch der Umsatz der Diät-Industrie weltweit ist – je nachdem, was man darunter fasst (zum Beispiel Frauen- und Männerzeitschriften, Fitnessstudios, Abnehmprogramme, Kurkliniken, Schönheitspraxen). Sicher ist nur, dass es um viele Milliarden geht. Unternehmen wie Weight Watchers (Jahresumsatz 2014 knapp 1,5 Milliarden Dollar) und Bodymed (Umsatz 2012: 7 Mio. Euro) dürften kein Interesse haben, die Erkenntnis zu verbreiten, dass ihre Produkte wahrscheinlich langfristig nicht wirken, ja die Probleme Abnehmgeplagter sogar verschlimmern könnten. Für die Unternehmen ist es ja eine gute Sache, wenn Kunden ihr Produkt immer wieder kaufen müssen.
Wie auch der deutsche Lebensmittelchemiker und ausgewiesene Diätgegner Udo Pollmer auf seiner Facebook-Seite schreibt: „Die Diätindustrie ist der einzige Wirtschaftszweig, der weltweit Milliarden damit verdient, dass seine Produkte nicht wirken.“ Dafür unterstützen die Vertreiber von Diätprodukten durchaus auch mal Wissenschaftler, die zu Fettleibigkeit forschen oder Empfehlungen für Übergewichtige formulieren. Dass etwa der ehemalige Präsident der Deutschen Adipositas Gesellschaft und Autor zahlreicher Studien, Professor Dr. med Hans Hauner, Artikel und Empfehlungen zu den gesundheitlichen Folgen von Übergewicht, als wissenschaftlicher Berater von Weight Watchers tätig war, ist bekannt. Das ist bei Forschungen im Bereich von Medizin, Pharmakologie und Biotechnologie aber nichts Besonderes.
Körpergewicht als soziale Abgrenzung
Solange die Autorin die böse Abnehmindustrie und mehr oder minder korrupte Forscher anprangert, hat man mit der Lektüre noch kein persönliches Problem, fühlt sich vielleicht sogar auf der Seite der Guten. Dann aber zeigt die Autorin plötzlich mit dem Finger auf den Leser. Es gibt eine tiefere Ursache dafür, sagt sie, dass wir Fett schlecht finden. Denn das Körpergewicht ist ein modernes Mittel sozialer Abgrenzung. Früher konnte man über seine Kleidung zeigen, ob man finanziell gut bestückt oder arm, gebildet oder unbelesen war. Körperliche Fülle galt als ein Zeichen von Wohlstand. Heute drückt man einen besseren Status über seine schlanke Linie aus, und indem man sich ausgiebig mit Ernährungsfragen beschäftigt, indem man die „richtigen“ und „guten“ Lebensmittel isst.
Mit anderen Worten: Der Wert einer Person wird auch daran gemessen, ob er sich mit ausgewogener Ernährung auskennt und in eine Superstretchhose passt. Deshalb, meint Brown, glauben wir bereitwillig Aussagen darüber, dass Fettpolster bei Menschen eine Folge von Disziplinlosigkeit, Maßlosigkeit und Faulheit sein sollen. Die vielbeklagte Fettleibigkeit „der Deutschen“ oder „der Amerikaner“ sei ja kein Problem der höheren Schichten, sondern vor allem eine Folge finanzieller Nöte.

Die “Venus von Willendorf” ist ein bekanntes Beispiel dafür, dass die Vorstellung idealer Körper eine Frage der Zeit ist. | Foto: Don Hitchcock. Abbildung mit Erlaubnis von Da Capo Press
Auch der deutsche Arzt und Autor Gunter Frank glaubt, hinter der gesellschaftlichen Debatte über Übergewicht stecke das Bestreben, Gewinner und Verlierer zu produzieren. „Evolutionssoziologen nennen das Gruppenmoral. Dann sind alle, die es schaffen, schlank zu sein, die Starken, alle anderen sind die Untermenschen. Jede Gesellschaft produziert diese Mechanismen (…) Es geht dabei gar nicht um Gesundheit, sondern darum, eine Verlierergruppe zu definieren, auf der man rumhacken kann. Man sagt ‘Wir müssen denen helfen’ - wohl ignorierend, dass man dadurch in besonders perfider Weise den moralisch Unterlegenen schädigt.“ (Hier geht es zum ausführlichen KR-Interview mit Gunter Frank.)
Dicke werden gedemütigt
Er könnte Recht haben: Dafür spricht die hässliche Tatsache, dass es im Gegensatz zu anderen Formen von Diskriminierung sozial akzeptiert ist, Dicke zu demütigen. Um das zu sehen, braucht man sich nur einmal die Kommentare zu einem Artikel ansehen, in dem es um Fettleibigkeit geht: So viel harsche Kritik und sogar unverhohlenen Hass auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe sieht man selten so offen zutage treten.
Vorschlägen, den Dicken höhere Krankenkassenbeiträge zuzumuten, wird applaudiert. Auch Ärzte haben, wie die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung beklagt, Vorurteile gegen dicke Patienten und gehen teils selbstverständlich davon aus, dass diese krank sind, weil sie zu viel wiegen.
Das ist besonders traurig, weil man mittlerweile ahnt, dass genetische Veranlagungen eine viel größere Rolle dafür spielen könnten, ob eine Person eher rund oder eher rank ist, als sein Lebensstil. Selbst schwere Fettleibigkeit (Adipositas) ist, wie der Präsident der Deutschen Adipositas Gesellschaft gesagt hat, „eine Krankheit des Gehirns, kein Lebensstil-Phänomen“. Einem Mann, der an Krebs oder multipler Sklerose leidet, würde man nie mit Häme und Schuldzuweisungen begegnen. Einem sehr dicken Menschen dagegen schon. Das ist grausam und zeigt, dass unser Verhältnis zu Körperfett schlichtweg gestört ist.
Rechtfertigung einer Couch-Potato?
Viele Menschen, sagt Brown am Ende, werden ihr Buch nicht ernst nehmen, werden es als langes Rechtfertigungs-Manifest einer Frau ansehen, die den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und Bonbons essen möchte. Den anderen, schreibt sie, möchte sie die Herausforderung mitgeben, die herrschenden Paradigmen über das richtige Körpergewicht anzuzweifeln. Und zwar auf eine tiefere Weise als Magazine, die Fotostrecken mit Frauen zeigen, die sich selbst ganz doll lieb haben, obwohl man sie nur mit einem großen Schuhlöffel in die Jeansgröße eines H&M-Models stopfen könnte.
Brown stellt dazu eine wichtige Frage: Was verstehen wir eigentlich unter Gesundheit? In den Seminaren über Körperbilder, die sie an der Syracuse University gibt, fragen Studenten sie, wie eigentlich ein normales Essverhalten aussieht. Sie wissen es nicht mehr, weil sie jeden Bissen danach analysieren, ob er gesund oder ungesund ist, kalorienreich, fett oder sündig ist. Kann man einen Menschen, dessen Figur dem Schlankheitsdogma entspricht, der aber keine Mahlzeit ohne Stress und Schuldgefühle zu sich nehmen kann, wirklich als gesund bezeichnen? Einer ernsthaften Auseinandersetzung mit diesem Thema müsste eine neue Definition von Gesundheit entspringen: Eine, bei der nicht ein bestimmter Bauchumfang das entscheidende Kriterium ist, sondern Faktoren wie seelisches Wohlbefinden, körperliche Fitness (ja, man kann dick und sportlich sein), und Glück.

Foto: Jamie Young
Harriet Brown arbeitet seit 30 Jahren als Wissenschaftsjournalistin. Sie lebt in Syracuse, New York und lehrt an der dortigen Universität über Medien und Kommunikation im Gesundheitsbereich. Wie verzerrt die Körperwahrnehmung ihrer Mitmenschen ist, erlebte sie in besonders drastischer Weise, als ihre eigene Tochter magersüchtig wurde. An einem Punkt, an dem das Mädchen so dünn war, dass sie ins Krankenhaus musste, bekam sie immer noch von allen Seiten Komplimente dafür, wie toll sie aussah.
Illustrationen: Veronika Neubauer