Als Mitglied hast du Zugriff auf diesen Artikel.
Ein Krautreporter-Mitglied schenkt dir diesen Artikel.
ist Krautreporter-Mitglied und schenkt dir diesen Artikel.
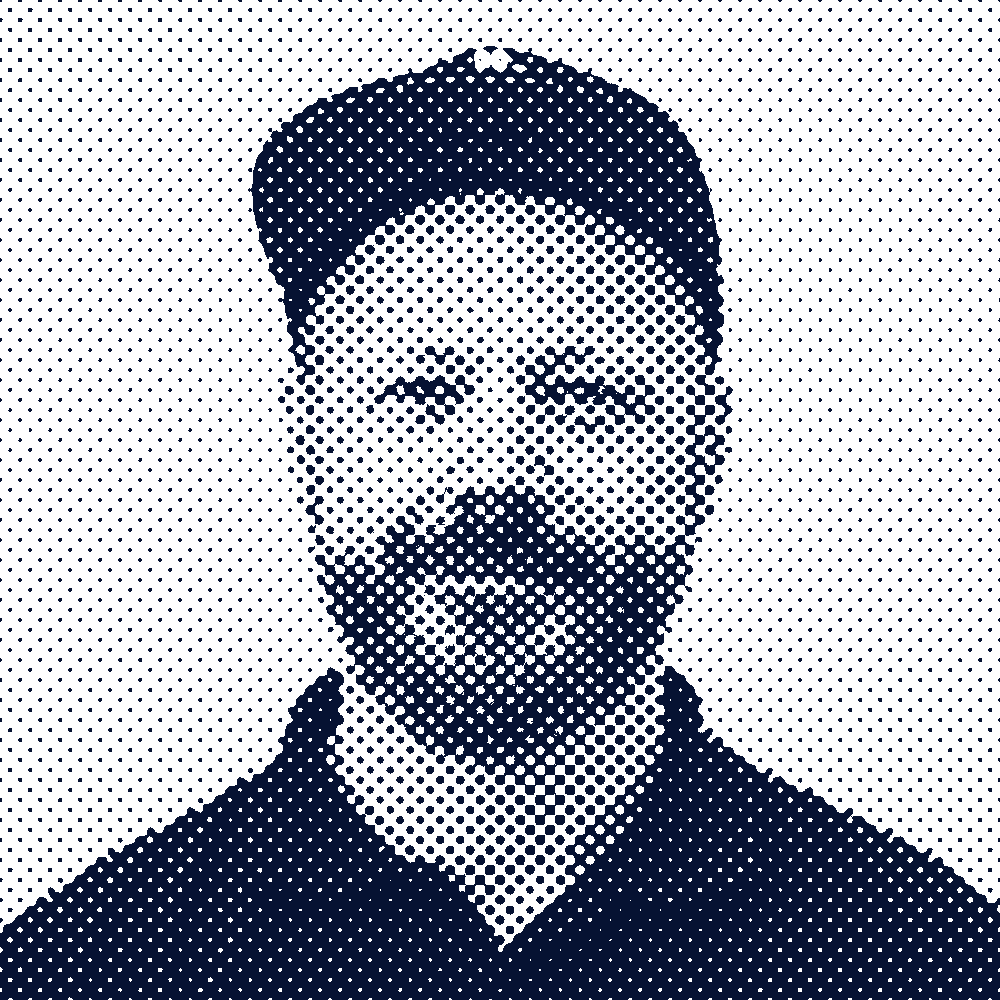
Hi!
Als ich vor ein paar Jahren in die Psychiatrie musste, war ich frisch verliebt. Wochen zuvor hatte ich eine Frau kennengelernt und es fühlte sich an, als ob wir zusammengehörten. Für immer.
Doch schon, als ich in der Notaufnahme saß und dem Arzt erzählte, dass ich suizidal sei und nicht aufhören konnte zu weinen, spürte ich, dass ich Angst hatte davor, verlassen zu werden, weil ich krank war.
Das wurde nicht besser, als meine Freundin eine Woche später meinte, sie würde jetzt in den Urlaub fahren, sie bräuchte das. Mir graute, dass etwas nicht stimmte. In ihrer Stimme lag etwas Schweres.
Jeden Tag machte ich mir Sorgen um den einen Anruf, in dem sie mir erklärte, es sei aus mit uns. Ich erzählte davon einer Gesundheitspflegerin, die meinte: „Herr Gommel, machen sie mal einen Realitätsabgleich. Wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass sie Sie jetzt verlässt?“
Das sah ich ein. Wahrscheinlich hatte die Pflegerin recht. Schließlich war die Angst, verlassen zu werden, auch ein Grund dafür, weshalb ich depressiv wurde. Also arbeitete ich daran, die loszuwerden. Sprach in der Psychotherapie darüber. Mit Mitpatient:innen. Ich rief sogar meinen Psychotherapeuten an, der mich konfrontierte: „Diese Angst ist der Grund dafür, dass du in der Psychiatrie bist.“
So übte ich das Loslassen. Stellte mir jeden Tag vor, meine Freundin gehen zu lassen. Dahinter lag eine unbeschreibliche Freiheit. Ich begann, innerlich aufzuatmen, in kleinen Zügen. Immer, wenn mich die Panik packte, übte ich mich darin, nicht zu klammern.
Statt die Beziehung in den Mittelpunkt meines Lebens zu stellen, konzentrierte ich mich auf das, was ich hatte: mich. Ich ging zur Ergotherapie und bastelte einen (hässlichen) Korb. Tanzte in der Bewegungstherapie und lernte in der Gruppentherapie, über meine Krankheit zu sprechen.
Eine Woche vor meiner Entlassung rief meine Freundin mich an. „Martin, ich kann das nicht mehr.“ Doch jetzt war ich nicht mehr verzweifelt, sondern richtig angepisst. Ich sagte ihr: „Gut, aber wir bleiben keine Freunde. Du gehst ab jetzt deinen Weg und ich meinen.“ Dann legten wir auf.
Im Speisesaal weinte ich ins Abendbrot. Verkrümelte mich ins Zimmer, schaute eine Serie und betrauerte die Trennung. Ja, es war schlimm. Aber es war nicht das Ende der Welt. Denn ich hatte einen Teil meiner Angst besiegt.
Text der Woche⬆ nach oben
Frage der Woche⬆ nach oben
Was macht für dich einen guten Morgen aus?
Antwort gern per E-Mail an weird@krautreporter.de.
Eure Antworten⬆ nach oben
Theresa hat neulich gefragt, welche lustigen Fehler euch beim Sprechen von Fremdsprachen passiert sind. Doro antwortete:
Das ist mir in England passiert, in einer Unterhaltung über die Zeugen Jehovas. Ich wusste nicht mehr, was „Zeugen“ auf Englisch heißt, und weil ich sehr gut Spanisch spreche, habe ich mir von dort eine Eselsbrücke versprochen. Auf Spanisch sind Zeugen „testigos“. Das Ergebnis, das dann spontan aus mir heraussprudelte, war: „Jehova’s testicles“. Mein Gegenüber war leicht verwirrt, aber wie meine Mutter ebenfalls in England einmal zu sagen pflegte: What shall’s.
Falks Blick auf die Welt⬆ nach oben

Bis nächste Woche
Martin