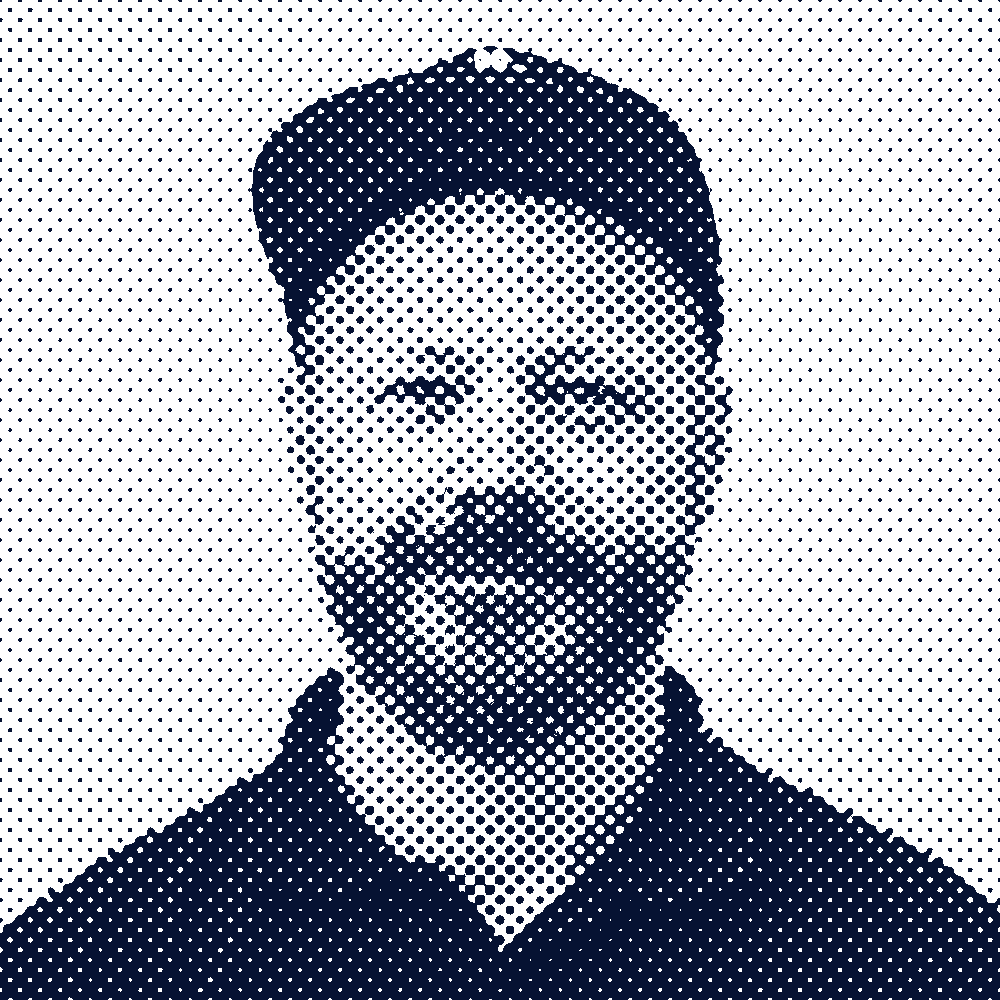Als ich vor ein paar Jahren die Hoffnung verlor, wurde mein Leben auf einen Schlag besser. Das erscheint vielleicht unlogisch. Denn Hoffnung gilt seit Jahrtausenden als erstrebenswert.
Schon in der Bibel jubelt Paulus im ersten Korintherbrief: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei.“ Im Deutschen sagt man: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Auch heute wird sie als Allheilmittel verkauft. „Multiple Krisen treffen auf vielfältige Ängste“, steht auf Herbert Grönemeyers Album „Das ist los“. Die Lösung: „Hoffnung. Mut. Und vor allem: Zusammenhalt.“ Der vergangene Parteitag der Linken trug sogar das Motto „Die Hoffnung organisieren“.
Wir haben unsere Community gefragt, ob sie Hoffnung wichtig findet. 87 Prozent von über 400 Teilnehmer:innen bejahten das, nur fünf Prozent hielten sie für realitätsfremd. Dana antwortete auf die Frage, ob es ihr schwerer als sonst falle, hoffnungsvoll zu sein: „Natürlich, klar, aber ohne Hoffnung kann man nicht leben.“
Hoffnung ist so wichtig für die Menschheit wie Leberkäse für Markus Söder. Ohne geht es nicht. Dabei macht Hoffnung die Probleme, die eh schon bestehen, noch schlimmer. Und es ist hilfreicher, die Hoffnung ganz loszuwerden.
Ich habe in keiner Therapie das Hoffen gelernt
Die Sehnsucht nach Hoffnung erscheint mir wie der Trend, Babys in Blumentöpfe zu setzen: Sieht süß aus, macht kurz „aww“, ist aber vor allem Kitsch.
https://www.instagram.com/p/C_EYKfwSVEn/?locale=de-DE
Als Kleinkind saß ich nicht in Töpfen, sondern in Spiel- und Familientherapien. Im Erwachsenenalter war ich fünfmal für jeweils mehrere Wochen in der Psychiatrie und habe zusätzliche Gesprächstherapien gemacht. „Durchtherapiert“ könnte in den Bios meiner sozialen Netzwerke stehen.
In keiner (!) einzigen (!) Sitzung habe ich das Wort „Hoffnung“ gehört. Kein:e Therapeut:in hat mir auf die Schulter geklopft und gesagt: „Herr Gommel, Sie sind eine arme Wurst. Aber keine Sorge, das wird schon wieder.“ Stattdessen habe ich gelernt, mich den Alltagsproblemen zu stellen.
Als ich 2012 meiner Psychotherapeutin gegenübersaß, kochte ich vor Wut. Ich erzählte ihr von meinem Freund Jan, der mich seit Jahren bei Verabredungen entweder sitzen ließ oder zu spät kam – ohne sich zu entschuldigen. Meine Bitte, das zu ändern, ignorierte er.
Dann erklärte ich der Therapeutin meinen Plan: Ich wollte Jan noch eine Chance geben. Ihn fragen, warum er sich so verhielt und ihm sagen, dass mich sein Verhalten ärgerte. Statt mich aufzumuntern und mir Hoffnung zu machen, sagte meine Therapeutin nur einen Satz: „Meinen Sie wirklich, dass sich Ihr Freund jemals ändern wird?“ Ich stockte und musste nachdenken. „Nein“, antwortete ich. Jan war ein hoffnungsloser Fall und mir war sofort klar, dass die Freundschaft für mich keine war.
Diese Frage hat meine Einstellung zur Hoffnung verändert
Statt Hoffnung zu üben, bekam ich in meinen Psychotherapiesitzungen einen Realitätscheck verpasst. Die Frage, ob sich mein Freund jemals ändern würde, war so einer.
Egal, in welcher Therapie ich saß: Immer wieder ermunterte man mich dazu, Situationen und das Verhalten anderer nicht schönzureden und mich Konflikten zu stellen. Hoffnung wurde mir nicht empfohlen, sondern ausgetrieben.
Stattdessen lehrten mich viele Therapeut:innen eine andere Strategie – und zwar eine Frage, die ich beantworten musste: „Was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht?“
Im Fall von Jan war die Antwort klar: die Freundschaft beenden. Das tat weh, aber ich wusste, es war die richtige Entscheidung, weil die Unzuverlässigkeit nur eine von vielen Eigenschaften war, die mich an ihm ärgerten.
Klar hätte ich mir wünschen können, dass er irgendwann pünktlich ist. Insgeheim hatte ich das gehofft, denn ich mochte Jan. Deshalb habe ich jahrelang meinen Frust ignoriert.
In stressigen Situationen stelle ich mir noch heute die „Was-kann-ich-tun“-Frage. Sie ist das Gegenteil von Hoffnung und besteht aus drei wichtigen Teilen:
- „Was kann ich jetzt tun?“ Die volle Verantwortung, etwas zu ändern, liegt bei mir. Das steht im Gegensatz zur Erwartung, dass sich äußere Umstände ändern.
- „Was kann ich jetzt tun?“ Nicht später, sondern jetzt, dieser Moment ist relevant. Hoffnung schaut in die Zukunft, aber diese Frage erlaubt mir das nicht, und das ist vorteilhaft.
- „Was kann ich jetzt tun?“ Aktion, nicht Emotion, darum geht es. Wenn ich mich besser fühlen will, muss ich etwas tun und nicht darauf warten, dass mir das in der Zukunft abgenommen wird.
Deine Hoffnung verrät vor allem, wovor du Angst hast
Ich bin nicht der Erste, der das Prinzip der Hoffnung kritisiert. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche ist dafür bekannt, Selbsttäuschungen und Lebenslügen aufzudecken, mit denen sich Menschen das Leben angenehmer machen. Vielleicht hielt er deshalb wenig von Hoffnung.
In „Menschliches, Allzumenschliches“ schrieb er: „Die Hoffnung: sie ist in Wahrheit das übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert.“ Auf Reddit habe ich dazu dieses herrliche Meme gefunden:
Meme: Reddit (r/Nietzsche)
Konrad Paul Liessmann, österreichischer Essayist, erklärt, was Nietzsche damit meinte: „Nietzsche wusste um die Fallstricke der Hoffnung, vor allem, wenn wir in großem Stil auf ein besseres Leben, eine menschenfreundlichere Zukunft, einen geretteten Planeten hoffen.“
Wenn dieser Wunsch nicht erfüllt wird, verlängert sich unsere Qual. Deshalb ist sie das übelste der Übel. Sie setzt den Krisen, die wir erleben, noch einen drauf, wenn sich, trotz unseres Hoffens, nichts zum Besseren wendet. In meinen Worten: Hoffnung ist Bullshit.
Beim niederländischen Philosoph Baruch de Spinoza entdeckte ich eine schlaue Einsicht, die er im 17. Jahrhundert ins dritte Buch der Ethik schrieb: „Es gibt keine Hoffnung ohne Angst, aber auch keine Angst ohne Hoffnung.“
Wait, what? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Philosophin Ortrun Schulz erklärt es: „Der Furcht vor Krankheit entspricht beispielsweise die Hoffnung auf Gesundheit und umgekehrt.“ Wenn ich den ganzen Tag hoffe, keine Grippe zu bekommen, habe ich Angst vor der Grippe.
Worauf hoffst du? Auf welche positiven Zukunftsmomente? Vielleicht verrät das, wovor du Angst hast.
Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Zuletzt sterben wir
Ich glaube, wir belügen uns oft selbst, um uns besser zu fühlen, wenn um uns herum alles kaputtgeht. Hoffnung ist dabei unsere Lieblingsdroge: Wir malen uns eine beruhigende Zukunft aus und das ist eine mentale Ibuprofen-Tablette gegen den täglichen Weltschmerz. Solange die Dosis stimmt, funktioniert das ganz gut.
Problematisch wird es aber, wenn die Krisen überhandnehmen und die Realität uns wachrüttelt. Dann wirkt unsere Droge nicht mehr, die Wirkung lässt nach. Was tun wir also? Wir versuchen verzweifelt, uns vor der schlechten Realität abzuschotten – machen Internet-Detox, schränken unseren Nachrichtenkonsum ein oder lesen nur noch „gute Nachrichten“.
Das mag sich kurzfristig wie eine Lösung anfühlen. Dabei sind wir auf kaltem Entzug von unserer gewohnten Dosis Hoffnung und versuchen krampfhaft, die schreckliche Realität auszublenden.
„Die Hoffnung stirbt zuletzt“ – dieses Sprichwort zeigt, wie abhängig wir sind. Und es verdreht die Tatsachen. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Zuletzt sterben wir.
Vielleicht sollten wir den Realitycheck meiner Therapeutin machen: Glaube ich wirklich, dass Russland sich dazu bewegen lässt, demnächst die Ukraine in Ruhe zu lassen? Glaube ich wirklich, dass die USA bald wieder normal werden? Glaube ich wirklich, dass die AfD mit Argumenten zu schlagen ist?
Du bist nicht pessimistisch, wenn du gerade keine Hoffnung hast
Wenn du angesichts der gesellschaftlichen Krisen hoffnungslos bist, möchte ich dir sagen: Das ist in Ordnung! Mach dir bitte keinen Stress, neue Hoffnung zu schöpfen. Du musst nicht ständig neue Gründe suchen, warum die Zukunft nicht so schlimm wird. Deshalb bist du kein:e Zyniker:in, Pessimist:in oder jemand, der oder die schnell aufgibt.
Es kann ein Akt der Selbstfürsorge sein, dich von dieser Pflicht, solltest du es so empfinden, zu befreien. Das kann Energie freisetzen, um dich auf das zu konzentrieren, was du wirklich in der Hand hast. Ich denke an das Gelassenheitsgebet des Theologen Reinhold Niebuhr:
Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Ich mag das Gebet, denn es funktioniert auch ohne Gott und beten. Wenn wir die Hoffnung ziehen lassen, können wir lernen, die Dinge zu akzeptieren, die wir nicht ändern können. Und uns auf die konzentrieren, die wir ändern können.
Redaktion: Isolde Ruhdorfer, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert