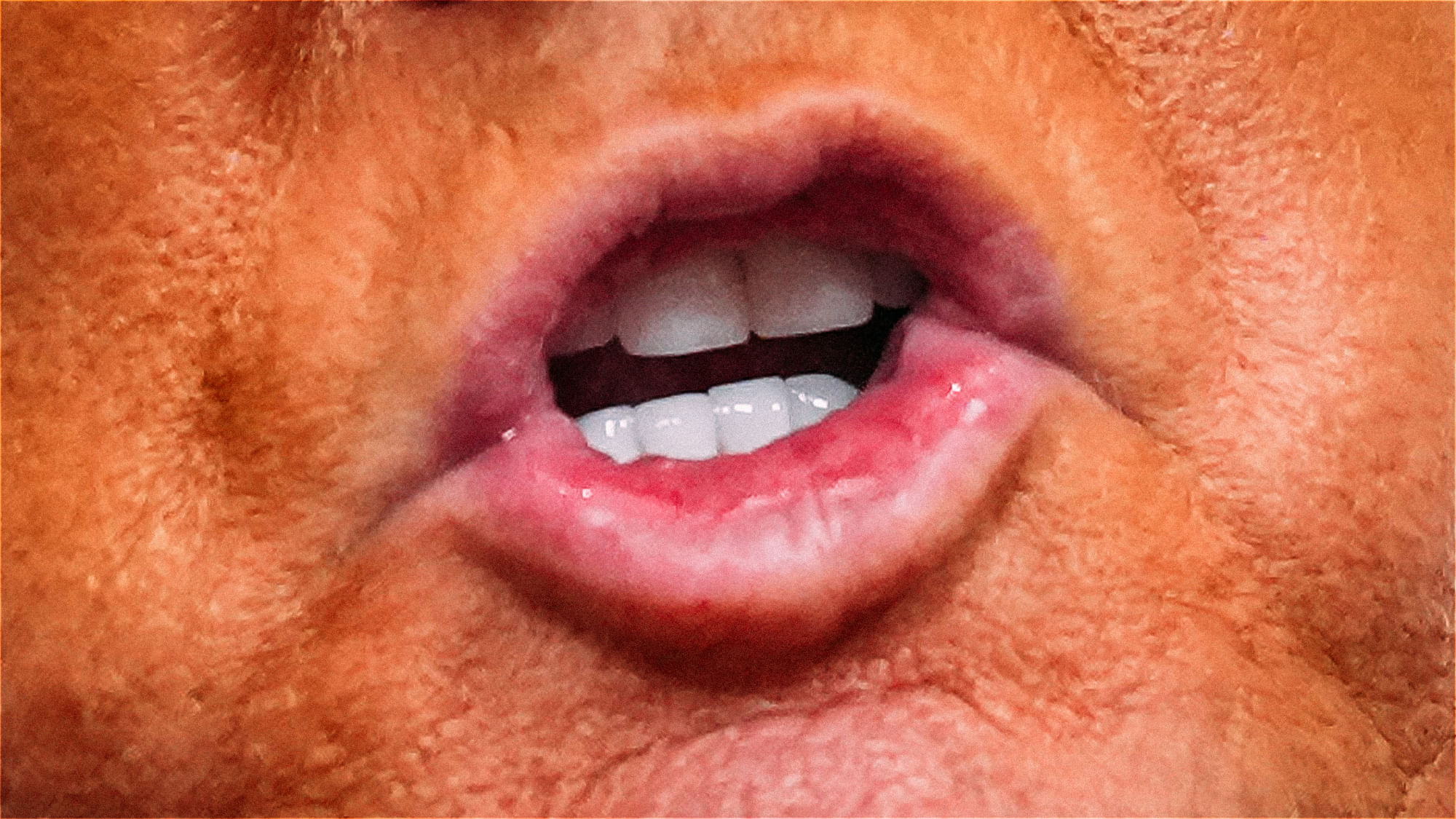Es gibt eine Krankheit, an der viele Politiker:innen und Journalist:innen leiden. Diese Krankheit hat keinen Namen, aber man könnte sie „Floskel-Grippe“ oder „Phrasen-Fieber“ nennen. Politiker:innen und Journalist:innen benutzen oft hochtrabende Ausdrücke, um über Kriege, Konflikte und die Beziehungen zwischen Ländern zu sprechen. Doch je länger man darüber nachdenkt, was diese Ausdrücke bedeuten, desto inhaltsleerer werden sie. Schlimmer noch: Sie können sogar zu falschen Annahmen führen.
Jörg Lau schreibt seit 20 Jahren bei der Zeit über Außenpolitik. Er kennt diese Phrasen und er hat sie schon selbst benutzt. Diese Floskeln liefern Sicherheit in einer zunehmend unsicheren Welt. Dabei verschleiern sie Probleme, verbergen Interessen und sie können zu Fehlern in der Politik führen. Ein gutes Beispiel dafür ist „Wandel durch Handel“, also der Glaube, dass eine wirtschaftliche Annäherung an Russland auch zu einer friedlichen Beziehung führen könnte.
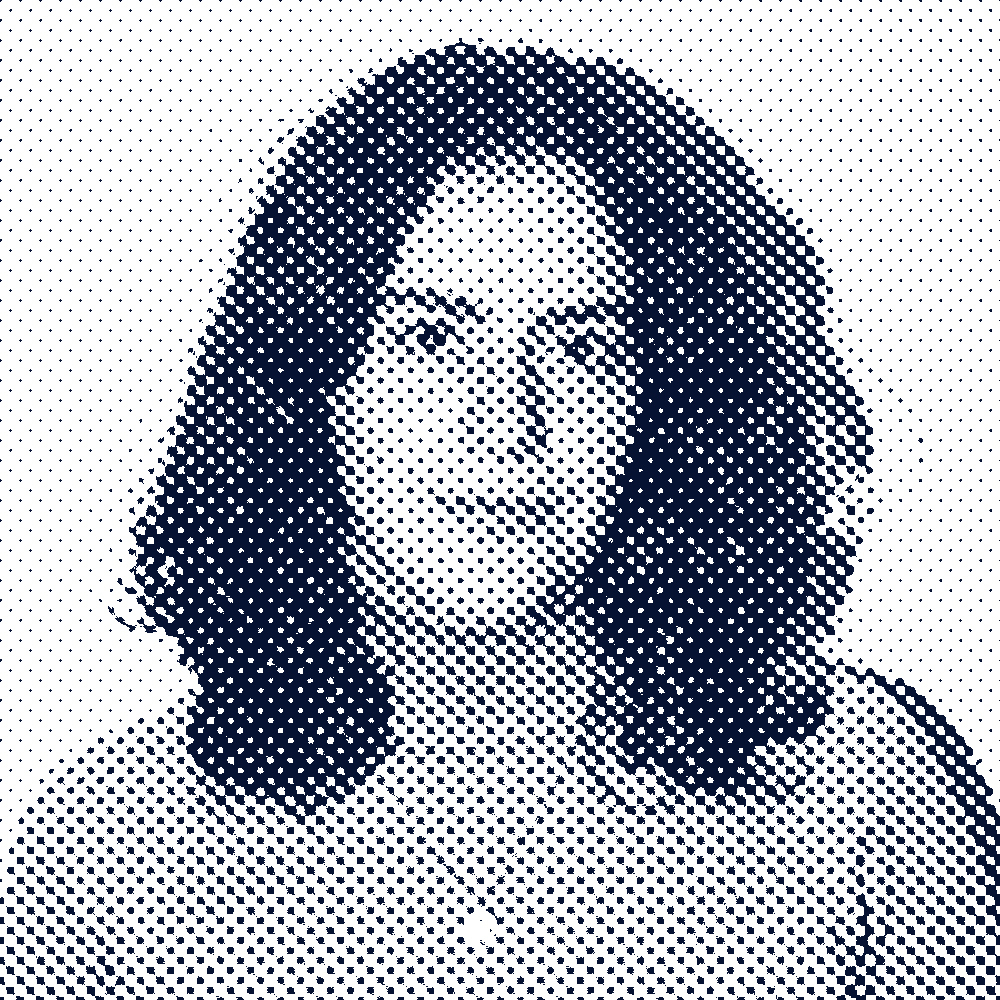
Diesen Buchauszug hat Isolde Ruhdorfer ausgewählt
Isolde schreibt seit einigen Jahren für Krautreporter über Außenpolitik. Genauer gesagt über alles, was außerhalb Deutschlands passiert, aber uns trotzdem betrifft. Denn alles hängt mit allem zusammen.
In seinem Buch „Worte, die die Welt beherrschen“ zählt Jörg Lau 80 solcher Phrasen der Außenpolitik auf, erklärt deren Bedeutung und liefert Kontext. Fünf davon habe ich für diesen Buchauszug ausgewählt. Entweder, weil es mich stört, wenn andere sie verwenden oder weil ich feststellen musste, dass ich sie selbst schon benutzt habe. Wer sich für Politik interessiert und gerne selbst diskutiert, für den ist dieser Auszug eine gute Anleitung, um sich selbst und andere zu hinterfragen.
Flächenbrand: Ein Klischee, das ganze Teile der Welt entmündigt⬆ nach oben
Dies ist das beliebteste Krisenklischee von allen. Es wird häufig mit Bezug auf den Nahen Osten, den Balkan oder andere Regionen am Rande der westlichen Aufmerksamkeit benutzt, wie etwa die Sahel-Region.
Flächenbrand ist eine Metapher für Kontrollverlust. Dass der Begriff so häufig verwendet wird, lässt auf schwindende westliche Macht schließen. Denn wer vor einem Flächenbrand warnt, hat ja offenbar eingeschränkte Eingriffsmöglichkeiten. Um im Bild zu bleiben: Ist der Flächenbrand erst einmal entfacht, kann die Feuerwehr nicht mehr viel machen. Wer vor seinem Ausbruch warnt, spricht aus einer Position der Vernunft, die sich von der Unbeherrschtheit derjenigen abhebt, die „zündeln“ und leichtfertig ein Großfeuer riskieren.
Das Flächenbrandklischee hat unverkennbar einen kolonialen Touch: hier die nüchternen westlichen Mahner, die die Gefährlichkeit der Lage überblicken; dort die leicht entflammbaren Akteure, die ihre Leidenschaften nicht kontrollieren können. So sind sie halt, die Leute auf dem Balkan, in Nahost oder Afrika – Gefangene ihrer Leidenschaften, die sich leicht wechselseitig entzünden.
Kurz nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 meldete sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit einer Solidaritätsadresse. Er stellte sich zunächst an die Seite Israels und dessen Rechts auf Selbstverteidigung. Dann ergänzte er, es müsse nun alles getan werden, „dass aus diesem Überfall kein Flächenbrand mit unkalkulierbaren Folgen für die gesamte Region wird“.
Was sollen derartige Mahnungen erreichen? Man kann die Uhr danach stellen – wann immer irgendwo südlich oder östlich unserer Breiten ein Konflikt ausbricht, legt ein deutscher Politiker (oder Experte) die Stirn in Falten und spricht mit tremolierender Stimme Warnungen aus.
Nach dem Putsch in Niger von 2023 warnten Experten, aus einem Militärschlag könne „sehr schnell ein Flächenbrand werden“. Ähnlich heißt es anlässlich des anhaltenden Konflikts zwischen dem Kosovo und Serbien: Die Gefahr sei groß, dass „eine Fehlkalkulation zu einem Flächenbrand führt“. Manchmal wird noch ein weiteres Klischee nachgeschoben: Der Balkan (Taiwan, Kaschmir, Kurdistan) gleiche bekanntlich einem „Pulverfass“.
An wen richtet sich das eigentlich? An alle Beteiligten? Tatsächlich veröffentlicht die Bundesregierung im Krisenfall oft Appelle, in denen „alle Konfliktparteien zur Mäßigung aufgerufen“ werden. Natürlich rechnet niemand ernsthaft mit dem Erfolg solcher Belehrungen. Was ist dann ihr Sinn? Sie dienen wohl vor allem der Selbstdarstellung nach innen, zur eigenen Bevölkerung hin, der man sich als Kraft der Besonnenheit und Zurückhaltung präsentieren will.
Im Umkehrschluss ergibt sich, warum das Flächenbrandklischee so problematisch ist: Es stellt implizit die Weltgegenden, auf die es bevorzugt angewandt wird, als hilflose, unzivilisierte, von niederen Leidenschaften beherrschte Regionen hin. Dort, wo die wilden Kerle wohnen, treiben Akteure ihr Unwesen, die offenbar passionsgetrieben und entscheidungsschwach sind. Sie haben keine eigenen Ressourcen des Konfliktmanagements, wenn erst einmal „die Funken fliegen“.
Die Warnung vor einem Flächenbrand entmündigt ganze Teile der Welt. Sie ist eine Form des Orientalismus.
Der Westen: Ja, er hat doppelte Standards – doch das hat einen Trost⬆ nach oben
Wann hat es angefangen, dass vom „Westen“ nur noch in diesem gequälten Ton die Rede war? Der Triumphalismus am Ende des Kalten Krieges, den der Westen gewonnen zu haben glaubte, kippte in eine handfeste Depression um. Irgendwann – nach der Finanzkrise, den gescheiterten Interventionskriegen und dem Brexit – hörte es einfach auf, das Reden vom Westen als einer Wertegemeinschaft.
Es klang hohl angesichts der Spätfolgen der kolonialen Vergangenheit, der katastrophalen geopolitischen Fehlentscheidungen (Afghanistankrieg/Irakkrieg) und des Aufstiegs illiberaler Mächte innerhalb westlicher Staaten. Innerlich gespalten, diskreditiert und demoralisiert, so stand der Westen am Ende des letzten Jahrzehnts da – eine historische Formation, die überlebt zu sein schien. Den Gipfel der Trübseligkeit erklomm die Münchener Sicherheitskonferenz von 2020, die sich unter das Motto Westlessness – also Westlosigkeit – stellte. Das Hochamt euroatlantischer Selbstvergewisserung kreiste um die eigenen Selbstzweifel.
Jetzt aber ändert sich das gerade wieder. Der Westen ist wieder da, und das paradoxerweise, während er von innen und außen attackiert wird wie noch nie. Oder vielleicht gerade wegen dieser Angriffe? Das russische Regime sieht sich in der Ukraine im Kampf mit dem „kollektiven Westen“. Diese Diktion kam bezeichnenderweise auf, als die „Spezialoperation“ ins Stottern kam – eine entlastende Erklärung für die demütigende Tatsache, dass es dem vermeintlich übermächtigen Russland nicht gelang, die Ukraine zu überrollen.
Es stimmt zwar nicht, dass in der Ukraine ein Stellvertreterkrieg mit dem Westen ausgetragen wird, wie die russische Propaganda behauptet, aber dieser Krieg hat doch dazu geführt, dass die wichtigsten Institutionen des Westens sich auf ihre Kernaufgaben rückbesinnen. Die NATO ist gewachsen und konzentriert sich wieder auf die Einhegung und Abschreckung Russlands. Die EU hat verstanden, dass sie in Zentraleuropa als Ordnungsmacht auftreten muss, und hat darum begonnen, die Ukraine zu integrieren.
Das Auffällige daran: Beides sind defensive Aufgaben. Es geht nicht um Expansion, sondern ums Arrondieren und Absichern. Die Ukraine muss vom Westen verteidigt und integriert werden, weil sie schon längst dazugehört. Es wird am Rande Zentraleuropas – wenn es denn gelingt – ein neuer Eiserner Vorhang entstehen, hinter dem der Westen sich vielleicht konsolidiert.
Anders als in Zeiten des ersten Kalten Krieges fehlt die missionarische Idee, das Sendungsbewusstsein. Der Westen leidet an einer Art politischer Autoimmunkrankheit. Innerhalb der westlichen Ordnung erstarken nationalpopulistische Bewegungen, die die Errungenschaften des westlichen Universalismus ablehnen. Menschenrechte, Pressefreiheit, Gewaltenteilung, Marktwirtschaft und andere Elemente der freiheitlichen Demokratie gelten westlichen Herrschern vom Typ Trump, Orbán, Le Pen und Netanjahu nur noch als Hindernisse bei der ethnonationalistischen Ermächtigung.
Das führt zum Vorwurf westlicher Doppelmoral in weiten Teilen der Welt: Spart euch die Lektionen über gute Regierungsführung, die Rechtsstaatsdialoge und Menschenrechtsseminare! Kümmert euch um eure eigenen Gesellschaften! Die Kritik der missionarischen Idee des Westens kann heilsam sein. Der Hinweis auf doppelte Standards ist berechtigt – und er enthält einen Trost. Denn seine Ideale kann nur verraten, wer überhaupt welche hat.
Globaler Süden: Dieser Begriff führt in die Irre⬆ nach oben
Im Entwurf für ein neues außenpolitisches Programm der SPD kommt der Begriff „Globaler Süden“ 16-mal vor – auf nur 21 Seiten. Auch anderswo ist er enorm populär, wie neuerdings bei der Münchener Sicherheitskonferenz, dem jährlichen Treffen von Militärs, Politikern und Diplomaten, oder beim G7-Gipfel.
Westliche Politiker begannen den Begriff exzessiv zu benutzen, als die Unterstützer der Ukraine weltweit Alliierte suchten – und ernüchtert feststellten, dass die großen Akteure des Global South wie Indien, Südafrika oder Brasilien den Konflikt keineswegs als ihren ansahen. Führende Nationen, die man ehemals als Schwellen- oder Entwicklungsländer bezeichnete, entzogen sich der Vereinnahmung: der Westen allein zu Haus.
Das ist aber nicht die ganze Geschichte.
„Globaler Süden“ ist auch ein Sehnsuchtsbegriff. Er beschreibt die Hoffnung auf eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung. Eine fairere Weltordnung, in der nicht allein die früheren Imperialmächte und die USA die Regeln bestimmen; eine wahrhaft postkoloniale Welt, in der die Dominanz des Globalen Nordens durch starke Süd-Süd-Beziehungen gekontert wird.
Die Ungerechtigkeit der postkolonialen Weltordnung vereint tatsächlich viele Länder des Globalen Südens: schlechte Versorgung mit Impfstoffen während der Coronapandemie, überdurchschnittliche Betroffenheit durch Folgen des Klimawandels, hohe Verschuldung und unfaire Bedingungen auf den Weltmärkten – das sind geteilte Beschwerden.
Dass der Globale Süden als politisches Subjekt dennoch eine Chimäre bleibt, liegt an den Differenzen der Länder, die mit dem Begriff zusammengespannt werden. Er ist erkennbar ein Erbe des Konzepts der Blockfreien aus dem Kalten Krieg – jener Staatengruppe, die zwischen West- und Sowjetblock balancierte. Bezeichnenderweise heißt die erste wissenschaftliche Zeitschrift, die sich ausschließlich mit dem Globalen Süden beschäftigt: Bandung. A Journal of the Global South. Im indonesischen Bandung hatten sich 1955 zahlreiche Staaten Asiens und Afrikas zusammengeschlossen, viele von ihnen waren gerade erst unabhängig geworden; auch Maos China war dabei.
Inzwischen hat eine enorme Binnendifferenzierung unter den ehemaligen Schwellenländern stattgefunden. Peking tritt in Teilen Afrikas heute wie ein Nachfolger der westlichen Imperien auf. Es ist nicht nur an Rohstoffen und Arbeitskräften interessiert, sondern baut diplomatische, institutionelle und militärische Partnerschaften auf, um eigene Großmachtansprüche durchzusetzen. Der Nachbar und Konkurrent Indien sieht den Aufstieg mit Sorge und versucht sich seinerseits in Gegenmachtformation zum gefährlichen Nachbarn. Delhi fürchtet auch, dass Moskau – traditionell Hauptlieferant der indischen Armee – infolge des Debakels in der Ukraine immer stärker von Peking dominiert wird.
Es klingt heuchlerisch, wenn Politiker im Westen nun beschwören, man wolle eine gerechtere Ordnung „gemeinsam mit den Nationen des Globalen Südens“ errichten, selbstverständlich „auf Augenhöhe“. Dabei vereint diese Nationen kaum etwas außer der Tatsache, einst durch den Globalen Norden übervorteilt worden zu sein.
Der Begriff des Globalen Südens führt in die Irre. Er suggeriert gemeinsame Interessen und Werte, wo es darauf ankäme, endlich die feinen Unterschiede wahrzunehmen.
Staatsräson: Deutschland ist Israel gegenüber politikunfähig geworden⬆ nach oben
Manche Sätze schauen umso rätselhafter zurück, je länger man sie betrachtet – wie Angela Merkels Formel von der Sicherheit Israels als „Teil der deutschen Staatsräson“. 2008 hatte die Kanzlerin dieses Axiom in der Knesset aus Anlass von Israels 60. Jahrestag eingeführt. Sie hatte das Wort von dem Sozialdemokraten Rudolf Dressler – deutscher Botschafter in Israel – übernommen. 2005 schrieb Dressler in einem Essay: „Die gesicherte Existenz Israels liegt im nationalen Interesse Deutschlands, ist somit Teil unserer Staatsräson.“ Dressler war es darum gegangen, Israel gegen neuen deutschen Antisemitismus in Schutz zu nehmen. Merkel wollte dem jüdischen Staat angesichts der Bedrohung durch das iranische Atomprogramm Solidarität zusprechen.
Unterdessen ist die Deklaration der Sicherheit Israels zur deutschen Staatsräson Gemeingut geworden. Alle Parteien außer der Linken und der AfD benutzen die Wendung regelmäßig. Sie findet sich in der Resolution des Bundestags gegen die Boykottbewegung BDS, und sie steht prominent im Koalitionsvertrag der ersten Ampel.
Nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 setzte sich die Formel endgültig durch. Bundeskanzler Olaf Scholz, Unionschef Friedrich Merz und zahlreiche Abgeordnete nahmen Bezug auf die Staatsräson, um Deutschlands Unterstützung für Israels Recht auf Selbstverteidigung zu begründen. Paradoxerweise war dies jedoch der Moment, in dem so ungewiss wurde wie noch nie, was eigentlich aus dem Bekenntnis folgt.
Von Beginn an hatte Deutschland im Verborgenen Israels Sicherheit handfest unterstützt, mit massiven Wirtschaftshilfen und Waffenlieferungen im Zuge der „Wiedergutmachung“ deutscher Verbrechen; am prominentesten durch atomwaffenfähige U-Boote, die Israels Zweitschlagsfähigkeit und somit seine Abschreckung förderten. Das alles geschah ohne den pompösen Begriff der Staatsräson.
Das Konzept – italienisch ragion di stato – entstammt der politischen Philosophie der frühen Neuzeit, als sich in den oberitalienischen Stadtstaaten ein neuer Begriff von Staatlichkeit gegenüber der traditionellen, personenorientierten Herrschaft durchzusetzen begann. Im Namen der Staatsräson wurden die Mittel gerechtfertigt, die zur Errichtung, Durchsetzung und Erhaltung einer staatlichen Autorität nötig waren.
Heute bezeichnet der Begriff meist Grundorientierungen staatlichen Handelns. In der deutschen Außenpolitik also zum Beispiel Westbindung, Ausgleich nach Osten, europäische Integration. Die Sicherheit eines anderen souveränen Staats (außerhalb der NATO) als Teil der Staatsräson zu bezeichnen, war eine historische Innovation. Angela Merkel erklärte die Sicherheit Israels für „nicht verhandelbar“ – noch so eine merkwürdige Formulierung. Das deutsche Engagement für Israel sollte durch diesen Sprachgebrauch einer interessengeleiteten Abwägung entzogen werden. Die Formel brachte Bedingungslosigkeit zum Ausdruck. Die Israel-Politik rückte in einen vorpolitischen Raum des Unhintergehbaren.
Nie war so viel von der Staatsräson die Rede wie in dem Moment, da es fraglicher und strittiger denn je wurde, wie die Sicherheit Israels zu stärken sei. Die israelische Rechte hintertreibt seit Jahren die von Deutschland bevorzugte Zweistaatenlösung durch forcierte (und von der breiten Mehrheit geduldete) Siedlungsaktivität, durch Repression in den Palästinensergebieten und den Umbau des israelischen Rechtsstaats. In den Augen der deutschen Politik untergräbt genau dies langfristig Israels „gesicherte“ Existenz. Doch die Bundesregierung meidet klare Worte, als geböte dies die Staatsräson.
Sie unterstützte den Gazakrieg als Akt der israelischen Selbstverteidigung auch dann noch, als die Bundesregierung intern längst zweifelte, dass die rücksichtslose Kriegführung mit Zehntausenden Toten Israel sicherer machen würde. Zu befürchten war vielmehr, dass dieser Krieg den jüdischen Staat (zusammen mit Unterstützern wie Deutschland) in den Augen der Welt delegitimiert. Ein Tiefpunkt war erreicht, als die Luftwaffe Gaza mit Hilfspaketen versorgte, weil Israels Blockade eine Hungersnot verursacht hatte. Man hatte die Waffenlieferungen aus Solidarität erhöht und musste doch hinnehmen, dass die Netanjahu-Regierung jede politische Perspektive für die Palästinenser torpedierte.
Die Rede von der Staatsräson war aus der hehren Absicht entstanden, Deutschlands Verpflichtung gegenüber Israels Sicherheit der Debatte zu entziehen. Sie hat etwas anderes erreicht. Deutschland ist Israel gegenüber politikunfähig worden.
Autokratie gegen Demokratie: Wer die Welt so sieht, vereinfacht sie und erhebt sich selbst über andere⬆ nach oben
In den letzten Jahren ist ein Denkschema populär geworden, das die Welt nach politischen Herrschaftsformen sortiert: Diktaturen, Einparteiensysteme und Tyranneien unterschiedlichster Art stehen auf der einen Seite – und auf der anderen die freien Gesellschaften, von der konstitutionellen Monarchie über die parlamentarischen Systeme bis zur Präsidialdemokratie. Kurz: Autokratie versus Demokratie, also Alleinherrschaft (eines Diktators, eines Volkstribuns, einer Partei oder einer Dynastie) gegen Volkssouveränität (alle Ordnungen, in denen die Staatsgewalt „vom Volke ausgeht“).
In den ersten Monaten nach dem russischen Überfall auf die Ukraine variierte Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder diese Melodie: Demokratien stünden zusammen gegen „autokratische Staaten“, in denen die Macht über das Recht gebiete – vereint in der Überzeugung, dass „das Recht der Macht Grenzen setzen muss“. Das klang fast wie im Kalten Krieg, als die Welt in zwei Blöcke zerfallen war, die von den USA und der Sowjetunion angeführt wurden. Je schlechter der Krieg für die Ukraine lief, umso leiser jedoch tönte das Lied.
Die Weltlage als Kampf zweier Linien zu begreifen, ist von befreiender Schlichtheit – und auch ein wenig erhebend, wenn man sich selbst auf der richtigen Seite der Geschichte sieht. Aber hier liegt auch das Problem der Gegenüberstellung von Autokratie und Demokratie. Viele Demokratien sind heute umkämpft, sie werden von inneren Feinden herausgefordert und müssen ihre Handlungsfähigkeit angesichts vieler Krisen beweisen. Sie bilden keinen handlungsfähigen Block.
Auch auf der Seite der Autokratien gilt es zu unterscheiden: zwischen aggressiven, zerstörerischen, menschenfeindlichen Regimen – und solchen, die zwar Freiheiten einschränken und die Opposition unterdrücken, aber die internationale Ordnung nicht infrage stellen und eine konstruktive Außenpolitik betreiben. Ein Label, das nicht zwischen Ländern wie Russland, Iran, Syrien, Nordkorea einerseits und Singapur, Ruanda, Ägypten, Saudi-Arabien andererseits – allesamt autokratisch regiert – zu differenzieren vermag, ist unbrauchbar.
Nicht sehr viel anders verhält es sich mit dem Demokratiebegriff. Einige der wichtigsten Partnerländer Deutschlands sind zwar nominell noch demokratisch regiert, in Wahrheit aber bewegen sie sich im Spektrum zwischen Freiheit und Unfreiheit gefährlich in Richtung der Letzteren: Erdoğans Türkei, Modis Indien, Orbáns Ungarn. Polen versucht zwar nach den Jahren der nationalkonservativen PiS-Regierung die Schubumkehr zurück zu Rechtsstaat und Demokratie, doch der Ausgang ist offen.
Joe Biden widmete seine Präsidentschaft ganz dem Streit zwischen Demokratie und Autokratie. In seiner Sicht hatte das innen- und außenpolitische Aspekte: Der Kampf gegen die selbstzerstörerischen Kräfte der amerikanischen Gesellschaft, die sich etwa beim „Sturm auf das Kapitol“ am 6. Januar 2021 gezeigt hatten, und der Kampf gegen die Achse der Freiheitsfeinde in der Ukraine (wo Russland von Iran, China und Nordkorea gestützt wird) verschmolzen in seiner Weltsicht zu einem einzigen titanischen Ringen. Biden veranstaltete mehrere Summits for Democracy („Demokratiegipfel“) mit je um die 100 Nationen. Die Einladungsliste zeigte, wie untauglich das Label war. Das große Indien war eingeladen, das kleine Ungarn nicht – realpolitische Überlegungen hatten ganz offenbar die demokratietheoretischen übertrumpft. Indien wird nun mal gebraucht in der Großmachtkonkurrenz mit China, Demokratie hin oder her.
Vor allem diese Umwerbung Indiens durch die USA und Deutschland steht quer zur säuberlichen Zweiteilung der Welt. Es ist irreführend, das Land rundheraus als „größte Demokratie der Welt“ zu etikettieren. Präsident Narendra Modi baut Indien zum autoritären, ethnonationalistischen Staat um und höhlt zielgerichtet Minderheitenrechte und Grundfreiheiten aus. Davon schweigt der Westen, denn es ist wichtiger, Indien aus der russischen Abhängigkeit (vor allem bei Rüstungsgütern) zu lösen, es als alternative Führungsnation des Globalen Südens sowie als Markt und Produktionsstandort zu kultivieren, um Chinas Einfluss einzudämmen.
Solche taktischen Kompromisse sind unvermeidbar. Man muss den Kampf um die Demokratie ihretwegen nicht aufgeben. Er sollte allerdings zu Hause beginnen.
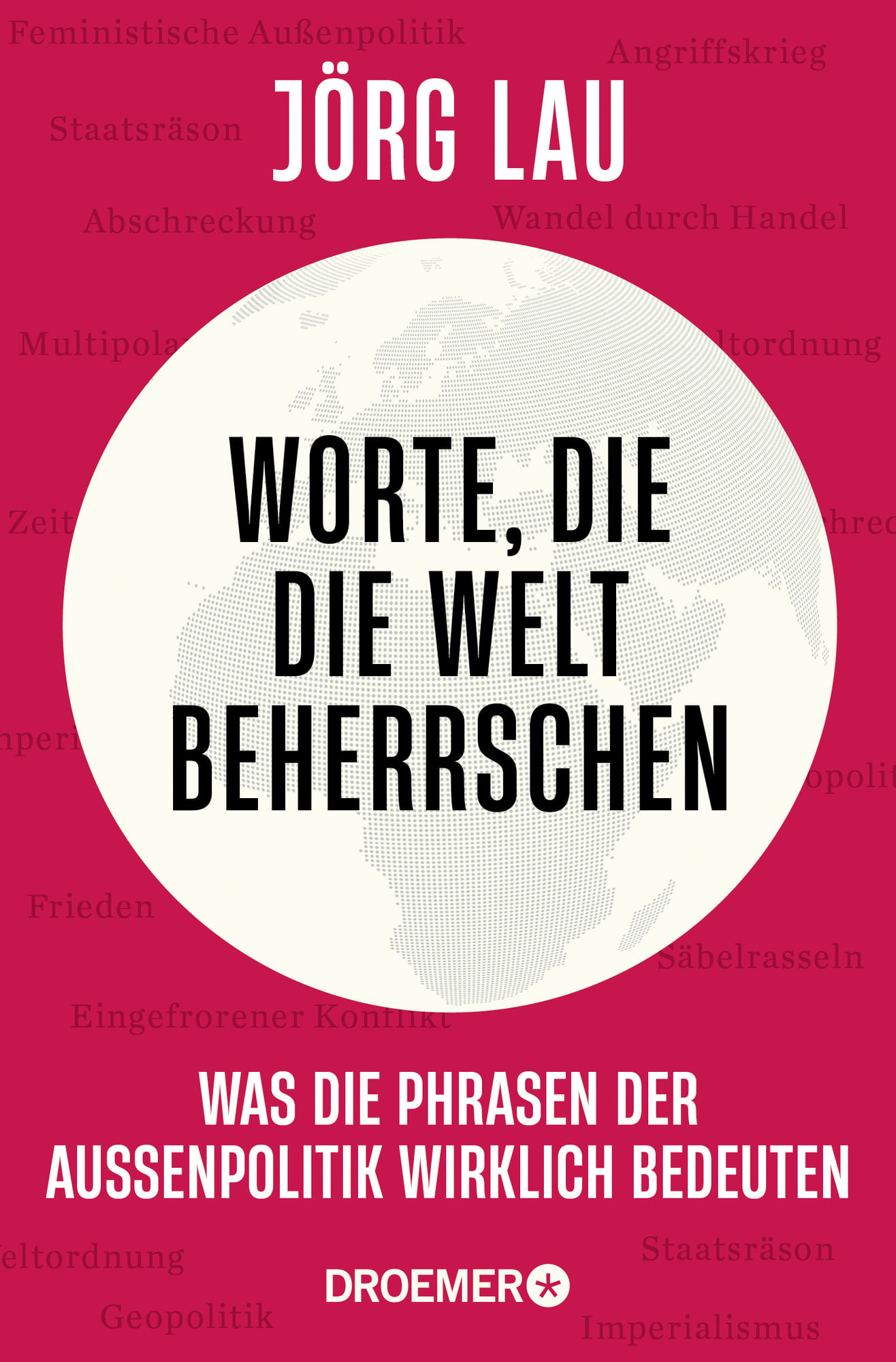
Das Tolle an diesem Buch ist, dass man es von vorne nach hinten lesen kann – oder kreuz und quer zwischen den Begriffen springen kann, die einen interessieren. Sie decken ein sehr breites Spektrum ab, von „Kriegstüchtigkeit“, über „Frieden“ oder „feministische Außenpolitik“.
„Etwas stimmt nicht mit der Sprache, in der wir in Deutschland über die großen Fragen der Außenpolitik streiten“, schreibt Jörg Lau in diesem Buch. Es ist schon mal ein Anfang, die besseren Worte für diese Diskussionen zu finden.
„Worte, die die Welt beherrschen. Was die Phrasen der Außenpolitik wirklich bedeuten“ ist im März 2025 bei Droemer Knaur erschienen. Du kannst es direkt hier beim Verlag bestellen oder natürlich bei deiner nächsten Buchhandlung.
Redaktion: Isolde Ruhdorfer und Nina Roßmann, Bildredaktion: Philipp Sipos; Audioversion: Iris Hochberger