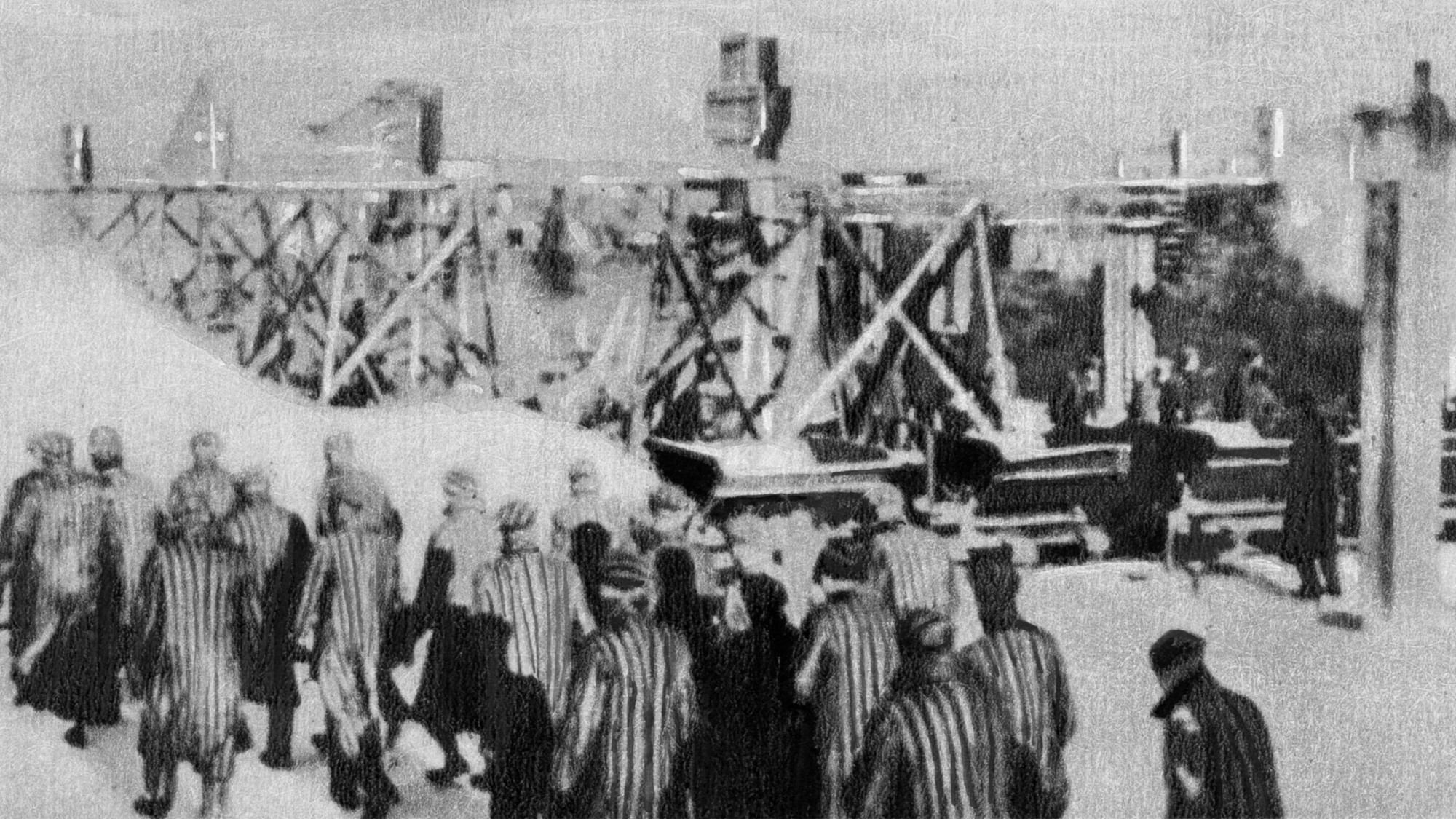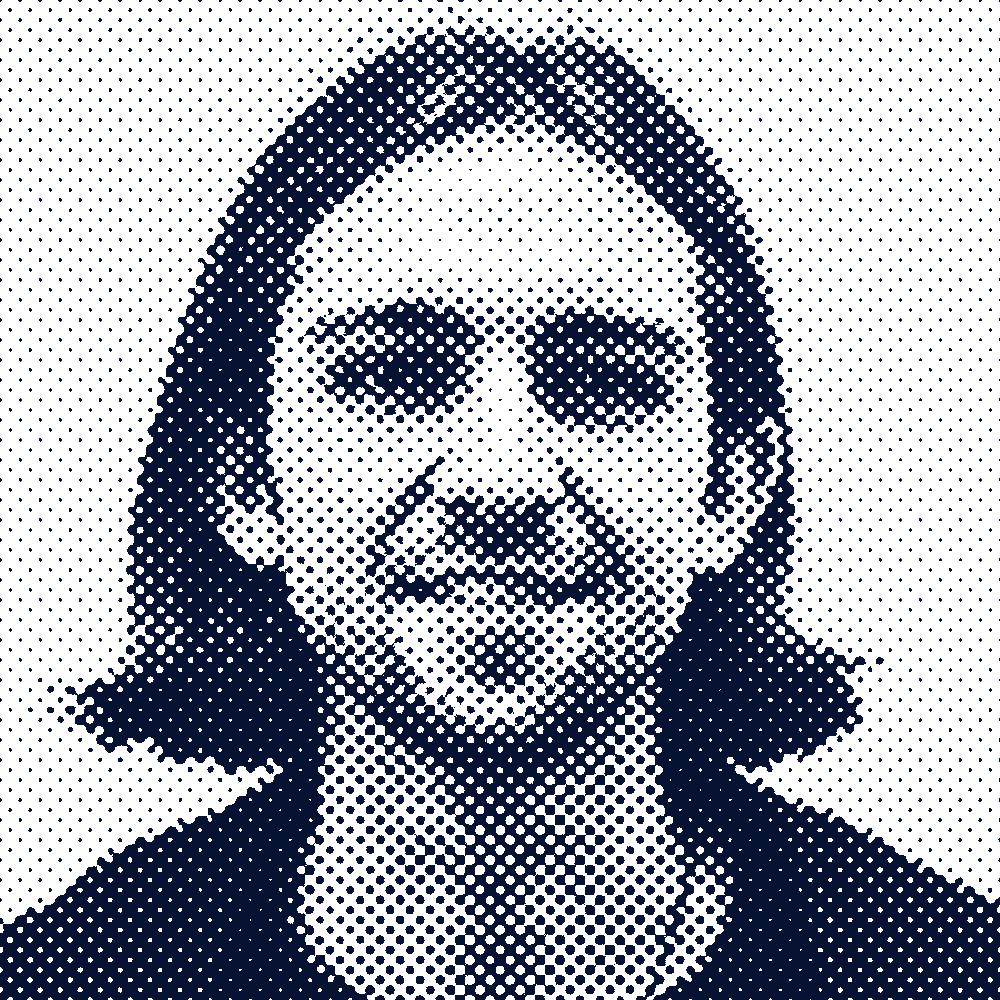Am Morgen des 13. Juli 1942 kämpfte Major Wilhelm Trapp mit den Tränen. Er stand im polnischen Dorf Józefów, in der Nähe von Warschau, vor ihm rund 500 Männer mittleren Alters, ein Reserve-Bataillon der deutschen Ordnungspolizei. Trapp erklärte seinen Untergebenen die „unangenehme Aufgabe“, die ihnen bevorstand: Sie müssten bis auf die arbeitsfähigen Männer alle Juden und Jüdinnen im Dorf erschießen. Frauen, Kinder, Ältere. Befehl sei Befehl. Dafür hatte er sie um 2 Uhr morgens geweckt, deshalb waren sie hierher gefahren.
Trapp sagte, dass er die Anweisung nicht guthieß. Und er machte seinen Männern ein außergewöhnliches Angebot: Wer bei dem Massenmord nicht mitmachen wollte, könne sich melden. Ohne Konsequenzen. Nur ein Dutzend Männer nahm das Angebot an. Alle anderen blieben stumm. In den folgenden Stunden töteten sie rund 1.800 Menschen. Obwohl sie, wie sie später erzählten, völlig schockiert von ihren eigenen Taten waren. Und obwohl sie nie zuvor daran gedacht hatten, Unschuldige abzuschlachten.
Wer verübt Kriegsverbrechen, und warum? 2024 gab es so viele bewaffnete Konflikte wie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Im Gazastreifen erschießen israelische Soldat:innen heute Zivilist:innen an Essensausgaben, bombardieren Krankenhäuser und Schulen und machen sich online über die Zerstörung und das Leid der Palästinenser:innen lustig. Hamas-Kämpfer ermordeten am 7. Oktober 2023 auf grausame Weise 1.200 Menschen in Israel und übertrugen ihre Taten live im Netz. Russische Soldaten verüben in der Ukraine Massenhinrichtungen, foltern und vergewaltigen.
Gemeinhin gelten Kriegsverbrecher als Monster. Als blutrünstige Ideologen, die sich an der Vernichtung ihrer Gegner berauschen. Solche Täter gibt es, aber sie sind die Ausnahme. Die meisten sind ganz normale Männer. Max Mustermanns, die glauben, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen – wie wohl die meisten von uns.
Wie aus „ganz normalen Männern“ Kriegsverbrecher werden⬆ nach oben
Am Abend nach dem Massaker von Józefów soll keiner der deutschen Ordnungspolizisten ein Wort über die Taten verloren haben. Viele betranken sich. Die Männer sagten später, sie seien über sich selbst entsetzt gewesen. Doch nur wenige Wochen später töteten sie wieder massenhaft Jüdinnen und Juden. Und dann wieder. In den folgenden Monaten ermordeten sie rund 38.000 Menschen. Und deportierten weitere 40.000 in Vernichtungslager wie Treblinka oder Sobibor. Der Massenmord wurde zum Alltagsgeschäft.
Die meisten Mitglieder des Bataillons waren vor dem Massaker in Józefów keine glühenden Antisemiten oder NSDAP-Anhänger. Sie kamen aus der Hamburger Arbeiterklasse. Manche waren zu alt für den Wehrdienst, andere hatten versucht, sich vor dem Einsatz an der Front zu drücken. Es waren ganz normale Männer, die plötzlich zu Kriegsverbrechern und Massenmördern wurden. So rekonstruiert es der Historiker Christopher Browning in seinem Buch „Ordinary Men“.
Browning las Hunderte Seiten an Verhörprotokollen mit Mitgliedern der Einheit, aus Prozessen nach dem Krieg. Er schreibt: Die Taten des Reserve-Bataillons 101 zeigen, dass viele Kriegsverbrecher:innen Durchschnittsmenschen sind, die zunächst gar keine Verbrechen begehen wollen. Gruppendynamiken und Gehorsam machen sie zu Massenmörder:innen.
Viele Kriegsverbrecher haben Charaktereigenschaften, die wir wertschätzen⬆ nach oben
Zu dem Ergebnis kommt auch die Kriminologin Alette Smeulers von der Universität Groningen. Sie untersucht seit über 30 Jahren, unter welchen Umständen Menschen Kriegs- und Massenverbrechen begehen. Smeulers ist überzeugt: „Jeder kann zum Täter werden.“ Denn in den meisten Fällen entscheide nicht der Charakter eines Menschen, ob er Massen- oder Kriegsverbrechen begeht, sondern der Kontext. „Gerade in Zeiten von Massengewalt und Krieg begehen Menschen Kriegsverbrechen, die sie sonst von sich aus nie begangen hätten“, sagt sie.
Smeulers beschreibt in ihrem Buch „Perpetrators of Mass Atrocities: Terribly and Terrifyingly normal?“ 14 verschiedene Tätertypen von Kriegs- und Massenverbrechern. In der Realität vermischen sie sich. Doch der Großteil der Täter:innen sind ihr zufolge „Mitläufer“ und sogenannte „Profiteure“. Profiteure sind Täter, die sich an Massenverbrechen beteiligen, weil sie sich davon einen Vorteil erhoffen. Etwa, weil sie jüdischen Familien ihren Goldschmuck wegnehmen können.
Mitläufer dagegen morden, weil es von ihnen erwartet wird oder weil sie glauben, dass es von ihnen erwartet wird. Und weil sie nicht als Feiglinge gelten wollen. Sie sind Täter:innen von niedrigem Rang, die der Gruppe folgen.
Viele Mitglieder der Reserveeinheit 101 der Ordnungspolizisten in Polen dürften Mitläufer gewesen sein. Sie sagten später, sie hätten das Ausstiegsangebot von Major Trapp nicht angenommen, weil sie nicht zu Außenseitern werden wollten. „Wenn man mich fragt, warum ich überhaupt mit den anderen geschossen habe“, sagte einer der Täter, „muss ich antworten, dass niemand als Feigling gelten will.“
Das Beispiel zeigt: Gruppendruck und Gehorsam spielen bei Kriegsverbrechen eine wichtige Rolle. „Die perfekten Massen- und Kriegsverbrecher haben Charaktereigenschaften, die unsere Gesellschaft wertschätzt“, sagt Smeulers: Gehorsam, Vertrauen, Loyalität, Konformismus, Engagiertheit. Wenn Menschen mit solchen Eigenschaften einem Anführer oder Fanatiker kritiklos folgen, können sie in Kriegszeiten schnell zu Kriegsverbrechern werden. Schließlich bekommen sie nicht den Befehl einen Völkermord zu begehen, sondern werden angewiesen, „ihr Land zu schützen“ und oder „Gefahren zu bekämpfen.“ „Der perfekte Angestellte ist also auch der perfekte Kriegsverbrecher“, so Smeulers.
Die Täter glauben, sie seien die Guten. Dazu kommt bei allen Tätergruppen ein bestimmtes Weltbild: „Die Täter sehen sich als die eigentlichen Opfer“, sagt sie. „Sie sehen sich als die Guten, die gegen die Bösen kämpfen.“ Oft im Namen einer Ideologie oder der nationalen Sicherheit.
Das offensichtlichste Beispiel ist die Vernichtung der europäischen Juden durch die Nationalsozialisten. Jüdinnen und Juden galten in der NS-Ideologie als Feind, der das „deutsche Volk“ von innen und außen existenziell bedroht. Vor dem ersten Massenmord seiner Einheit versuchte Major Trapp, der Kommandant der Ordnungspolizei in Polen, seinen Männern das Gewissen zu erleichtern. Er sagte ihnen: Die Aufgabe sei schrecklich, aber sie sollten daran denken, was die Juden in Deutschland anrichteten. In anderen Worten: Der Massenmord sei ein notwendiges Übel, ein Opfer für das Vaterland.
Wenn eine solche Ideologie das Denken der Soldaten oder Kämpfer bestimmt, ist laut Smeulers alles erlaubt, auch das Kriegsrecht gelte nicht mehr. Denn der Gegner werde nicht mehr als Mensch wahrgenommen, sondern als das Böse schlechthin. Er werde dämonisiert und entmenschlicht. „Es ist nicht so, dass Kriegs- und Massenverbrecher keine Moral haben“, sagt Smeulers. „Es ist nur so, dass sie ihre Moral auf Personen beschränken, die sie als vollwertige Menschen betrachten – aber eben nicht mehr auf ihre Feinde.“
Dafür braucht es in Zeiten von Krieg und Gewalt nicht unbedingt eine jahrelange Radikalisierung. Entscheidend ist vielmehr die erste Tat.
Warum die Reaktion auf das erste Verbrechen so wichtig ist⬆ nach oben
Im Frühsommer 1994 ermordete die Hutu-Mehrheit in Ruanda innerhalb weniger Monate rund 800.000 Angehörige der Tutsi-Minderheit. Der französische Journalist Jean Hatzfeld sprach später mit zahlreichen Tätern. In seinem Buch „Machete Season: The Killers in Rwanda Speak“ berichten sie über ihre ersten Tötungen während des Genozids.
Einer der Täter sagt über seinen ersten Mord an einer Frau: Nachdem er sie das erste Mal mit der Machete getroffen hatte, war ihm „so schlecht“, dass er nicht weitermachen konnte. Ein anderer Täter berichtet: „Diesen Mann, den ich auf dem Markt getötet habe – an ihn erinnere ich mich genau, denn er war der erste. Bei den anderen ist alles verschwommen – ich kann sie in meinem Gedächtnis nicht mehr auseinanderhalten.“
So geht es den meisten Tätern, wenn sie das erste Mal einen Menschen ermorden. Sie sind schockiert, kämpfen mit sich selbst, kriegen die Szenen nicht aus dem Kopf. Doch dann gewöhnen sie sich an die Gräuel. Schritt für Schritt. Vom anfänglichen Schock ist bald nichts mehr übrig.
Dahinter steckt laut Alette Smeulers ein zutiefst menschlicher Mechanismus: Bei ihren ersten Taten verstehen die Täter:innen, dass sie einen anderen Menschen getötet haben. Und weil sie die Schwere ihrer Tat verstehen, fangen sie an, ihr eigenes Gewissen zu beruhigen. Sie rechtfertigen und rationalisieren den Mord.
Sie sagen sich: Das war notwendig für die nationale Sicherheit, für das Volk. Wenn ich ihn nicht getötet hätte, hätte er mich oder meine Freund:innen getötet. Oder: Wenn ich ihn nicht getötet hätte, hätte mein Nachbar das halt getan. Sie tun alles, um ihr eigenes Gewissen zu beruhigen. Denn andernfalls müssten sie sich eingestehen, dass sie selbst schlechte Menschen sind.
„Diese Reaktion ist ein Problem“, sagt Smeulers. „Denn wenn man einmal damit anfängt, dann rechtfertigt man im Nachhinein, was man tut: Man überzeugt sich, dass man richtig gehandelt hat – und tut es deshalb wieder.“
Wie weit das geht, verdeutlicht die Aussage einer der Ordnungspolizisten des Massakers in Polen. Er gab später an, dass er eigentlich nicht an der Massenhinrichtung von Jüdinnen und Juden teilnehmen wollte. Schließlich habe er doch mitgemacht und sich dazu entschlossen, Kinder zu erschießen. Seine Worte: „Es kam vor, dass die Mütter ihre Kinder an der Hand führten. Mein Nachbar erschoss dann die Mutter, und ich erschoss das Kind, das zu ihr gehörte, weil ich mir sagte, dass das Kind ohne seine Mutter ohnehin nicht weiterleben könne. Es sollte gewissermaßen mein Gewissen beruhigen, Kinder zu erlösen, die ohne ihre Mütter nicht überlebensfähig waren.“
So rechtfertigt man Völkermord als eine Art Gnadentod. Es ist ein grausames Beispiel aus der Geschichte, das aber eine wichtige Dynamik zeigt: Kriegsverbrecher:innen gehen bis zum Äußersten, um ihr eigenes Gewissen zu beruhigen und schaffen sich so eine Parallelrealität, in der sie jedes Schuldgefühl verlieren und anschließend weiter morden.
Doch damit es überhaupt so weit kommt, braucht es auch andere Tätertypen. Charismatische Anführer:innen, die Befehle geben und die Ideologie der Gruppe formen. Fanatisch denkende Menschen, die tief ideologisch überzeugt sind. Bürokrat:innen, die ihren Job machen. Und Menschen, die einfach Karriere machen wollen.
Jeder kann zum Täter werden, aber jeder kann dem auch widersprechen⬆ nach oben
Kurz vor seinem Lebensende sprach der NS-Verbrecher Albert Speer mit dem BBC-Journalisten Roger George Clark. Speer war während der Nazizeit unter anderem für Rüstung zuständig. Clark hatte Speer in den Vorjahren bereits mehrfach interviewt und stellte ihm eine letzte Frage. Er wollte wissen, ob Speer im Nachhinein lieber ein Unbekannter mit einem reinen Gewissen gewesen wäre, als ein berühmter Kriegsverbrecher. Speers Antwort: „Ich wäre lieber berühmt.“
Speer war ein typischer „Karrierist“ – ein weiterer Tätertyp aus Alette Smeulers Typisierung. Karrieristen beteiligen sich an Massenverbrechen, weil sie Macht, Status oder Prestige erlangen wollen. Dabei ist ihnen entweder egal, worauf sie sich einlassen. Oder sie identifizieren sich sowieso mit der Sache. In beiden Fällen folgen sie mit großem Eifer den Anweisungen ihrer Anführer und versuchen, sich zu beweisen.
Damit gehören sie gemeinsam mit den Anführern und Fanatikern zu den wichtigsten Tätertypen von Kriegsverbrechen. Sie verfügen über Einfluss und schaffen die politischen Rahmenbedingungen, in denen andere Menschen Verbrechen begehen. Ohne sie hätten die Ordnungspolizisten in Polen nicht Tausende jüdische Menschen erschossen, wären nicht so viele Tutsi in Ruanda mit Macheten ermordet worden.
Menschen, und besonders Mitläufer:innen, neigen dazu, Autoritäten und Anführer:innen zu vertrauen. Das gilt besonders im Militär oder in anderen bewaffneten Gruppen. Ihre Anführer:innen richten die Gruppe darauf aus, ihnen zu vertrauen und ihren Befehlen zu gehorchen. Im Extremfall führt das dazu, dass ihre Untergebenen in ihrem Auftrag Unschuldige ermorden, weil sie intuitiv davon ausgehen, dass sie schon die richtigen Befehle bekommen. Viele Kriegsverbrechen sind deshalb auch sogenannte Crimes of Obedience. Gehorsamkeitsverbrechen.
Wie wichtig die Anführer:innen und Befehlsgebenden für Massenverbrechen sind, zeigt sich an einem weiteren Beispiel aus der Geschichte, dem Massaker von My Lai in Vietnam: Am 16. März 1968 landeten rund 100 US-Soldaten im Dorf Sơn Mỹ. Junge Männer, deren Väter als Helden aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause gekehrt waren. Nun wollten sie für ihr Land kämpfen. In Sơn Mỹ vermuteten sie eine Einheit von Vietcong-Kämpfern und bereiteten sich darauf vor, ihre Gegner plattzumachen. Doch als sie ankamen, sahen sie Frauen, Kinder, Ältere. Zivilist:innen. Eigentlich ein Grund zum Rückzug. Die Soldaten eröffneten dennoch das Feuer. Im Laufe des Tages ermordeten sie 504 Zivilist:innen. Viele gaben später an, lediglich den Befehlen ihrer Vorgesetzten Ernest Medina und William Calley gefolgt zu sein. „Zu keinem Zeitpunkt kam es mir in den Sinn, einem Befehl meiner Vorgesetzten nicht zu gehorchen oder mich zu weigern, ihn auszuführen“, sagte später einer der Täter.
Das Massaker von My Lai zeigt, wie sehr Soldaten in Kriegssituationen ihren Vorgesetzten folgen. Es zeigt aber auch, dass das kein Automatismus ist. Dass es möglich ist, zu widersprechen. Selbst unter größtem Druck: Ein Soldat der Einheit wollte keine Zivilisten töten, aber auch nicht als Feigling dastehen. Also schoss er sich in den Fuß, damit er als Verletzter abtransportiert werden konnte. Ein anderer Soldat, Harry Stanley, verweigerte den Schießbefehl seines Kommandanten, obwohl dieser sogar eine Waffe auf ihn richtete und mit Konsequenzen drohte. „Ich töte keine Frauen und Kinder“, sagte Stanley. Sein Widerspruch zeigt: Jeder kann zum Täter werden – aber jeder kann dem auch widersprechen.
Redaktion: Rebecca Kelber, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert