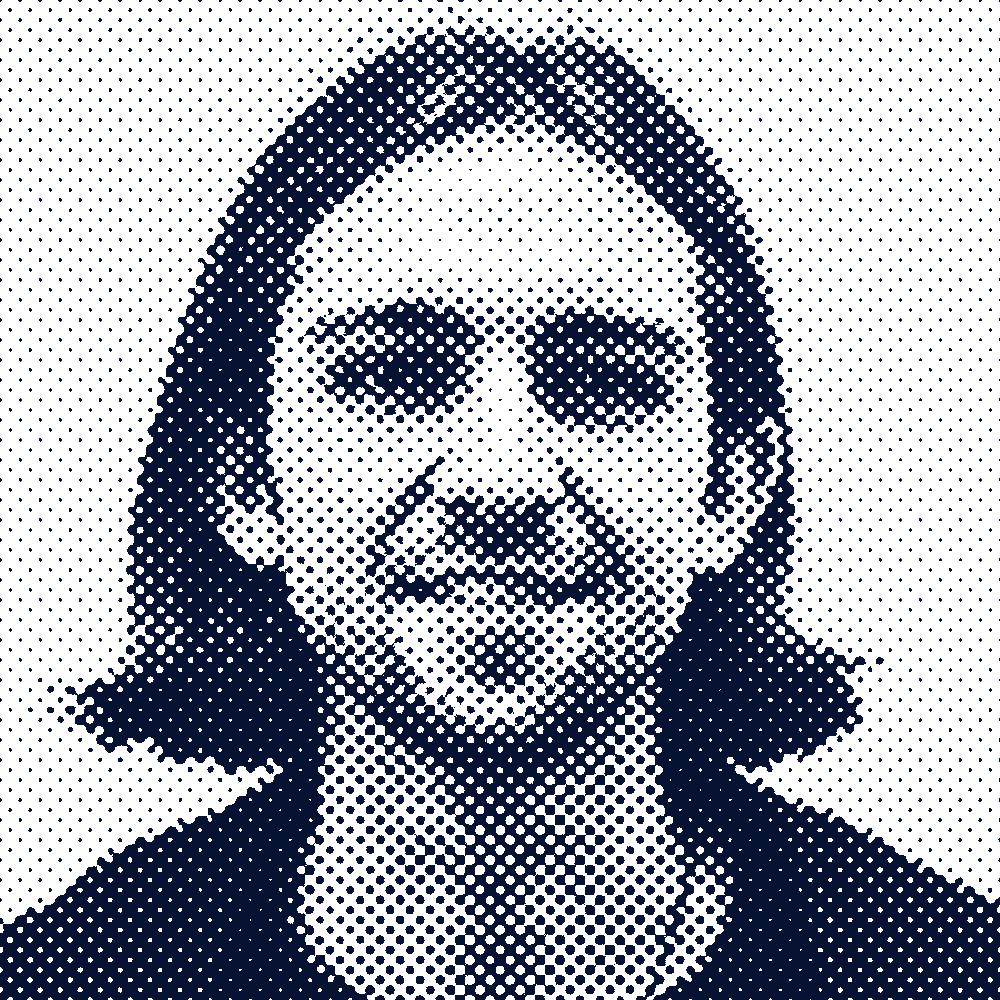Wäre Viktor Orbán Lehrer für Autokratie und Trump sein Schüler, Orbán würde ihn nachsitzen lassen. Sein Urteil: Großes Talent, arbeitet aber nicht sorgfältig genug. Denn Trump schafft es bislang nicht, die US-Demokratie an entscheidenden Stellen auszuhöhlen, um langfristig einen Systemwechsel herbeizuführen.
Das sah direkt nach seinem Amtsantritt anders aus: Trump ließ Elon Musk die halbe Chefetage der US-Verwaltung feuern und stellte das FBI unter Kontrolle von Kash Patel, einem fanatischen Hardliner. Er unterwarf mit der Columbia Universität eine der renommiertesten Universitäten der Welt und ließ Menschen ohne rechtsstaatliches Verfahren in El Salvador verschwinden. Selbst führende Expert:innen für Autoritarismus hatten nicht damit gerechnet, wie schnell die Trump-Regierung das alte System angreifen würde.
Doch inzwischen zeigt sich: Trump greift die Demokratie zwar von allen Seiten an. Aber trotz bester Voraussetzungen gelingt es seiner Regierung bislang nicht, die Gewaltenteilung auszuhebeln, die Medien strukturell einzuschüchtern oder weitere Universitäten zu unterwerfen, wichtige Schritte auf dem Weg zu einer Autokratie. Das hat einen Grund: Trump arbeitet unsauber und sabotiert mit seinem Ego seine eigenen autoritären Ansprüche. Er inszeniert sich wie jemand, der schon unbegrenzte Macht hat und genau deshalb könnte die US-Demokratie seinen Angriffen standhalten.
Wie man eine Demokratie abschafft⬆ nach oben
Es ist kein Geheimnis mehr, wie man eine Demokratie im 21. Jahrhundert aushöhlt. Der Politikwissenschaftler Bálint Magyar sagt, dass es dafür drei Schritte braucht.
Zunächst muss der angehende Autokrat nach seinem Wahlsieg Schritt für Schritt das System verändern. Zum Beispiel, indem er so viele Positionen wie möglich im Staat und in der Justiz mit Anhänger:innen besetzt und scheinbar langweilige Gesetze erlässt, die seine eigene Position stärken. So hat etwa Viktor Orbán seine Macht gefestigt.
Dann muss er sich mit einem „autokratischen Durchbruch“ das Monopol auf die politische Macht im Land sichern und die Gewaltenteilung aushebeln, zum Beispiel durch eine Verfassungsänderung, ein neues Wahlsystem oder die Ausschaltung der unabhängigen Justiz. Anschließend kann er die eigene Macht festigen, indem er Wirtschaft, Medien und Zivilgesellschaft nachhaltig außer Gefecht setzt.
Zwei Dinge sind wichtig, damit der autokratische Durchbruch gelingt: Einerseits muss man von Anfang an sorgfältig und ruhig gegen Rechtsstaatlichkeit und die Presse vorgehen.
Andererseits muss man Koalitionen schmieden und Kompromisse eingehen, besonders mit den mächtigen Gruppen und Institutionen im Land. In den USA sind das zum Beispiel das Silicon Valley, die Wall Street und die Universitäten. Sie müssen durch eine Mischung aus Drohungen und Anreizen überzeugt werden, dass es sich für sie lohnt, dem angehenden Autokraten zu folgen und Teil seines autoritären Projekts zu werden. Das Versprechen funktioniert wie bei einer gut organisierten Mafia: Du machst mir Zugeständnisse, ich lasse dich in Ruhe. Gemeinsam beuten wir andere aus: Migrant:innen, Queere, Liberale.
Ein Beispiel wie aus dem Lehrbuch war die Ankündigung von Meta-Chef Mark Zuckerberg, Diversitätsregelungen und Faktenchecks abzuschaffen. Einer der mächtigsten Männer der Welt hoffte offensichtlich, damit Problemen mit der Trump-Regierung aus dem Weg zu gehen. Seine Rechnung: Es lohnt sich mehr, Teil des autoritären Projekts zu werden, als in die Opposition zu gehen. Solche Deals brauchen angehende Autokraten, bevor sie einen Durchbruch erzielen. Deshalb müssen sie zuverlässige Partner im schmutzigen Geschäft sein.
In anderen Worten: Wer die absolute Macht will, muss zunächst sorgsam – und möglichst unspektakulär – die Rechtsstaatlichkeit aushöhlen und gleichzeitig Allianzen schmieden, um so die Gegenbewegung zu schwächen. Es geht nicht darum, einzelne Kämpfe auf spektakuläre Art und Weise zu gewinnen, sondern darum, möglichst großflächig Gehorsam zu schaffen.
Das hat Trump bislang nicht geschafft.
Trump untergräbt seinen eigenen Machtanspruch⬆ nach oben
Ob die Abschiebung von Unschuldigen, die Entsendung der Nationalgarde nach Los Angeles oder das Ende der US-Entwicklungsbehörde USAID: Trump konnte bereits einige spektakuläre Siege verbuchen. Aber es ist ihm nicht gelungen, flächendeckend die Justiz auszuhebeln, entscheidende Gesetze zu verabschieden oder die Presse einzuschüchtern.
Wer weiß, wie man eine Autokratie schafft, sieht seine Fehler: Anstatt das Justizsystem zunächst zu entmachten, unterschreibt Trump seit Beginn seiner Amtszeit eine Vielzahl an Exekutiv-Verordnungen. Diese wiederum wurden in den meisten Fällen von Richtern gestoppt. Oft von solchen, die selbst von Trump ernannt worden waren. Aktuell laufen über 300 Verfahren gegen Trumps Verordnungen.
„Trumps Geschwindigkeit ist ein Zeichen von Schwäche“, sagt der US-Politikwissenschaftler Robert Mickey. Dass Trump vor allem per Verordnungen regiere, zeige vor allem eines: dass er nicht die Macht habe, nachhaltige Gesetzesänderungen zu verabschieden. Dazu muss man wissen: Exekutiv-Verordnungen schaffen keinen neuen Rechtsrahmen. Sie können leicht zurückgenommen werden und müssen sich an Verfassung und Gesetze halten. „Sie vermitteln den Eindruck politischer Stärke“, sagt Mickey. „Das genießt Trump meiner Meinung nach mehr als den Inhalt.“ Die Welt blickte wie gelähmt auf Trumps Feuer aus Exekutiv-Verordnungen, obwohl sie eigentlich ein großer strategischer Fehler waren.
Trump hat es ebenfalls nicht geschafft, die Universitäten des Landes, die Wall Street oder die Medien auf Linie zu bringen. Also jene Institutionen, die er kontrollieren müsste, damit ein autokratischer Durchbruch gelingt. Auch hier sind seine Fehler offensichtlich. Zunächst lief es gut für ihn: Das Silicon Valley unterwarf sich vorsorglich und die Columbia-Universität machte große Zugeständnisse, als Trump sie attackierte. Sie hoffte, so keine Fördergelder zu verlieren und in Ruhe gelassen zu werden. Beides entpuppte sich als Illusion.
Anstatt sich an einen Waffenstillstand zu halten, entzog Trump der Universität trotz ihrer Zugeständnisse Fördergelder und Verträge im Wert von 400 Millionen US-Dollar. Ein großer taktischer Fehler. Denn andere Universitäten wussten fortan: Selbst wenn wir Zugeständnisse an den angehenden Autokraten Trump machen, werden wir nicht profitieren. Auf das Wort des Mafia-Bosses ist kein Verlass, also zahlen wir ihm auch kein Schutzgeld.
Harvard soll nach Trumps Attacken zunächst einen Deal mit ihm gesucht haben. Als klar wurde, dass auf Trumps Wort kein Verlass ist, wandte sich die mächtigste Universität der Welt gegen ihn. Das wiederum mobilisiert andere. Plötzlich sieht sich Trump einer oppositionellen Bewegung gegenüber, die über sehr viel Macht und Geld verfügt. Sein eigenes Verhalten stellt ihm also eine Falle: Er tut so, als habe er bereits unbegrenzte Macht und müsse sich an keine Abmachungen halten – und verstellt sich so selbst den Weg dorthin.
Trump scheint vor allem eins zu interessieren: Selbstbereicherung⬆ nach oben
Wie wenig strategisch Trump am autoritären Umbau der USA arbeitet, zeigt sich auch in seiner Zollpolitik. Regelmäßig kündigt er hohe Zölle an und nimmt sie wieder zurück. Mit seinem Verhalten verschreckt Trump die mächtige Wall Street, die ihm eigentlich wohlgesonnen war. Ein weiteres Machtzentrum des Landes könnte sich von ihm abwenden, bevor er die Demokratie entscheidend ausgehöhlt hat. Die Zölle dürften auch dafür sorgen, dass das Leben für viele US-Amerikaner:innen langfristig teurer wird. Das wird Folgen haben. Schon jetzt sind seine Umfragewerte schlechter als die aller anderen US-Präsidenten in den vergangenen 25 Jahren.
All das heißt nicht, dass Trump kaum Schaden anrichtet. Er verachtet die liberale Demokratie und es wäre naiv zu glauben, dass die seine Amtszeit unbeschadet übersteht. Schon jetzt hat er durch willkürliche Abschiebungen und Inhaftierungen, Medienattacken, Massenentlassungen in der Verwaltung, Einreiseverbote und seine Außenpolitik Fakten geschaffen, die langfristige Folgen haben. Er verwandelt die Sicherheitsbehörden in politische Machtinstrumente und schafft durch präsidentielle Begnadigungen Anreize, für ihn und seine Interessen das Gesetz zu brechen. Aber Trump scheint mehr Interesse daran zu haben, sich selbst zu bereichern und seine Gegner:innen und Migrant:innen spektakulär zu demütigen, als die US-Demokratie langfristig umzubauen.
„Trumps Sadismus ist schrecklich, aber ich würde ihn noch nicht mit einer dauerhaften politischen Transformation verwechseln“, sagt Robert Mickey. Er glaube nicht, dass Trump ein ausgearbeitetes autoritäres Projekt verfolge oder ein ähnlich gewiefter Denker wie Viktor Orbán sei. „Er folgt seinen Impulsen und Rachegelüsten“, sagt er. „Das Land kann sich glücklich schätzen, dass er so narzisstisch und egoistisch ist.“ Denn ein Teil seines Kabinetts und seiner Berater arbeite mit Eifer an Plänen, die US-Demokratie langfristig auszuhöhlen. Aber bislang stehe ihnen Trump selbst am meisten im Weg. Die Frage ist, ob das langfristig überhaupt wichtig ist. Denn es könnte sein, dass er durch seine impulsiven Rachefeldzüge mehr Schaden anrichtet, als jeder geplante Umsturz es könnte.
Redaktion: Rebecca Kelber, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert