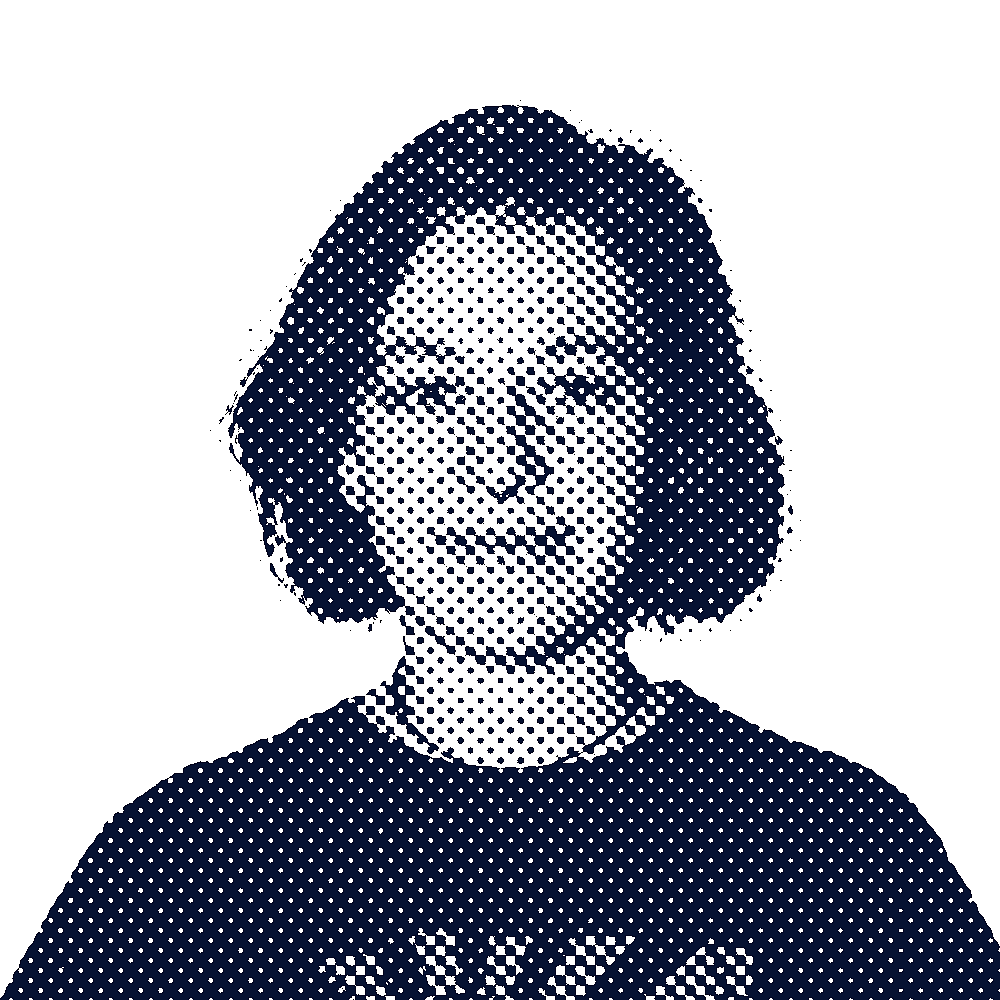Die Beziehung zwischen China und dem Westen ähnelt der Handlung vieler moderner Liebesgeschichten. „Enemies to lovers“, also „Feinde zu Freunde“ – so nennt man das beliebte Motiv. Ähnlich erging es China und dem Westen: China verachtete den Westen für seine Dekadenz und imperiale Vergangenheit. Der Westen konnte mit dem diktatorischen Regime in Peking nichts anfangen.
Doch wie es eine gute Liebesgeschichte will, entdeckten beide im Laufe der Zeit die Stärke des anderen. Westliche Innovation und Kapital passen einfach perfekt zu chinesischem Fleiß und Ausdauer. So überwanden sie nicht nur ihre Vorurteile, sondern lernten, dass sie ohne den anderen nicht konnten.
Zumindest, bis Donald Trump die Weltbühne betrat und dieses Skript abfackelte. Mit seiner unberechenbaren Wirtschaftspolitik demoliert der US-Präsident den freien Handel, auf dem die Globalisierung beruht.
Trump leistet sich derzeit Handelskonflikte mit allen Ländern der Welt, allen voran China. Er ist allerdings nicht der Erste, für den die Globalisierung kein Zukunftsmodell mehr ist. Der argentinische Präsident Javier Milei attestierte bei seiner Rede in Davos 2025 dem Weltwirtschaftsforum „Barbarei“ und eine „finstere mörderische Ideologie“. Auch Keir Starmer, der britische Premier, war sich nach Trumps Zoll-Ankündigungen sicher: Die Zeiten ungezügelter Globalisierung sind vorbei.
Mit der Rückabwicklung der Globalisierung plant Trump, den Wettlauf mit China um Künstliche Intelligenz, Halbleiter und unabhängige Lieferketten zu gewinnen. China hat sich darauf eingelassen, denn beide glauben: In diesem Wettrennen kann es nur einen Gewinner geben. Egal wer siegt, danach werden weder die Weltordnung noch der freie Handel nach den jetzigen Spielregeln funktionieren.
Doch ob es wirklich wie bei einem Olympia-Wettlauf ein Wettrennen mit klarem Sieger gibt, steht noch nicht fest. Denn chinesische und amerikanische Unternehmen haben eigene Pläne. Und sie sind opportunistischer, als man sich das in Washington und Peking so wünscht.
Die ganze Welt ist darum gebaut, dass die Globalisierung funktioniert⬆ nach oben
Ohne die Stadt Yiwu gäbe es kein Weihnachten. Zumindest würde Weihnachten ohne Yiwu anders aussehen. 80 Prozent aller Weihnachtsdekorationen weltweit werden in der unscheinbaren ostchinesischen Stadt hergestellt und vertrieben, egal ob Weihnachtsbaumkugeln, rote Mützen oder Lametta. Yiwu ist ein perfektes Beispiel dafür, dass die Globalisierung mehr ist als weltweiter Warenaustausch.
Sie lebt vor allem davon, dass sich die Länder der Welt die Arbeit teilen und Spezialindustrien, quasi ihre Steckenpferde, entwickeln. Nach dem Motto: Wenn du besonders gut Weihnachtsdekorationen herstellen kannst, kümmere ich mich um hochleistungsfähige Traktoren oder günstige Kopfschmerztabletten.
Diese Arbeitsteilung und die Spezialindustrien sind das eigentliche Geheimrezept der Globalisierung. Ohne Arbeitsteilung keine Steckenpferde und ohne Steckenpferde keine Arbeitsteilung.
Die ganze Welt ist darum gebaut, dass dieses System funktioniert: Der Staat ist dafür verantwortlich, seine Bürger:innen für die Spezialindustrien seines Landes auszubilden. Oder für die Industrien, die der Staat in Zukunft entwickeln will. Organisationen wie die Welthandelsorganisation (WTO) schaffen das Regelwerk, in dem Waren global ausgetauscht werden können. Unternehmen müssen Produkte möglichst kosteneffizient herstellen und vertreiben.
Die Globalisierung hat eine weitere faszinierende Eigenschaft: Sie bewegt Länder zur Zusammenarbeit, die sich ursprünglich spinnefeind waren. Besonders eindrucksvoll haben das China und die USA ab Mitte der 1970er Jahre gezeigt. Diese gegenseitigen Abhängigkeiten senken auch das Risiko für Konflikte. Wenn China zum Beispiel abhängig von Industrierobotern aus Deutschland ist, wird es sich zweimal überlegen, ob es die Nato angreift.
Auch wenn der Wohlstand auf der Welt ungleich verteilt ist: Die Globalisierung verspricht weniger Armut, mehr Austausch von Wissen – und günstige Handys und kitschigen Weihnachtsschmuck. Doch damit haben Trump und Xi ein Problem.
Warum die USA und China die Globalisierung rückabwickeln wollen⬆ nach oben
„Die Globalisierung ist fast tot. Freier Handel ist fast tot.“ So klagte Morris Chang, der Gründer und CEO des Chipherstellers TSMC, schon 2023. Tatsächlich musste die Globalisierung einige herbe Rückschläge erleiden, zum Beispiel die Corona-Pandemie. Seit den 2010er Jahren ist weltweiter Handel nicht mehr nur ein Selbstzweck, sondern auch eine Waffe. Die USA und China begannen 2018 ihren ersten Handelskrieg, als sich in den USA Sorge um die Konkurrenz aus Asien breitmachte. Andersrum stellte China 2020 den Export von Graphit nach Schweden fast komplett ein, als der Batteriehersteller Northvolt dort einen Standort für eine europäische Batterieindustrie aufziehen wollte.
Das ist ein Symptom der sich verändernden Weltordnung: von einer unipolaren, mit dem Machtzentrum USA, hin zu einer multipolaren Ordnung. In dieser Ordnung haben mehrere Großmächte das Sagen, unter anderem China.
„Das Ideal, von dem sowohl die USA als auch China träumen, ist: Ich bin unabhängig vom Rest der Welt. Und der Rest der Welt ist abhängig von mir.“ Das sagt Tim Rühlig, er forscht am European Union Institute for Security Studies (EUISS) zu Chinas Außen- und Technologiepolitik und den Beziehungen zwischen der EU und China. Um dieses Ziel (ich bin unabhängig, alle anderen abhängig) zu erreichen, muss jedes Land strategisch wichtige Technologien schneller als alle anderen entwickeln. Deswegen setzen immer mehr Länder auf die Absicherung ihrer Lieferketten und die Abschottung ihrer Industrien, auch Deutschland und die EU.
Morris Chang, der CEO von TSMC, hatte also in Teilen recht, als er sich darüber beklagte, dass die Globalisierung fast tot sei: Exportkontrollen, Zölle und Handelskriege schränken die Globalisierung ein. Auch deutsche Unternehmen sollen ihre Lieferketten diversifizieren und ihre Abhängigkeiten vom chinesischen Markt verringern, steht in der China-Strategie der alten Bundesregierung. De-Risking nennt man das. Die neue Bundesregierung will sogar eine Expertenkommission einsetzen, die jährlich den Stand der chinesisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen prüft und Maßnahmen zum De-Risking empfiehlt. In den USA fährt die Regierung mittlerweile eher eine Strategie des De-Couplings, also einer kompletten Entkopplung von China. Doch dabei haben die Regierungen die Rechnung ohne die Unternehmen gemacht.
Was Politiker:innen wollen, ist die eine Sache – was Unternehmer:innen daraus machen, eine andere⬆ nach oben
Als die Trump-Regierung im April 2025 den Export von Nvidias H20-Chip nach China blockierte, dauerte es nur wenige Wochen, bis der Konzern verkündete: Wir entwickeln einen H20-Chip für den chinesischen Markt, der knapp unter dem Schwellenwert der Exportlizenzen liegt. Noch im Juli soll der China-Chip auf den Markt kommen, den man vor allem zum Trainieren Künstlicher Intelligenzen braucht.
Volkswagen (VW) präsentierte vor einigen Wochen auf der Automesse in Shanghai, dem wichtigsten Event der Autoindustrie, stolz die ersten Elektromodelle, die der Konzern erstmals komplett in China entwickelt hat. Statt von China machte sich Volkswagen also von Deutschland unabhängig.
Nach Trumps Zollankündigungen gingen sofort Videos chinesischer Händler:innen viral, die forderten: Bestellt eure Handtaschen und Sportleggings doch direkt bei uns, denn die sind sogar mit Zöllen günstiger als die Markenartikel. Und im chinesischen Internet trendet gerade eine limitierte Merch-Kollektion der Tsinghua-Universität, für die Adidas mit der beliebten Hochschule kooperiert hat. Die meisten Shirts, Jacken und Taschen waren innerhalb eines Tages ausverkauft.
„Unternehmen kümmert vor allem, wie sie ihren Kunden das bestmögliche Produkt zur Verfügung stellen können“, sagt Tim Rühlig. „Ob der Kunde chinesisch ist oder nicht, ist da erstmal zweitrangig.“ Wie vom Licht angezogene Motten kleben deutsche und amerikanische Unternehmen also am chinesischen Markt, egal wie oft ihre Regierungen versuchen, sie zu verscheuchen.
Das zeigt: Was Politiker:innen wollen, ist die eine Sache. Was Unternehmer:innen daraus machen, eine andere.
Kaum etwas beweist das so gut wie Nordkorea, das isolierteste Land der Welt. Nordkoreaner:innen dürfen nur mit Genehmigung ausreisen, das Land ist außerdem vom globalen Finanzsystem ausgeschlossen und mit so vielen Sanktionen belegt wie kaum ein anderes Land. Trotzdem hat sich heute eine kreative und flexible Unternehmenskultur in Nordkorea herausgebildet, zeigt der Politikwissenschaftler Justin Hastings in seinem Buch „A Most Enterprising Country: North Korea In The Global Economy“.
Nordkoreanische Unternehmer:innen transportieren Waren nach und innerhalb Nordkoreas, handeln Drogen und betreiben eine nordkoreanische Restaurantkette namens „Pyongyang“, benannt nach der nordkoreanischen Hauptstadt. Die Restaurantkette hat weltweit 130 Standorte, die meisten davon in Asien. Der nordkoreanische Staat, schreibt Hastings, akzeptiere diese Geschäftstätigkeiten zähneknirschend, denn er könne längst nicht mehr überall und jederzeit gegen sie durchgreifen.
Klar, nicht alle diese Geschäfte sind besonders prestigeträchtig, wie etwa der Drogenhandel. Doch es zeigt, wie anpassungsfähig und kreativ Menschen mit Geschäftssinn sind – selbst dort, wo der Staat ihre unternehmerischen Ambitionen bekämpft.
„Das sind geopolitische Fantasien von Politiker:innen, die keine Ahnung von Techentwicklung haben“⬆ nach oben
Ob Zölle und Exportkontrollen überhaupt zu einem Vorteil im Techwettrennen führen, ist zweifelhaft. Viele Expert:innen schätzen, dass sie Chinas Aufholprozess höchstens verlangsamen. Der Thinktank CSIS warnt davor, dass Trumps Protektionismus China im Gegenteil beim Aufbau einer unabhängigen Chipindustrie hilft und gar zu Durchbruchstechnologien führen kann. Dem KI-Unternehmen „DeepSeek“ ist es immerhin ohne Hochleistungschips gelungen, ein Large Language Model vom Kaliber ChatGPT zu entwickeln.
Der US-chinesische Handelskrieg macht nur Sinn, weil beide glauben, sie kämpfen ein Nullsummenspiel. The winner takes it all, das Techwettrennen kann nur ein Land gewinnen. Aber stimmt das überhaupt? Tim Rühlig hat eine klare Meinung dazu: „Nein, das sind geopolitische Fantasien von Politiker:innen, die keine Ahnung von Techentwicklung haben.“
Das Knäuel an Handelsbeziehungen rund um den Globus zu entflechten, gelingt höchstens punktuell, bei 5G-Technologie zum Beispiel. Es wird jedoch immer Unternehmen und Organisationen geben, die einen Weg um diese Handelsbeschränkungen herum finden. Handelsbeschränkungen haben noch einen anderen Nachteil: 5G, mRNA-Impfstoffe oder Photovoltaik gibt es nur, weil Wissenschaftler:innen weltweit zusammen an ihnen gearbeitet haben. Protektionismus führt hingegen dazu, dass in den USA bereits bestehende Technologien in China nochmal entwickelt werden müssen – und umgekehrt.
Zwar gönnen sich die USA und China im Handelskrieg derzeit eine Atempause. Bis Mitte August ist ein Teil der gegenseitigen Zölle ausgesetzt. Trotzdem hat der US-chinesische Handelskrieg schon jetzt reale Auswirkungen. Zum Beispiel für Beschäftigte in chinesischen Textilfabriken oder Mitarbeiter:innen im Amazon-Lager, die in Kurzarbeit geschickt oder gekündigt werden. Das Chaos in den globalen Handelsketten müssen also oft Menschen ausbaden, die ohnehin schon prekär leben.
Die Globalisierung ist noch lange nicht gestorben. „Chinas politische Partner mögen eher in Russland oder im Globalen Süden liegen“, sagt Rühlig. China sehe sich jedoch auch in Zukunft mit dem Westen verpartnert, sagt er. Die Übernahme der Solar- und Autoindustrie durch China sind allerdings Warnsignale für die Abhängigkeiten, die China schaffen will. Um nicht vollständig hinter den USA und China zurückzufallen, muss die EU dringend in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Elektromobilität und Mikrochips aufholen. Gutachten wie der Draghi-Bericht und der EU-Wettbewerbskompass zeigen: Immerhin hat die EU das auf dem Schirm.
In einer klassischen „Enemies to Lovers“-Geschichte funktioniert die Verwandlung von Feindschaft in Romantik übrigens nur, weil beide Parteien bereit sind, sich zu verändern und Verständnis für den anderen aufzubringen. Vielleicht ist es ein Glück, dass nicht nur geopolitische Fantasien am Drehbuch der chinesisch-westlichen Beziehungen mitschreiben. Die sind nämlich schlecht für ein Happy End.
Redaktion: Isolde Ruhdorfer, Bildredaktion: Philipp Sipos, Schlussredaktion: Susan Mücke, Audioversion: Christian Melchert
.jpg?compress=true&format=auto)