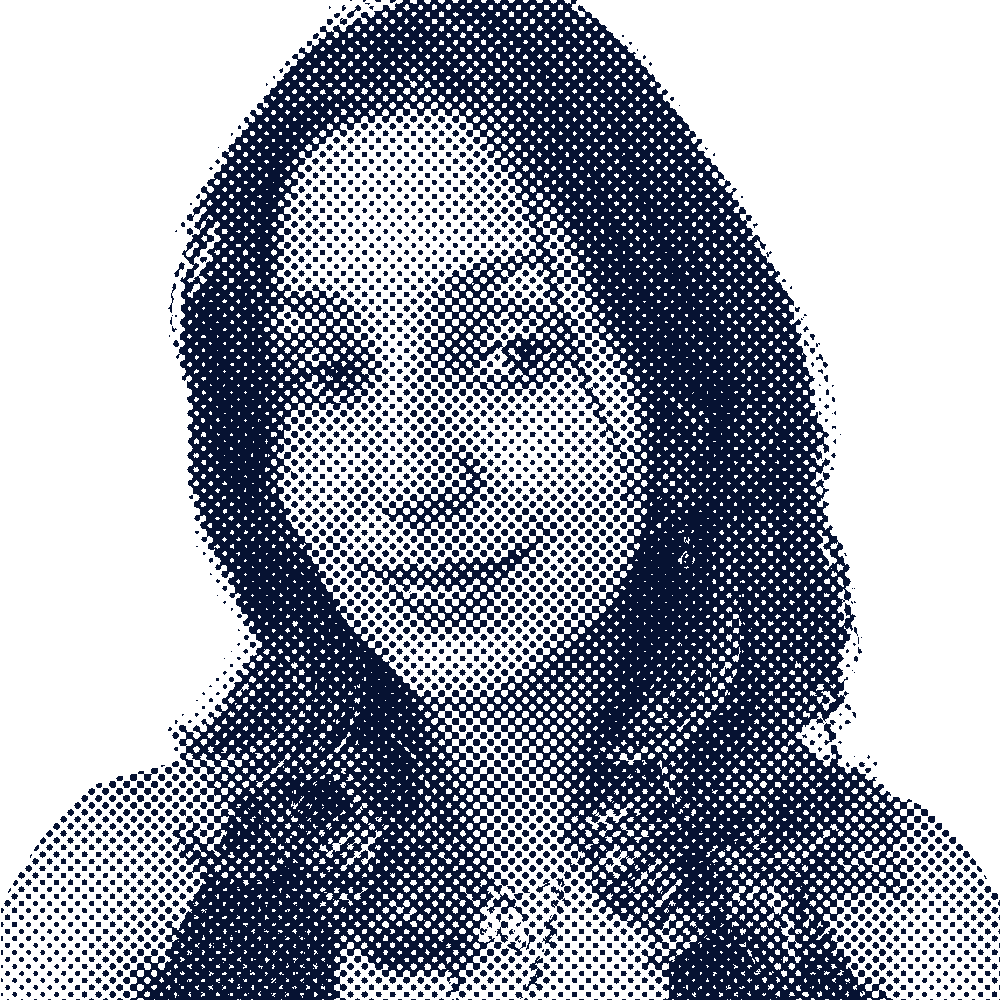Begeistert erzählte mir meine enge Freundin Mara von einer Party am Wochenende. „Es war wahnsinnig witzig, alle waren da.“ Alle, außer ich.
Ein Kumpel hat in seiner neuen Wohnung gefeiert – eine dieser Partys, bei denen alte Freunde, neue Bekanntschaften und Menschen, mit denen man gern befreundet wäre, aufeinandertreffen. Auch Lilly und Carlo, die wir erst seit ein paar Wochen kennen, waren da. Mara findet beide total spannend. Ich auch.
Normalerweise nehmen Mara und ich uns gegenseitig überallhin mit. Ein unausgesprochenes Ding. Dieses Mal nicht.
Eine Kleinigkeit, eigentlich. Aber innerlich zieht sich alles in mir zusammen. Ich lächle gezwungen und frage nach Details. Ich merke, wie ich an den falschen Stellen nicke, wie sich meine Kehle zuschnürt. Ich will gelassen wirken. Stattdessen brodelt es in mir. Klar, denke ich, wenn ich nicht dabei bin, ist es leichter, die beiden für dich zu gewinnen.
Eigentlich bin ich einfach verletzt, dass sie mich nicht dabei haben wollte.
Stunden später überlege ich: Warum habe ich nichts gesagt? Darf ich überhaupt sauer sein? Es ist mir peinlich. Sie soll es nicht merken, und gleichzeitig will ich, dass sie meine Gedanken liest. Am liebsten würde ich es einfach rauslassen. Aber ich weiß: Wenn ich streite, fühle ich mich danach scheiße. Was, wenn sie mir dann nichts mehr erzählt, um mich nicht zu verletzen? Also schlucke ich es runter und ärgere mich, dass ich so sensibel bin.
Ich habe nie wirklich gelernt zu streiten.
Dieses Gefühl kennen viele Menschen. Eine nicht-repräsentative Umfrage unter KR-Leserinnen zur Frage „Streitest du mit deinen Freundinnen“ zeigt: Die große Mehrheit, knapp 85 Prozent, greifen bei Spannungen mit Freundinnen zu vermeidenden Strategien. Sie warten ab, hoffen, dass sich das Problem von selbst löst oder besprechen es lieber mit jemand anderem.
Passiv-aggressive Spannungen werden als belastend empfunden, sind aber erstaunlich verbreitet. Rund 30 Prozent gaben an, im Streit passiv-aggressiv zu reagieren. Da erkenne ich mich auch wieder. Wochen nach der Party rutschte mir ein halb ironischer Kommentar heraus, als Mara in ihrer WG noch einmal von der Party erzählt: „Die Partys, bei denen ich nicht dabei bin, sind immer die besten, oder?“
Explosive, wütende Auseinandersetzungen dagegen? Davon berichtet kaum jemand in der Umfrage.
Viele erzählen, dass sie mit ihren Freundinnen überhaupt nicht streiten oder dass der letzte Streit Jahre zurückliegt. Für etwa die Hälfte der Teilnehmenden bedeutete Streit das Ende der Freundschaft.
Allerdings sagt die andere Hälfte: Streit kann eine Freundschaft vertiefen „Bis man mit jemandem in einen echten Streit geraten ist, kennt man die andere Person nicht“, schreibt ein KR-Mitglied.
Ich frage mich, ob sie recht hat. Kann es sein, dass wir uns mehr streiten sollten? Um das herauszufinden, bin ich dem gemeinen Mädchen und der Zicke in mir auf den Grund gegangen.
Warum Konflikte in weiblichen Freundschaften so schwerfallen⬆ nach oben
Eine Leserin schreibt: „Ich streite mit Frauen genauso sachlich und lösungsorientiert wie mit Männern. Trotzdem ist es deutlich schwerer.“ Was sie beschreibt, lässt sich tatsächlich belegen.
Die amerikanische Autorin Danielle Bayard Jackson nennt in ihrem Buch „Fighting for Our Friendships“ drei Grundpfeiler weiblicher Freundschaft: Symmetrie, Vertraulichkeit und Unterstützung. Sie erklären, warum Nähe entsteht und warum Streit so schwerfällt.
Freundinnen verbinden sich über Ähnlichkeiten: gleiche Werte, gleiche Witze, gleiche Geschichten. „Sie versteht mich ohne Worte“, heißt es oft. Konflikte aber stören diese Symmetrie. Plötzlich sehen wir Unterschiede und damit das Risiko, die Verbindung zu verlieren.
Vertraulichkeit ist die Währung weiblicher Freundschaft und hält Bindungen zusammen. Wir teilen Geheimnisse, Hoffnungen, Peinlichkeiten. Doch in Konflikten scheint es riskant, ehrlich zu sein: „Wird sie mich noch schützen, wenn sie verletzt ist?“
Auch Unterstützung bekommt im Konflikt Risse. Wir erwarten Verständnis und Zuwendung. Aber ein ehrlicher Streit verlangt oft genau das Gegenteil. Zu sagen „Das hat mich verletzt“ oder „So geht das nicht weiter“, fühlt sich dann illoyal an.
Das Mean Girl – das Symbolbild weiblicher Konflikte⬆ nach oben
Konflikte sind in weiblichen Freundschaften also tatsächlich schwer auszuhalten und zwar nicht, weil wir zu sensibel sind, sondern weil wir es so gelernt haben.
Wir sind als „gute Mädchen“ sozialisiert. Wir lernen früh, Rücksicht zu nehmen, nett zu sein, zu vermitteln. Wut oder Konfrontation vermeiden wir, Bedürfnisse schlucken wir herunter, Emotionen regulieren wir möglichst unauffällig. Wir lernen, uns um andere Menschen mehr zu kümmern als um uns selbst. So entsteht auch unser Bild davon, was eine „gute Freundin“ ist: verständnisvoll, loyal, sanft.
Dem gegenüber steht der „Mean-Girl-Trope“, eine wiederkehrende Rolle in Filmen: die selbstbewusste, manipulative Gegenspielerin zur Good-Girl-Heldin, die ihre soziale Macht über Angst und Intrigen durchsetzt. Sie ist alles, was wir nicht sein wollen. Wir lernen, die Regina Georges, Sharpay Evans und Blair Waldorfs dieser Welt zu verurteilen, als Antithese zu dem, was wir als „gute Freundin“ gelernt haben.
Aber was, wenn das Mean Girl gar nicht unsere Gegenspielerin ist, sondern unser Spiegelbild?
Das Mean Girl zeigt, was passiert, wenn die Regeln weiblicher Sozialisierung auf echte Gefühle treffen. Wenn Wut, Enttäuschung oder Konkurrenz keinen Platz bekommen, suchen sie sich andere Wege: über subtile Sticheleien, passiv-aggressive Kommentare, Schweigen, Ausschluss. Das Mean Girl ist also nicht die Ursache des Problems, sondern sein Symptom. Ein Produkt einer Sozialisierung, die Frauen nicht beibringt, richtig zu streiten.
Ich bin selbst ein Mean Girl. Wenn ich das „Absichtliche Schweigen“ anwende. Wenn ich über einen Konflikt mit allen spreche, außer mit der betroffenen Person. Wenn ich meine Gefühle unterdrücke, direkte Konfrontation vermeide, Schuld verteile, beschwichtige, manipuliere oder mich in Rechtfertigungen verliere, statt zuzuhören. Wenn ich Fehler nicht verzeihe, sondern mich an ihnen aufhänge. Auch das ist gemein – nur eben in einer Form, die gesellschaftlich akzeptierter ist. Eine, die oft sogar als Reife, Ruhe oder Sensibilität gelesen wird.
Wir grenzen uns vom Mean Girl ab, um uns selbst zu schützen. „Ich bin nicht so“, sagen wir. „Ich lass meine Gefühle nicht an anderen aus.“ Frauen lernen von dieser Figur: Wut, die sich in intrigantem Verhalten äußert, macht uns unsympathisch. Doch genau in dieser Abgrenzung wiederholen wir die Muster. Wir disziplinieren uns gegenseitig, statt gemeinsam zu fragen, warum Wut, Ehrgeiz oder Macht überhaupt als „zu viel“ gelten. So bleibt das System stabil und weibliche Solidarität brüchig.
Vielleicht wäre der ehrlichere Umgang, das Mean Girl nicht zu verurteilen, sondern zu verstehen. Ihre Haltung ist widersprüchlich, aber sie erzählt eine Wahrheit: Frauen brauchen Räume, in denen sie wütend sein dürfen, ohne sich dafür zu schämen. Wenn wir lernen, richtig zu streiten, sind wir keine Mean Girls mehr.
Toxische Weiblichkeit – wie wir lernen, uns selbst auszuhalten⬆ nach oben
In ihrem Buch „Toxische Weiblichkeit“ beschreibt Sophia Fritz eindrücklich, wie uns weibliche Sozialisierung oft nicht nur selbst im Weg steht, sondern auch zu toxischem Verhalten führt. Sich davon zu befreien, ist erst möglich, wenn wir beginnen, offen über Wut, Verletzlichkeit und Scham zu sprechen.
Besonders bewegt hat mich ein Auszug über „die Zicke“. Fritz beschreibt, wie sie als Kind als Zicke abgestempelt wurde, wenn sie sich gegen ihren Bruder wehrte:
„Wenn ich beleidigt war, musste sich mein Bruder für das, was er gesagt hatte, nicht entschuldigen. Dann lag der Fehler bei mir, an meiner zur Schau gestellten Sensibilität, an meiner Unfähigkeit, ein Auge zuzudrücken. Zickig zu sein war kein Kompliment. Es gab aber einen Moment, in dem mir klar wurde, ich bin eine Zicke, und als ich mir das eingestand und trotzig zu mir selbst stand, nahm ich dem Argument jede Kraft. Ich stand in der Küche, war selbstbewusst beleidigt und sagte: Er muss sich entschuldigen, es ist mir egal, ob ich zickig bin, er war fies.“
Diese Passage hat bei mir etwas gelöst. Die Angst, „zu kompliziert“ oder „dramatisch“ zu sein, hält mich bis heute davon ab, Konflikte anzusprechen. Ich habe gelernt, dass Wut gefährlich ist, etwas, das kontrolliert werden muss, statt gehört zu werden. Also reguliere ich mich, noch bevor das Gespräch beginnt, formuliere meine Bedürfnisse weich, denke an die anderen, bevor ich überhaupt bei mir bin. Manchmal ist das einfach zu viel Arbeit. Dann ist Schweigen der leichtere Weg – leiser, kontrollierter, gesellschaftlich belohnt.
Die Psychologin Anne Campbell beschreibt in ihrem Buch „Zornige Frauen, wütende Männer: Geschlecht und Aggression“, dass Frauen ihre Wut häufig spalten: in einen verantwortungsvollen Teil, den man kontrolliert, und einen rebellischen, den man zum Ausdruck bringt. So verurteilen sie sich doppelt: fürs Unterdrücken und fürs Zeigen.
Während männliche Aggression oft als Ausdruck von Stärke gelte, werde weibliche Wut als Kontrollverlust wahrgenommen, so Campbell. Diese kulturelle Prägung führe dazu, dass viele Frauen ihren Ärger unterdrücken, selbst dann, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen.
Tatsächlich ist es für mich befreiend, wenn eine Freundin wütend wird. Wenn jemand zickig zu mir ist, spüre ich, wie sich auch in mir etwas löst: die Erlaubnis, endlich authentisch zu sein und zurück zu „zicken“.
Wut ist keine Schwäche. Sie ist ein Signal – ein Hinweis auf Ungleichgewicht, ein Anstoß zur Veränderung. Wenn Frauen lernen, ihre Wut als legitimen Teil ihrer Emotionalität zu verstehen, entsteht in Freundschaften Raum für echte Nähe.
Was wir vom Aktivismus über Streit lernen können⬆ nach oben
Aktivismus bietet einen leichteren Zugang, um das Streiten zu lernen. Streiten heißt, sich für die eigenen Bedürfnisse stark zu machen. Konflikte entstehen, wenn wir uns nicht gesehen fühlen, und Streit ist der Versuch, genau das einzufordern.
Im Aktivismus passiert genau das auf gesellschaftlicher Ebene: Wir kämpfen für etwas, das uns wichtig ist, das aber zu wenig Raum, Aufmerksamkeit oder Unterstützung bekommt.
„Das Mackertum könnt ihr euch schenken! Gegen jedes Rollendenken!“
„Wir sind laut, weil ihr uns die Luft nehmt!“
„Stop the bombing, start the listening!“
Meine Freundin Toni steht auf der Bühne bei einer Demo, und ich bekomme Gänsehaut, weil ich ihre Dringlichkeit, ihre Kraft und ihre Wut spüre. Eine Woche später erzählt sie mir, dass sie sich nicht traut, ihrer besten Freundin zu sagen, dass sie enttäuscht ist.
Im öffentlichen Raum erlauben sich immer mehr Frauen die Wut, im persönlichen noch nicht. Feministinnen haben sich dieses Recht hart erkämpft und uns vorgelebt, dass man Wut zeigen kann. Aber im Privaten gilt dieselbe Lautstärke plötzlich als Rücksichtslosigkeit.
Vielleicht ist Streit die aufrichtigste Form von Zuneigung, die wir einander schenken können⬆ nach oben
Danielle Bayard Jackson schreibt: „Ein guter Streit greift das Problem an, nicht die Person. Er kann weh tun, aber nicht zerstören.“
Streit kann einen Raum öffnen, in dem Wut, Enttäuschung oder Scham vorkommen dürfen, ohne sofort gezähmt zu werden. Ein ehrliches, ungeschminktes Gespräch, ohne die Angst, dass Liebe oder Respekt dabei verschwinden.
Die eigentliche Sehnsucht hinter all dem Nachdenken über Streit ist nicht der Wunsch, immer recht zu haben, sondern gesehen zu werden.
Ich frage mich, mit wem ich heute noch befreundet wäre, hätten wir gelernt, Konflikte richtig auszuhalten, statt sie zu vermeiden.
Ich wünsche mir Freundschaften, in denen Streit weh tun darf, ohne zerstörerisch zu sein. In denen wir Fehler eingestehen, uns entschuldigen und beide Seiten Raum bekommen. Wo es nicht darum geht, die andere Person zu besiegen, sondern das Problem gemeinsam zu verstehen. Wo wir den Mut haben zu reparieren, statt zu schweigen. Freundschaften, in denen Grenzen geachtet werden und Nähe genau daraus entsteht, dass wir einander nicht aufgeben, selbst wenn es schwierig wird.
Der Versuch, Aktivistin für meine Wut zu sein⬆ nach oben
Wochen nach der Party platzt es endlich aus mir heraus. Nicht geplant, nicht ruhig, nicht vernünftig – einfach so, mitten in einem Gespräch über etwas völlig anderes.
„Weißt du eigentlich, wie scheiße das war, als du mich nicht mitgenommen hast?“
Mara blinzelt überrascht. „Wovon redest du?“
„Von dieser verdammten Party. Du wolltest nicht, dass ich dabei bin, und dann tust du so, als wäre nichts!“
Sie zieht die Augenbrauen hoch. „Oh Gott, das war doch nix Persönliches. Ich dachte, du wolltest eh nicht mit. Sorry, aber ich darf ja wohl mal irgendwo alleine hingehen.“
„Darum gehts nicht! Es geht darum, dass du mich ausgeschlossen hast, weil du mich nicht dabei haben wolltest!“
Wir schreien nicht, aber die Luft zwischen uns ist dicht. Ich spüre, wie mir Tränen in die Augen steigen, und ich hasse mich dafür.
Mara wird laut: „Weißt du, du bist manchmal echt anstrengend. Ich überlege ständig, was ich sagen darf, weil du alles sofort persönlich nimmst.“
Stille. Mein Herz hämmert. Ich will zurückschießen, sie verletzen, wie sie mich verletzt hat – aber ich tue es nicht.
Ich sage nur: „Dann sag das. Aber sags mir, anstatt so zu tun, als wäre alles okay.“
Wir schauen uns beide zum ersten Mal wirklich an. Kein Vermeiden, kein „alles gut“. Stattdessen: Wut, Enttäuschung und dieses vage Gefühl, dass wir uns gerade wieder annähern, obwohl es weh tut.
Ganz lieben Dank an alle KR Mitglieder, die sich an meiner Umfrage beteiligt haben!
Redaktion: Nina Roßmann, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Gabriel Schäfer.