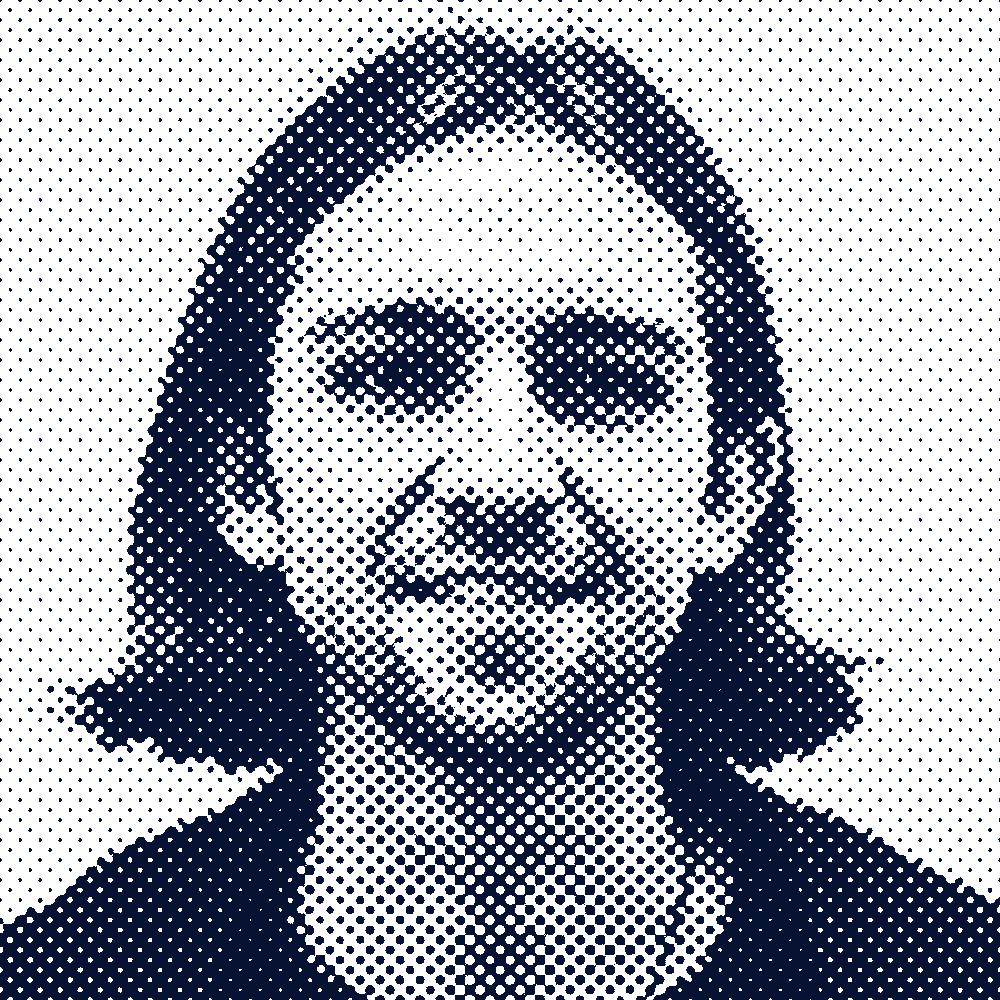Das Bild vom menschenleeren Regenwald ist eine koloniale Erfindung. Indigene Völker haben den Amazonas über Jahrtausende geformt: Sie schufen die fruchtbarsten Böden der Region. Sie prägten die Zusammensetzung des Waldes selbst.
Der Archäologe Eduardo Neves ist einer der bekanntesten Intellektuellen Brasiliens. Er erforscht seit Jahrzehnten, wie der Amazonas wirklich entstanden ist.
Im Interview erklärt er, warum die Idee der „unberührten Natur“ bis heute dazu dient, den Regenwald auszubeuten und warum dessen Rettung davon abhängt, seine Geschichte zu verstehen.
.jpg?compress=true&format=auto)
Seit er mit 18 Jahren das erste Mal den Amazonas besuchte, forscht Eduardo Neves zur Vergangenheit des Regenwaldes. Er ist Archäologe und Direktor des Museums für Archäologie und Ethnographie an der Universität von São Paulo. | Marina Garcia Burgos
Herr Neves, wenn wir an den Amazonas denken, stellen wir uns meist ein von Menschen unberührtes, wildes Paradies vor. Wer profitiert davon, dass wir den Amazonas so sehen?
Vor der Kolonialisierung war die Amazonasregion dicht besiedelt. Bis zu zehn Millionen Menschen lebten dort im Jahr 1492. Das liest man auch in Berichten europäischer Reisender aus dem 16. Jahrhundert. Als jedoch im 18. Jahrhundert die ersten europäischen Wissenschaftler in die Region kamen, fanden sie ein entvölkertes Gebiet vor: Millionen Indigene waren bereits durch eingeschleppte Krankheiten oder aufgrund der Versklavung durch Portugiesen und Spanier gestorben.
Diese Menschen hatten hauptsächlich aus Erde, Holz und Stroh gebaut – organische Materialien, die sich zersetzen und Teil der Bodensubstanz werden, wenn Siedlungen verlassen werden. Auf anderen Teilen des amerikanischen Kontinents dagegen errichteten indigene Völker Bauwerke aus Stein, Lehmziegeln oder Mauerwerk – klare Zeichen alter Zivilisationen, die für die Europäer sichtbar waren.
Die Wissenschaftler jener Zeit konstruierten also ein Bild des Amazonas, das sich bis heute fortsetzt: ein menschenleeres Territorium. Sie erkannten nicht, dass dieses Bild das Ergebnis der ersten Jahrhunderte europäischer Kolonialisierung war. Wir wissen heute, dass die traditionellen Bevölkerungen einen wichtigen Beitrag zur Entstehung des Amazonas geleistet haben, wie wir ihn heute kennen.
Was gibt es heute für Anhaltspunkte, dass der Regenwald auch das Produkt menschlicher Einflüsse ist?
Ein Beispiel aus dem Amazonas sind die sogenannten „Terra Preta“-Böden. Das sind extrem fruchtbare, sehr produktive und stabile Böden. Sie verlieren ihre Fruchtbarkeit selbst nach Jahrtausenden nicht. Heute wissen wir, dass diese Böden von indigenen Völkern geschaffen wurden. Sie mischten Keramikreste, Ton, Kohle, Knochen, Laub und Pflanzenabfälle in die Erde, um den Boden fruchtbar zu machen.
Die Entstehung dieser Böden begann vor rund 6.000 Jahren. Sie bedecken etwa zwei bis drei Prozent des gesamten Amazonasbeckens. Das ist eine Fläche ungefähr so groß wie der Bundesstaat Rio de Janeiro.
Terra Preta zeigt lokale Eingriffe in den Boden. Lässt sich dieser menschliche Einfluss aber auch im Wald selbst nachweisen? Über die gesamte Region hinweg?
Ein weiteres Beispiel ist die Zusammensetzung des Regenwaldes selbst. Heute wissen wir, dass es im Amazonasgebiet eine sogenannte „Hyperdominanz“ von Baumarten gibt: Insgesamt existieren hier etwa 16.000 Baumarten. Nicht Pflanzen im Allgemeinen, sondern Bäume. Und von diesen Baumarten machen 224 Arten, also nur 1,4 Prozent, fast die Hälfte aller Bäume in der gesamten Amazonasregion aus.
Das heißt: Es gibt eine enorme Baumvielfalt, aber gleichzeitig eine Überrepräsentation weniger Arten. Und wenn wir diese hyperdominanten Arten betrachten, sehen wir: Viele von ihnen sind Pflanzen, die für die Wirtschaft und Ernährung der Region besonders wichtig sind. Vor allem Palmen. Sie werden für Hausdächer, Wände und als Baumaterial genutzt. Oder als Nahrungsmittel.
Wie ist dieses Muster entstanden, diese Überrepräsentation ausgerechnet der Arten, die für Menschen besonders nützlich sind?
Einige Pflanzenforscher sagen, dieses Muster sei natürlich entstanden, jedoch durch menschliche, insbesondere indigene Präsenz verstärkt worden. Das könnte stimmen. Aber in archäologischen Fundstätten finden sich zum Beispiel auch zahlreiche Palmensamen und wir wissen, dass Palmen für heutige indigene Gemeinschaften sehr wichtig sind. Vermutlich gab es also eine Art Wechselwirkung: ein natürliches Muster, das durch die indigene Bevölkerung verstärkt wurde.
Und genau das ist der Kernpunkt. Es geht nicht darum zu behaupten, dass der ganze Regenwald von indigenen Völkern geschaffen wurde. Interessant ist vielmehr zu verstehen, dass dieses Muster eine Art Allianz zwischen der indigenen Bevölkerung und der Natur widerspiegelt. Eine Lebensweise, die Natur und Kultur nicht trennt, wie es die westliche Tradition tut, sondern sie als eng miteinander verflochten und gemeinsam gewachsen begreift.
Der Amazonas hat heute bereits ein Fünftel seiner Fläche verloren. Müssen wir Naturschutz neu denken? Und zwar so, dass wir die „Natur“ nicht schützen, indem wir sie vor Menschen abriegeln?
Wenn die Archäologie recht hat, dann kann man Gesellschaften und Umwelt nicht voneinander trennen. Sollten unsere Hypothesen stimmen, dann beruhen die agroökologischen Strategien der Amazonas-Bevölkerung nicht auf absoluter Kontrolle über Anbauflächen, sondern auf einer offenen, flexiblen Beziehung der Menschen zur Umwelt.
Vielleicht war das im mittelalterlichen Europa ähnlich: Bauern rodeten Lichtungen im Wald, bestellten sie eine Zeit lang und ließen sie dann wieder brachliegen. Der Wald wuchs zurück. Im tropischen Klima des Amazonas läuft dieser Prozess einfach viel schneller ab und mit viel größerer Artenvielfalt. Die traditionellen, vorspanischen Systeme der Landwirtschaft beruhen also nicht auf Kontrolle, sondern auf Vielfalt und Offenheit.
Das ist das Gegenteil jener Landwirtschaft, die heute die Amazonasregion dominiert und zerstört: riesige Sojafelder und Rinderfarmen, die hoch technologisierte Monokulturen schaffen.
Das heutige Agrargeschäft ist zwar technologisch hoch entwickelt, basiert aber auf absoluter Kontrolle. Es ist eine Art „Präzisionslandwirtschaft“, die auf genetisch identische Pflanzen, Monokulturen und den Einsatz von Chemikalien setzt, um jede Konkurrenz anderer Arten zu eliminieren. Das schafft völlig verarmte Ökosysteme.
Die traditionellen Agrarsysteme Amazoniens dagegen setzen auf den Anbau von Vielfalt. Es gibt auch dort bevorzugte Arten, aber es handelt sich um offene Systeme, die Diversität fördern – das Gegenteil der modernen Monokulturen, die langfristig nicht tragbar sind. Aktuell haben wir einen steigenden Sojapreis und die Sojaproduktion im Amazonas nimmt zu. Wirtschaftlich mag das kurzfristig Sinn ergeben, aber in manchen Gebieten sinkt bereits die Produktivität, Wasservorräte erschöpfen sich, die Umweltkosten sind enorm. Es handelt sich um kurzfristig rentable, langfristig jedoch unhaltbare Systeme, die wirtschaftlich und ökologisch nicht zukunftsfähig sind.
Wir haben viel über die europäischen Kolonialisten gesprochen. Wie geht die heutige brasilianische Regierung mit dem Regenwald um?
Brasilien hat heute ein Verhältnis zum Amazonas, das von internem Kolonialismus geprägt ist. Natürlich stehen starke wirtschaftliche Interessen dahinter. Aber die ideologische Grundlage dafür liegt in der Vorstellung, der Amazonas sei ein „leeres“ Gebiet, das bereitstehe, um wirtschaftlich ausgebeutet zu werden. Sie liegt in der Vorstellung, die indigenen Völker seien Völker „ohne Geschichte“. Sie liegt in der Vorstellung, der Regenwald sei zu lebensfeindlich für eine menschliche Besiedlung und deshalb nie bewohnt gewesen.
Während der Militärdiktatur 1964 bis 1985 war diese Sichtweise besonders ausgeprägt. Aber man sieht sie bis heute, auch in linken Regierungen. Ich habe mein Leben lang Lula und die Arbeiterpartei gewählt. Auch innerhalb der linken Regierung gibt es Kräfte, die bis heute eine, in meinen Augen überholte, „entwicklungsorientierte“ Politik vertreten. Es ist also essenziell, die Vergangenheit des Amazonas zu verstehen, damit der Regenwald eine Zukunft haben kann.
Inwiefern?
Wir leben mitten in einem Konflikt, im Anthropozän. In Brasilien und speziell im Amazonas spielt sich dieser Konflikt zwischen zwei Lebensformen ab: den offenen, an Vielfalt orientierten agroökologischen Lebensformen auf der einen Seite. Und den wirtschaftlichen Strategien der Monokultur, der Entwicklung und des Großbergbaus auf der anderen.
Diese auf Spezialisierung und Mechanisierung beruhenden Systeme werden sich nicht halten können. Ihr ökologischer Preis ist zu hoch. Gleichzeitig stehen wir vor der Herausforderung, eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren und eine wirtschaftlich tragfähige Lebensmittelproduktion zu gewährleisten.
Die große Frage lautet also: Wie lassen sich die agroökologischen Strategien der traditionellen Amazonasbevölkerung so skalieren, dass sie wirtschaftlich tragfähig sind, ohne ihre Grundlogik der Vielfalt und Offenheit zu zerstören? In anderen Worten, wie können wir Kapitalismus und Agroökologie vereinen, das heißt ein System, das auf Gewinn basiert, mit einem, in dem Gewinn wichtig, aber nicht das zentrale Ziel ist? Ich selbst habe darauf keine endgültige Antwort.
Gibt es Ansätze einer Antwort im Amazonas selbst?
Es gibt natürlich tolle Initiativen im Amazonasgebiet: Kooperativen, die Nussmehl, Öle, Kakaoprodukte oder andere Naturerzeugnisse herstellen. Die Frage ist, wie man diese Aktivitäten skalieren und die Menschen vor Ort fair bezahlen kann, sodass sie einen ökonomischen Anreiz haben, ihre nachhaltige Arbeit fortzusetzen.
Ein Beispiel: Im Bundesstaat Pará zahlt die Regierung seit Kurzem einen künstlich festgelegten Preis für Naturkautschuk, der deutlich über dem Marktwert liegt. Dadurch kehren viele Menschen zur Latex-Gewinnung zurück. Finanziert wird das durch den Verkauf von CO₂-Zertifikaten öffentlicher Länder.
Ich sehe keine Lösung, die ohne staatliches Eingreifen funktioniert. Natürlich braucht es freie Initiative und wirtschaftliche Anreize. Aber wenn der Staat nicht regulierend eingreift, etwa durch Mindestpreise für nachhaltige Produkte, wird der Markt das Problem nicht lösen können. Davon bin ich überzeugt.
Redaktion: Rico Grimm, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Gabriel Schäfer, Audioversion: Christian Melchert und Iris Hochberger