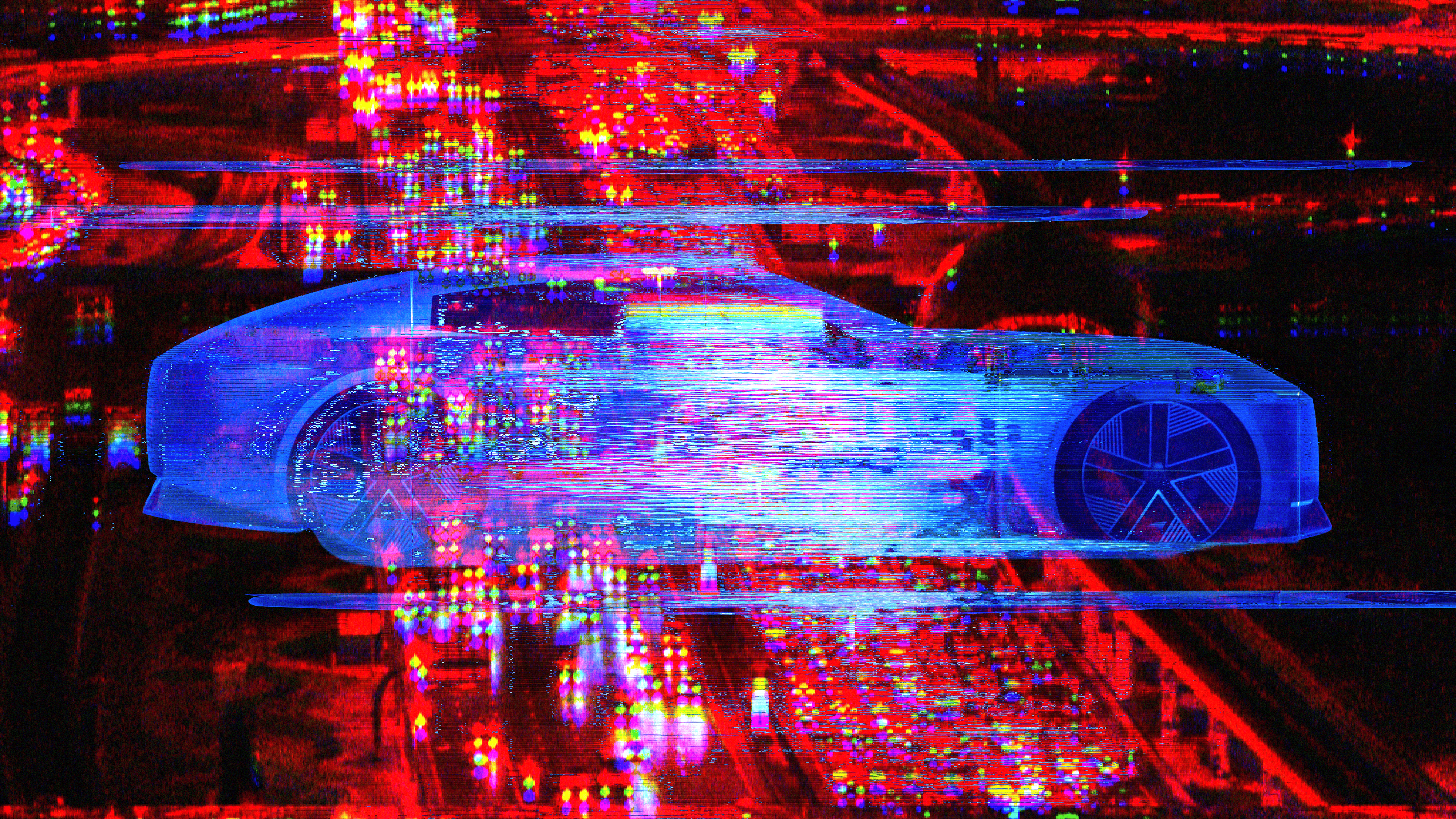Es mag überraschend sein, aber Deutschland ist keine einsame Insel.
Die Handelsnation Deutschland ist es erst recht nicht.
Allein, Debatten über Autos führen Spitzenpolitiker und Teile der Industrie so, als wäre Deutschland just das, was ein Blick auf Weltkarte und Exportstatistiken so klar widerlegt: ein Eiland, auf dem weltbeste Ingenieure eine weltbeste Technologie entwickeln, völlig losgelöst vom Rest des Planeten.
E-Autos fördern? Ja, nein? Das Verbrenneraus nach hinten schieben? Die CO₂-Grenzen für die Autohersteller abschwächen?

Diesen Buchauszug hat Rico Grimm ausgewählt
Er schreibt seit Jahren über die Klimakrise – und wie wir sie lösen können. Hier begründet er, warum dieser Text deine Zeit wert ist.
Diese Fragen dominieren die industriepolitische Debatte. Zu Recht natürlich! Die Autoindustrie ist wichtig für die Menschen im Land. Aber es ist auch eine merkwürdige Debatte. Das stellt jeder fest, der mit dem Finger von Deutschland aus auf dem Globus nach Süden fährt, nach Äthiopien zum Beispiel.
Das Land hat kürzlich die Einfuhr von Autos mit Verbrennermotoren verboten. Indien, Brasilien, Vietnam sind alles Länder, in denen E-Mobilität rasant wächst. Das sind Länder, in denen die Kunden der Zukunft sitzen.
Mir ist es wichtig, dass wir die Debatte über E-Autos in Deutschland mit Blick auf die ganze Welt führen. Deswegen habe ich diesen Text der beiden renommierten Klima- und Technologiejournalisten Toralf Staud und Benjamin von Brackel auf die Krautreporter-Seite geholt. Es ist ein Auszug aus ihrem neuen Buch „Am Kipppunkt“, in dem sie über Klima-Kipppunkte, gute wie schlechte, aufklären. Er zeigt: Deutschland führt Diskussionen über E-Mobilität, der Rest der Welt fährt einfach mal los.
In den vergangenen Jahren wurden 95 Prozent der E-Autos in den drei größten Märkten der Welt verkauft, in China, Europa und den USA. Doch weil die Preise gesunken sind und weiter sinken, greift das Wachstum immer stärker auf andere Teile der Erde über.
In Südostasien haben E-Autos mancherorts schon höhere Marktanteile erreicht als in etlichen EU-Staaten. Vietnam beispielsweise liegt bereits bei 15 Prozent und besitzt einen eigenen Hersteller, VinFast, der auch schon in viele andere Länder exportiert. Oder Thailand, dort machen E-Autos bereits zwölf Prozent der Neuzulassungen aus. Auf den Straßen von Bangkok vollzieht sich, was Beobachter für viele andere Schwellenländer erwarten: Bisher dominierten dort japanische Automarken, sie hatten seit den 1960er Jahren auch Fabriken in Thailand eröffnet. Doch rasant werden Toyota, Honda, Mitsubishi & Co. von chinesischen Herstellern verdrängt, die halten am schnell wachsenden E-Segment einen Marktanteil von achtzig Prozent. Während erste japanische Hersteller bereits angekündigt haben, ihre thailändischen Werke zu schließen, haben Great Wall Motor, SAIC und zuletzt BYD wie auch CATL, der Weltmarktführer für E-Auto-Akkus, ihrerseits Fabriken eröffnet. Die thailändische Regierung sieht in der Technologie die Zukunft und fördert die Branche mit Kaufzuschüssen für Kunden und Steueranreizen für Hersteller, die im Land investieren.
E-Autos breiten sich überall auf die gleiche Art aus: erst langsam, dann schneller als erwartet⬆ nach oben
„Einige der höchsten Wachstumsraten finden sich in Schwellenländern“, schreiben die Analysten von Bloomberg und verweisen auf zwei Länder mit riesigen Märkten. Für Brasilien rechnen sie bis 2027 mit einer Verfünffachung der Verkäufe, in Indien mit einer Verdreifachung. Indien hat mit Tata und Mahindra zwei heimische Hersteller, die (staatlich gefördert) stark in E-Modelle investieren. In Indonesien ist der Absatz (unterstützt durch Steuervorteile wie in Norwegen) zwischen 2021 und 2023 geradezu explodiert, von unter tausend auf rund 17.000 Stück; worauf BYD und VinFast auch dort den Bau eigener Fabriken ankündigten.
Selbst in Märkten mit bisher niedrigen Anteilen hat ein Wachstum eingesetzt – und stets zeigt sich dabei ein Muster: War erst mal ein Prozent Marktanteil erreicht, beschleunigte sich der Trend und bildete später den Anfang einer S-Kurve. Und weil E-Autos inzwischen billiger und besser sind als früher, verläuft jetzt das Wachstum in vielen Ländern steiler als in den Vorreiterstaaten. In einer Analyse des World Resources Institute heißt es: „Sinkende Kosten und fortgeschrittene Technologien haben es ermöglicht, dass E-Auto-Verkäufe sich inzwischen schneller beschleunigen als in der Vergangenheit.“
Am stärksten profitieren davon chinesische Marken, rund drei Viertel aller weltweit verkauften Elektroautos stammt von ihnen. Dank dieser Übermacht bei den Stromern werden sie wohl bald den gesamten Pkw-Markt dominieren. Derzeit ist etwa jedes fünfte weltweit verkaufte Auto ein chinesisches, 2030 wird es wohl schon jedes dritte sein, schätzt die Unternehmensberatung AlixPartners. In Europa oder den USA dürfte der Vormarsch relativ schwach bleiben, auch wegen dort geltender Einfuhrzölle – im Rest der Welt dafür umso stärker. Auf dem riesigen Heimatmarkt würden chinesische Hersteller – dank ihres Vorsprungs bei E-Autos – Ende des Jahrzehnts einen Marktanteil von 72 Prozent haben, in Russland 69 Prozent, im Nahen Osten und Afrika 39 Prozent, in Asien und Lateinamerika immerhin rund 30 Prozent.
Das Benzinzeitalter überspringen: Äthiopien macht es vor⬆ nach oben
Die Vorteile von Elektromobilität für Schwellen- und Entwicklungsländer hat die Weltbank 2023 in einem Report beleuchtet. Die Technologie sei „zunehmend relevant“ für diese Staaten, längst nicht nur aus Klimagründen. „Der mögliche Nutzen von Elektromobilität für Länder mit niedrigen oder mittleren Einkommen geht weit darüber hinaus.“ Natürlich könne die Technologie bei der Dekarbonisierung helfen, also dabei, sich von fossilen Energieträgern zu verabschieden (oder sich gar nicht erst auf sie einzulassen) – „aber sie hat außerdem das Potenzial, zu verschiedenen anderen Entwicklungszielen beizutragen“.
Doch Autos spielen in vielen Ländern in Asien, Afrika oder Lateinamerika nicht einmal die Hauptrolle. Vielerorts sind Busse oder Kleinbusse, Motorräder und -roller sowie Dreiräder (Tuk-Tuks und Rikschas) viel wichtigere Verkehrsmittel – sie alle gibt es längst auch mit E-Motoren. Und hier sind Zahlen und Zuwachsraten ebenfalls beeindruckend. In Indien und Südwestasien wurden 2023 bereits 1,3 Millionen elektrische Zweiräder verkauft. Bei Dreiradfahrzeugen hatten in jenem Jahr bereits zwanzig Prozent der weltweiten Verkäufe einen E-Antrieb, in Indien waren es sogar schon fast sechzig Prozent.
Auch wenn sie in der Anschaffung noch teurer sein mögen, die Betriebs- und damit die Gesamtkosten von Zwei- und Dreirädern mit E-Antrieb liegen in den meisten Ländern bereits unter denen von Verbrennern. Für ärmere Bevölkerungsteile eröffneten sie überhaupt erst die Möglichkeit auf ein Transportmittel, betont die Weltbank. „In ländlichen Gegenden verringern E-Motorräder kombiniert mit Solarpaneelen die Abhängigkeit von teurem oder schwer erhältlichem Benzin“, die Menschen könnten so zum Beispiel Märkte besser erreichen und höhere Einkommen erzielen.
Zudem verringere Elektromobilität vor allem in Städten die Luftverschmutzung, die weltweit für sieben Millionen Todesfälle pro Jahr verantwortlich ist, so die Weltbank. Außerdem sinke die Abhängigkeit von Ölimporten, und die Produktion werde „demokratisiert“. Weil der Bau von Verbrennerfahrzeugen relativ komplex ist, konzentriert sich die Autoindustrie bisher auf wenige Länder – nur fünf Staaten vereinen sechzig Prozent der weltweiten Produktion auf sich. E-Antriebe hingegen sind viel simpler, die Batterien und andere Bauteile werden immer mehr zu weltweit standardisierten Komponenten, deshalb können Elektroautos an viel mehr Orten der Welt in kleineren Fabriken von viel weniger Menschen und zu günstigeren Kosten gebaut werden. Auf Elektromobilität zu setzen, so das Fazit des Weltbank-Berichts, „ergibt für viele Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen ökonomisch Sinn“.
Menschen in Ruanda: Zahlen die Hälfte, können doppelt so weit fahren⬆ nach oben
Zum Beispiel Ruanda. Auf den Straßen der Hauptstadt Kigali sind Autos und Busse in der Unterzahl, Motorräder dominieren den Verkehr. Viele werden als Taxi genutzt, und Tausende davon fahren bereits mit Strom. Marktführer ist Ampersand, seit 2018 baut das ruandische Unternehmen Motorräder. Über Kigali verteilt hat die Firma Stationen eingerichtet, an denen die Akkus der Motorräder innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden können, längere Ladestopps sind daher unnötig. Bezahlt wird, wie in weiten Teilen Afrikas üblich, per Handyüberweisung. „Früher hat mich mit meinem Benzinmotorrad einmal Volltanken rund 1.000 Franc gekostet“, erzählt Étienne Nkiryhe in einem TV-Interview. „Jetzt zahle ich nur 920 Francs, kann aber doppelt so weit damit fahren.“ Dadurch und wegen der geringeren Reparaturkosten habe er jetzt umgerechnet fünfzig Euro mehr Einkommen im Monat.
Die ruandische Regierung fördert E-Mobilität mit einer „sehr aggressiven Strategie“, so die Weltbank, zum Beispiel gibt es Steuervorteile für Ampersand und ähnliche Firmen und niedrige Stromtarife für Ladestationen. Ampersand boomt. Jüngst hat die Firma eine Partnerschaft mit BYD als Batterielieferant verkündet, der französische Ölmulti Total hat sich in der jüngsten Finanzierungsrunde an der Firma beteiligt.
Oder Äthiopien, das ostafrikanische Land ist mit 130 Millionen Einwohnern fast zehnmal so groß wie Ruanda – und verfolgt eine noch entschlossenere Politik: 2021 kündigte die Regierung an, bis 2030 sollten 150.000 E-Autos und knapp 50.000 E-Busse auf die Straßen kommen und die völlig überalterte Fahrzeugflotte – vor allem importierte Gebrauchtwagen – modernisieren. Das Ziel war bereits nach gut zwei Jahren erreicht. Anfang 2024 dann der Paukenschlag: Als erstes Land weltweit verbot Äthiopien komplett den Import von Benzin- oder Dieselautos. Im Gegenzug erhöhte die Regierung das Ziel für E-Autos auf 440.000 bis Ende des Jahrzehnts – insgesamt gab es im ganzen Land bisher schätzungsweise nur 1,2 Millionen Fahrzeuge.
Parallel zum Verbrennerbann führte die Regierung eine gestaffelte Besteuerung ein, um die lokale Wirtschaft zu fördern: Einzelteile für Elektrofahrzeuge dürfen abgabenfrei importiert werden, für komplette E-Autos hingegen gilt ein Steuersatz von fünfzehn Prozent. Die ersten Fertigungsstätten eröffneten bereits. Die Belayneh Kindie Group zum Beispiel, seit vielen Jahren im Handel und Importgeschäft mit Autos und Lastwagen aktiv, montiert nun selbst Busse und Vans. Die Komponenten dafür kommen aus China.
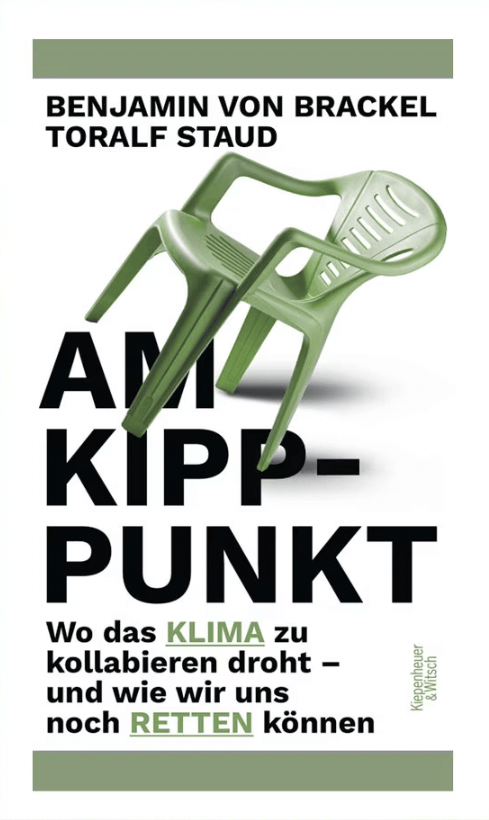
„Am Kipppunkt“ von Toralf Staud und Benjamin von Brackel. Erschienen 2025 bei Kiepenheuer & Witsch. Hier findest du mehr Infos über das Buch.
Als Teil ihrer Förderpolitik will die Regierung mehr als 2.000 Ladestationen im Land errichten. In der Hauptstadt Addis Abeba sollen keine neuen Verbrennermotorräder mehr zugelassen, die städtische Busflotte nach und nach elektrifiziert werden. Voll auf E-Mobilität zu setzen mag radikal wirken, ist bei genauer Betrachtung jedoch sehr rational: Nach Angaben der Regierung gibt das Land pro Jahr umgerechnet fünf bis sechs Milliarden US-Dollar für den Import von Benzin und anderen Erdölprodukten aus. Auf der anderen Seite ist der Strom schon heute fast klimaneutral, gut 95 Prozent stammen aus Wasserkraft, knapp vier Prozent von Windrädern, und das Ausbaupotenzial ist riesig. Wieso also teures und dreckiges Benzin importieren, wenn man sauberen Strom im Überfluss hat?
Im Verkehrsbereich sind Äthiopien und andere Entwicklungsländer gerade dabei, eine Entwicklungsstufe quasi auszulassen – wie im vergangenen Jahrzehnt schon bei einer anderen Technologie. „Für die meisten Menschen in Afrika ging es vom Gar-kein-Telefon-Besitzen direkt ins Handy-Zeitalter, Festnetz-Telefone wurden einfach übersprungen“, sagt Remeredzai Joseph Kuhudzai, der für das Onlineportal CleanTechnica über die Entwicklung Erneuerbarer Energien auf dem Kontinent berichtet. „Angesichts der niedrigen Motorisierungsrate in Äthiopien ist es höchst wahrscheinlich, dass für die meisten Leute ein E-Auto das erste Auto überhaupt ist, das sie besitzen werden. Die Verbrennerära wird schlicht ausgelassen!“
Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Gabriel Schäfer