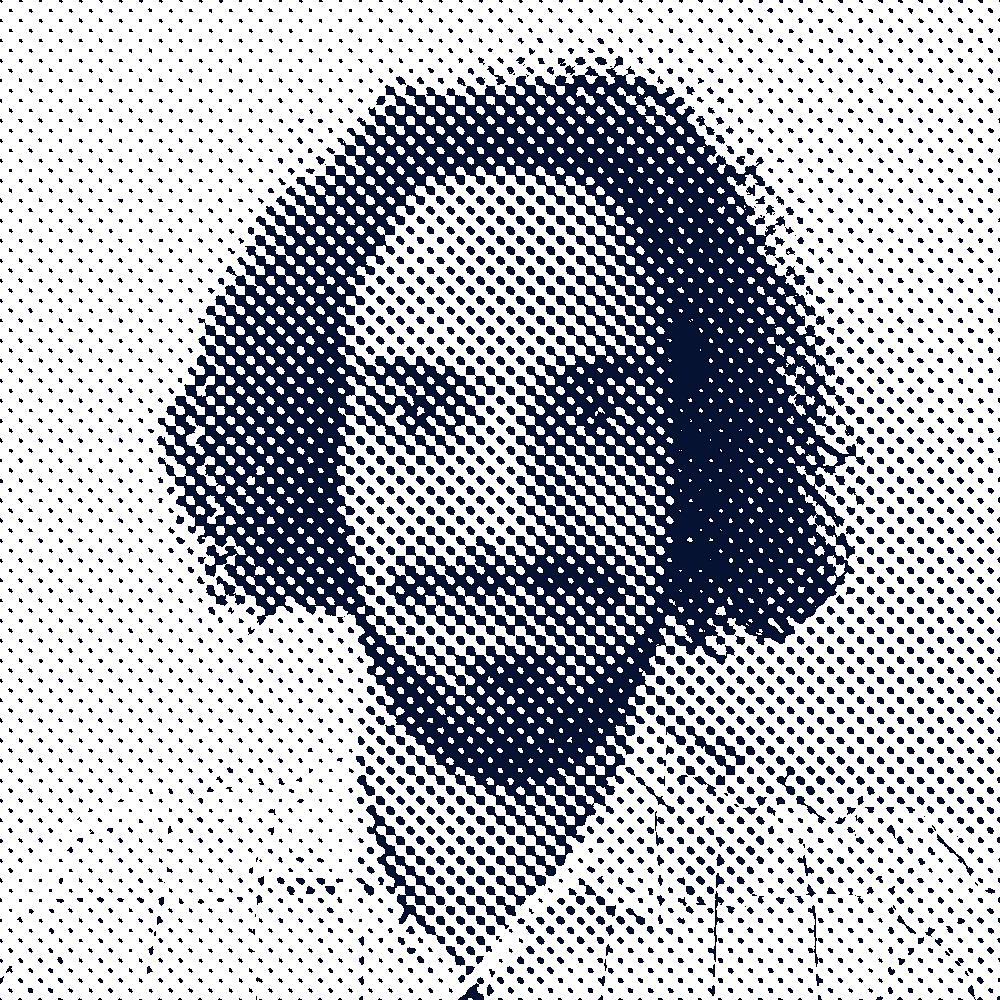Noch wenige Jahre, dann wäre Norfolk das Wasser ausgegangen, da ist sich Umweltwissenschaftler Rob Cunningham sicher. East Anglia, wo Norfolk liegt, ist die trockenste Region Englands. Der lokale Wasserversorger baut zwar gerade Hunderte Kilometer Rohrleitungen, um sich für den Klimawandel und noch mehr Trockenheit zu wappnen. „Aber es gibt keine grauen Infrastrukturlösungen für geringen Durchsatz“, so Cunningham, der für die NGO The Nature Conservancy Norfolks Wasserstrategie mitentwickelt. Das heißt: Rohre, Dämme und Reservoirs bringen wenig, wenn es kein Wasser gibt, das durchfließen könnte.
Norfolk reagiert auf den Wassermangel mit einem europaweit einzigartigen Lösungsansatz. 2021 haben die Kreisverwaltung, der regionale Wasserversorger und The Nature Conservancy einen Wasserfonds gegründet. Das Konzept könnte ein Ausweg aus einem uralten Dilemma sein: Wenn etwas allen gehört, kümmert sich niemand darum. Die ganze Gemeinschaft würde profitieren, wenn jeder ein bisschen zum Erhalt der Wasserressourcen beitragen würde. Aber für den Einzelnen ist es besser, es nicht zu tun.
Durch den Fonds können sich Wasserversorger, Verwaltungen, Unternehmen, Stiftungen und NGOs niedrigschwellig für das Gemeinwohl einsetzen. Cunningham nennt ein Beispiel: „In Norfolk haben wir mit Fonds-Geldern einen Teich angelegt. Der kann Wasser speichern und Verschmutzungen zurückhalten, bevor sie in den Fluss gelangen.“
Der Natur für ihre Dienste Geld geben ist günstiger, als es nicht zu tun⬆ nach oben
Das Geld im Fonds ist wie ein Lohn, den die Natur für das Wasser bekommt, das sie uns gibt. Expert:innen nennen das „Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen“: Die Natur erbringt Dienstleistungen, von denen wir profitieren. Sie stellt Wasser bereit, bestäubt Nutzpflanzen und säubert die Luft. Damit sie ihre Dienste weiter anbieten kann, sollte sie von den Nutzer:innen Geld bekommen, nicht anders als ein Internetprovider oder Friseursalon.
Freilich hat die Natur keine Stimme, geschweige denn eine Kontonummer. Aber die Fondsgelder können Menschen überwiesen werden, die im Interesse der Natur handeln. In Norfolk beispielsweise an The Wendling Beck, ein Renaturierungsprojekt von lokalen Landwirt:innen. Vor wenigen Jahren haben sie noch Zuckerrüben angebaut. Heute errichten sie Feuchtwälder, stellen Niedermoore wieder her und schaffen Habitate.
Diese Flächen mit ihren Tümpeln und Mohnfeldern sind nicht nur schön anzusehen. Sie sind effiziente Infrastruktur, aber eben naturbasiert anstatt aus Beton. Sozusagen im Auftrag der Fonds-Stakeholder:innen speichern und reinigen die Flächen Wasser, verringern Verdunstung und tragen zur Neubildung von Grundwasser bei. Das Beste daran: Naturbasierte Lösungen sind billiger und weniger CO2-intensiv als klassische Reservoirs oder Leitungen.
In Ecuadors Hauptstadt bezahlt sogar Pepsi freiwillig für Wasserschutz⬆ nach oben
Was in Norfolk noch in den Kinderschuhen steckt, ist in Lateinamerika nichts Neues mehr. In der ecuadorianischen Hauptstadt Quito entstand im Jahr 2000 der weltweit erste Wasserfonds FONAG (Fondo para la Protección del Agua). Seitdem konnte FONAG nach eigenen Angaben Zehntausende Hektar der Hochmoorlandschaften schützen, die Quito seitdem nachweislich mit mehr und besserem Trinkwasser versorgen. Aber auch die wirtschaftliche Rendite ist gut: „Für jeden Dollar, der in den Fonds investiert wird, sparen die Wasserwerke 2,15 Dollar bei der Wasseraufbereitung“, erklärt Bert de Bievre, technischer Sekretär bei FONAG.
Ecuador erlebte 2024 seine schlimmste Dürre in über 60 Jahren; im Oktober 2024 gab es in Quito tägliche, bis zu 14 Stunden lange Stromausfälle, weil die Wasserkraftwerke in der Umgebung ausgefallen sind. Quito selbst konnte aber seine Einwohner:innen fast ununterbrochen mit Wasser versorgen – dank des Fonds. „Ohne FONAG wären wir viel schlimmer dran gewesen“, sagt de Bievre. „Wasserprobleme hängen oft stärker mit lokaler Landnutzung zusammen als mit der globalen Erwärmung.“
Am meisten investiert der öffentliche Wasserversorger von Quito in den FONAG. Außerdem beteiligen sich Ecuadors größte Brauerei, eine Pepsi-Tochter und die NGO The Nature Conservancy, die auch dieses Projekt von Beginn an begleitet. Laut de Bievre geht es den Unternehmen mit ihrem Beitrag zum FONAG vor allem darum, ihr Image aufzuhübschen. Einige der inzwischen 26 Wasserfonds in Lateinamerika konnten private Geldgeber wie Getränkehersteller aber auch mit wirtschaftlichen Argumenten überzeugen: Wer Bier brauen oder Cola machen will, braucht dafür schließlich Wasser.
Die EU verschlimmbessert Wasserprobleme⬆ nach oben
Die Beamt:innen der Europäischen Kommission kennen die Projekte in Quito und Ecuador. In der EU gibt es Wasserfonds aber bisher nicht. Auch andere naturbasierte Wasserprojekte stecken noch im Stadium der Ankündigung. Doch die Kommission will den Kampf gegen Wassermangel „ganz oben auf die politische Agenda setzen“, das behauptete sie Anfang Juni 2025 in einem Strategietext. Wie mit Wasser gehaushaltet wird, ist zwar Sache der einzelnen Mitgliedstaaten. Trotzdem hat die Europäische Union großen Einfluss auf die Wassernutzung, etwa durch die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). Die GAP macht den größten Posten im EU-Haushalt aus.
Bisher ist dieser Einfluss nicht nur ein guter. Ein Großteil des GAP-Budgets fließt in Form von Direktzahlungen an Landwirt:innen, die dafür bestimmte Auflagen erfüllen müssen. Verpflichtungen zu einer nachhaltigen Wassernutzung gehen mit den Zahlungen nicht einher; teilweise unterstützt die GAP in trockenen Regionen sogar den Anbau von Pflanzen wie Reis, die besonders viel Wasser brauchen. Laut einer Studie des Europäischen Rechnungshofs fördert die GAP insgesamt also eher eine stärkere als eine effizientere Wassernutzung.
Das Problem ist, dass nachhaltige Wasserpolitik und EU-Landwirtschaftspolitik oftmals im Widerspruch stehen – oder zumindest nicht genug aufeinander abgestimmt sind. Auf der einen Seite will die EU die Wassernutzung optimieren, etwa durch Förderungen für bessere Infrastruktur, digitalisierte Technologien oder Naturschutz. Auf der anderen Seite bezahlen Landwirt:innen in einigen Mitgliedsstaaten so wenig für ihr Wasser, dass oft nicht einmal die Kosten gedeckt sind, die aus der Bereitstellung und Umweltschäden entstehen.
Viele gute Ideen – doch die Umsetzung steht aus⬆ nach oben
Man muss der EU-Kommission zugute halten, dass sie den Wert der Natur zu begreifen beginnt. In einem von Präsidentin Ursula von der Leyen und Umweltkommissarin Jessika Roswall unterzeichneten Meinungsbeitrag von Anfang Juli heißt es: „Es ist an der Zeit, die Natur in der Bilanz zu berücksichtigen. Sie als Wert anzuerkennen und in sie zu investieren. Es zahlt sich aus, jetzt und später.“
Passend dazu will die EU zukünftig mehr Anreize für private Investoren schaffen, in Schutz und Erhaltung der Natur zu investieren und zwar in Form von sogenannten Nature Credits. Wer beispielsweise ein Feuchtgebiet wiederherstellt, also eine messbare Naturschutzleistung erbringt, soll dafür weiterverkaufbare Credits erhalten.
Die praktische Umsetzung des Programms steht aber noch aus. Ebenso ist unklar, ob die Nature Credits nicht an denselben Problemen kranken werden wie freiwillige CO2-Kompensation, deren Sinnhaftigkeit umstritten ist.
Auch in Norfolk bleiben viele Fragen offen, das muss Rob Cunningham zugeben. Der erste Wasserfonds in Europa ist ein Experiment. Aber immerhin hat der Wasserversorger seit dem Start schon 11 Millionen Pfund (12,7 Millionen Euro) investiert. Als Nächstes will das Team um Cunningham auch private Investoren überzeugen einzuzahlen.
Stolze 6,70 Britische Pfund an Benefits möchte der Fonds in Norfolk für jedes in die Natur investierte Pfund generieren. Sollte diese Rechnung aufgehen, bestätigt sich damit: Umweltschutz kann eine wasserdichte Investition sein.
Redaktion: Rico Grimm, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Philipp Sipos; Audioversion: Iris Hochberger