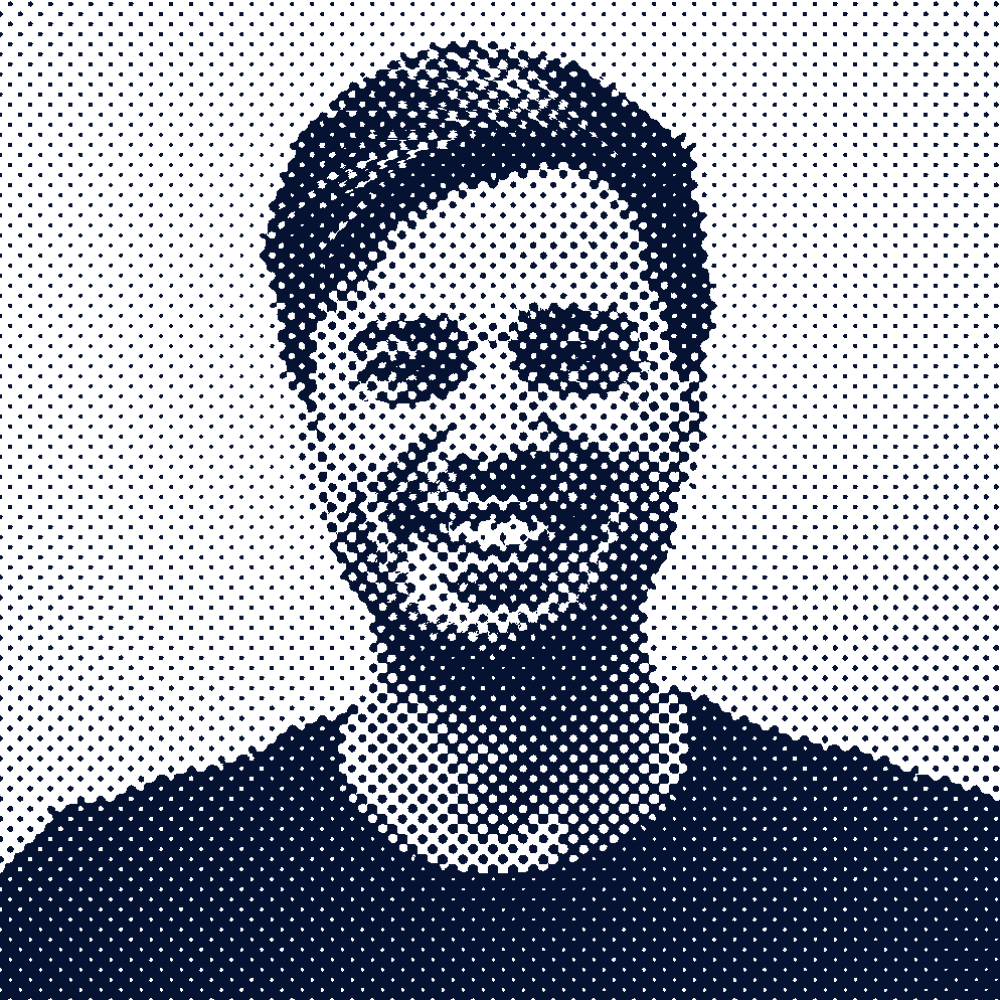Auf allen politischen Ebenen hat ein klimapolitischer Rollback begonnen. Die Ziele, die sich viele Mächtige während der Fridays-for-Future-Jahre auf Druck ihrer Söhne und Töchter gaben, werden aufgeweicht oder ganz beiseite gewischt.
Der Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union hatte bereits deutlich gemacht, dass die neue Regierung die Energiewende eher ausbremsen, als beschleunigen will. Aber die neue Energieministerin Katherina Reiche von der CDU ging in ihren ersten Reden und Interviews noch weiter.
Sie sprach davon, den „Wärmepumpenzwang“ abschaffen zu wollen (den es nicht gibt). Sie warf ihrem Vorgänger im Amt, Robert Habeck (Grüne) vor, den Klimaschutz „fast überbetont“ zu haben. Deswegen sei es jetzt Zeit „für einen Realitätscheck“, so Reiche.
Ihr Parteikollege, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, hat nun gegenüber der Wirtschaftswoche gefordert, die Klimaziele aufzuweichen. Deutschland solle erst 2050 klimaneutral werden – fünf Jahre später als bisher. Die Äußerungen aus den Ländern finden ein Echo in Brüssel. Dort hält die EU zwar noch am Verbrennerverbot fest, aber auch hier machen die Konservativen Druck: Das sogenannte Verbrennerverbot wackelt. Genauso wie die großen verbindlichen Klimaziele der EU. Denn bisher hätte die EU aus eigener Kraft ihre Emissionen reduzieren müssen. Fortan soll es möglich sein, diese Emissionen außerhalb Europas über CO₂-Zertifikate auszugleichen.
Noch vor wenigen Monaten war diese Klima-Konterrevolution nur zu erahnen. Jetzt wird sie konkret. Vor allem die konservativen Mitte-Parteien führen sie an. Ihnen geht es nach eigener Aussage dabei vor allem um Europas Wettbewerbsfähigkeit.
Aber die Welt hat sich verändert, seit die CDU vor gar nicht langer Zeit das letzte Mal regiert hat. Inzwischen ist der Ausbau erneuerbarer Energie nicht mehr nur eine Frage des Klimaschutzes, sondern auch seriöser Industrie- und Wirtschaftspolitik.
Denn längst hat ein globales Wettrennen um die Zukunft begonnen. Dabei gibt es eine grundlegende Regel: Wer schneller elektrifiziert, gewinnt. Deutschland braucht also die Energiewende, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Das neue Industrie-Wettrennen hat begonnen – und Deutschland gerät ins Hintertreffen⬆ nach oben
Die Schlüsselqualifikation für das 21. Jahrhundert ist es, Strom in großen Mengen herzustellen, zu verteilen und klug zu nutzen. Das ist so wichtig, wie es der Abbau von Kohle, die Raffinierung von Öl und die Verteilung von Gas im 20. Jahrhundert war.
Ein Beispiel: Künstliche Intelligenz braucht Rechenzentren, die energieintensiv sind. Alle Regierungen wissen, dass KI wichtig ist, aber nicht alle Regierungen können auf große heimische Öl- und Gasvorkommen wie die USA zurückgreifen, um sie anzutreiben. Viele Länder müssen deshalb Geld ins Ausland überweisen, Deutschland etwa zahlt jedes Jahr 76 Milliarden Euro allein für Öl und Gas an Länder wie Saudi-Arabien. Wenn ein Land, zweites Beispiel, seinen Verkehr komplett elektrifiziert und mit Strom aus Sonne und Wind antreibt, muss es das nicht mehr. Und, drittes Beispiel, nur wer die Batterien in den E-Autos komplett selbst herstellen kann, sammelt wichtige Erfahrungen, um später auch andere Maschinen zu elektrifizieren, die die Zukunft mitprägen könnten: Roboter zum Beispiel.
Unter Experten ist klar, dass China in diesem Wettrennen meilenweit vorn liegt. Das Land baut seit fünf Jahren Wind- und Solarkraft in rasantem Tempo aus, elektrifiziert seine Verkehrsflotte und kontrolliert große Teile des weltweiten Marktes für Batterien. China wird zum ersten „Elektrostaat“ der Geschichte, schrieb die britische Zeitung Financial Times kürzlich.
Und auch die Europäer hatten die strategische Bedeutung der Energiewende eigentlich längst erkannt. Seit dem Green New Deal träumt die EU-Kommission davon, die Technologien hinter sauberer Energie, Kreislaufwirtschaft und Wasserstoff in aller Welt zu verkaufen. Seit der Gaskrise nach dem Ukraine-Krieg geistert zudem das Stichwort der „Resilienz“, der Widerstandskraft, durch Brüssel. Europa will sich aus fossilen Abhängigkeiten lösen. Nie wieder soll ein Diktator wie Russlands Präsident Putin den ganzen Kontinent in Geiselhaft nehmen können.
Die Energiewende ist also längst mehr als ein klimapolitisches Projekt. Sie hat eine geo- und industriepolitische Dimension. Trotzdem wirkt es gerade wahrscheinlich, dass Deutschland die Energiewende abwickelt. Bei den vier entscheidenden energiepolitischen Fragen gibt die neue Energieministerin Katherina Reiche nur Antworten, die zurückweisen statt nach vorn:
1. Die Kraftwerksfrage: Wer sichert die Stromversorgung, wenn Wind und Sonne ausfallen?⬆ nach oben
Katherina Reiche möchte in den kommenden Jahren 40 bis 50 neue Gaskraftwerke mit einer gesamten Leistung von 20 Gigawatt bauen lassen, so viele wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik.
Deutschland braucht durch den Umstieg auf erneuerbare Energien Reservekapazitäten, um Dunkelflauten zu überstehen. Momentan gleichen Kohlekraftwerke aus, wenn keine Sonne scheint, aber die sollen in den kommenden Jahren abgeschaltet werden. Diese Reservekapazität muss, wie Analysen der Bundesnetzagentur gezeigt haben, mindestens 20 Gigawatt betragen.
Allerdings haben die Analysen nicht gezeigt, dass 20 Gigawatt exklusiv durch Gaskraft bereitgestellt werden müssen. Das ist eine politische Entscheidung. Schwarz-Rot und Reiche könnten auch darauf dringen, so wenige Gaskraftwerke wie möglich, so viele wie nötig zu bauen.
Die zentrale Herausforderung ist dabei, den rasanten Zubau von Wind- und Solarkraft besser ins Stromnetz zu integrieren. Dazu müsste sich Reiche allerdings offen zur Energiewende bekennen und sie ähnlich wie ihr Vorgänger Robert Habeck, zur Chefsache erklären.
Die Regierung hat angekündigt, dass die Kraftwerke später klimaneutral laufen können, entweder weil sie grünen Wasserstoff verbrennen oder weil das ausgeschiedene CO₂ aufgefangen wird. Aber es gibt erhebliche Zweifel, ob das klappen kann. Es gibt nicht genug grünen Wasserstoff und der sogenannten CO₂-Abscheidung erteilen die Kraftwerksbetreiber selbst eine Absage. Sie sei viel zu teuer.
Die geplanten Gaskraftwerke sind nicht nur aus klimapolitischer Sicht schwierig. So ist es heute deutlich teurer, neue Gaskraftwerke zu bauen, als noch vor ein paar Jahren. Vor allem die Preise für Gasturbinen sind explodiert.
Selbst der industrienahe Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) möchte von diesem Plan nichts wissen. Er fürchtet Verzögerungen und fordert die neue Regierung auf, einfach die Pläne der Ampel umzusetzen, die weniger Gaskraftwerke vorsahen.
2. Die Heizungsfrage: Droht Deutschland ein teurer Rückschritt?⬆ nach oben
2023 reformierte die Ampelregierung die Gesetze zum Heizen. Sie beschloss, dass nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die zu mehr als 65 Prozent mit erneuerbarer Energie laufen können. Diese Vorgabe flankierte sie mit großzügigen Förderungen für die neuen Anlagen.
Die CDU machte damit Wahlkampf, dieses sogenannte „Heizungsgesetz abschaffen“ zu wollen. Aber was die Union anders als die Ampel machen will, bleibt bis auf nebensächliche Details unklar.
Sollte die neue Regierung das alte Heizungsgesetz entkernen, wäre auch das ein Rückschritt ins fossile Zeitalter. Außerdem wird das vor allem für all jene Firmen zum Problem, die auf die Politik vertraut haben und mit der Wärmepumpe planen. Gleich 13 Branchenverbände beknien die neue Ministerin, nicht mental ins Jahr 1990 zurückzukehren und weiterhin Wärmepumpen zu fördern. Reiche müsse die Politik der Ampel fortführen. Mehr Wärmepumpen, nicht weniger.
3. Der Preisschock: Was passiert, wenn ab 2027 fossile Energie deutlich teurer wird?⬆ nach oben
Ab spätestens 2028 soll europaweit der sogenannte Emissionshandel greifen, mit dem fossiles Heizen und fossile Mobilität sprunghaft teurer werden. Ab dann muss für jedes Kilogramm CO₂ ein Zertifikat erworben werden. Als die ersten dieser Zertifikate vor ein paar Wochen gehandelt wurden, zeigte sich, dass sie Öl und Gas deutlich verteuern werden. Ein Liter Benzin würde dann 18 Cent mehr kosten. Diese Steigerungen sind aber nur der Anfang, da sind sich die Experten einig. Denn die Zahl der Zertifikate wird perspektivisch kleiner, der Preis immer teurer.
Hat Reiche einen Plan, um diese Preisanstiege kommunikativ vorzubereiten und praktisch abzufedern?
Nachdem die Preise für fossile Brennstoffe im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Frühjahr 2022 sprunghaft angestiegen waren, beschloss die Ampelregierung Preisbremsen und Tankrabatte. So groß war der politische Druck. Zudem war auch das Heizungsgesetz, das die Ampel reformierte, eine Reaktion auf diesen Emissionshandel. Sie wollte vermeiden, dass die Heizer in teure Kostenfallen rennen.
Was will Schwarz-Rot? Unklar.
4. Das Strompreisparadox: Warum sind hohe Strompreise ein Problem, während immer wieder Strom verschenkt wird?⬆ nach oben
Deutschland hat Unmengen billige saubere Energie und niemand ist zufrieden damit. In den sonnenreichen Monaten produzieren die Solaranlagen häufig so viel Strom, dass die Preise an der Börse ins Negative gehen. Das heißt, es wird bezahlt, wer Strom abnimmt.
Diese Situation muss sich ändern, da sind sich alle einig. Aber wie genau die neue Regierung reagiert, wird entscheidend sein. Sie könnte den Solarzubau mit aller Kraft bremsen, Anlagen zwangsabschalten oder die Energiewende vertiefen und mehr Speicher, intelligentere Netze und sogenannten netzdienlichen Stromverbrauch fördern.
Eine Richtungsentscheidung steht an und sowohl der Koalitionsvertrag als auch Reiches bisherige Äußerungen deuten darauf hin, dass sie die Energiewende lieber abwürgt, als zu vertiefen. Denn im Koalitionsvertrag heißt es, dass Erneuerbare nicht schneller ausgebaut werden dürften als die Netze. Diese Ansage wiederholte Reiche nochmal gegenüber dem Handelsblatt. Da die Netze nur sehr langsam ausgebaut werden, kommt das einer großen Erneuerbaren-Bremse gleich.
Diese vier Entscheidungen erfordern eine klare Strategie. Will Deutschland rumwursteln oder auch Elektrostaat wie China werden?
Reiche hat als ehemalige Stadtwerke-Lobbyistin und Managerin des Energieriesen E.ON eigentlich die nötige Expertise, um die Tragweite ihrer Entscheidungen zu ermessen. Aber die neue Energieministerin sendet bisher vor allem verwirrende Signale, die in der Industrie und in der Zivilgesellschaft auf Kritik stoßen.
Einzig Reiches alter Arbeitgeber E.ON und der Energieriese RWE dürften mit Wohlwollen auf die Pläne schauen. Denn beide Unternehmen hatten in einem Positionspapier vor dem Antritt der neuen Regierung bereits gemahnt, dass die Energiewende zu teuer werde und der Ausbau der Erneuerbaren gebremst werden müsse.
Um diese Position besser einzuordnen, hilft ein wichtiges Detail. Würde Deutschland tatsächlich Dutzende neue Gaskraftwerke bauen, würde davon vor allem eine Firma profitieren: RWE.
Redaktion: Rebecca Kelber, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert