Als Mitglied hast du Zugriff auf diesen Artikel.
Ein Krautreporter-Mitglied schenkt dir diesen Artikel.
ist Krautreporter-Mitglied und schenkt dir diesen Artikel.
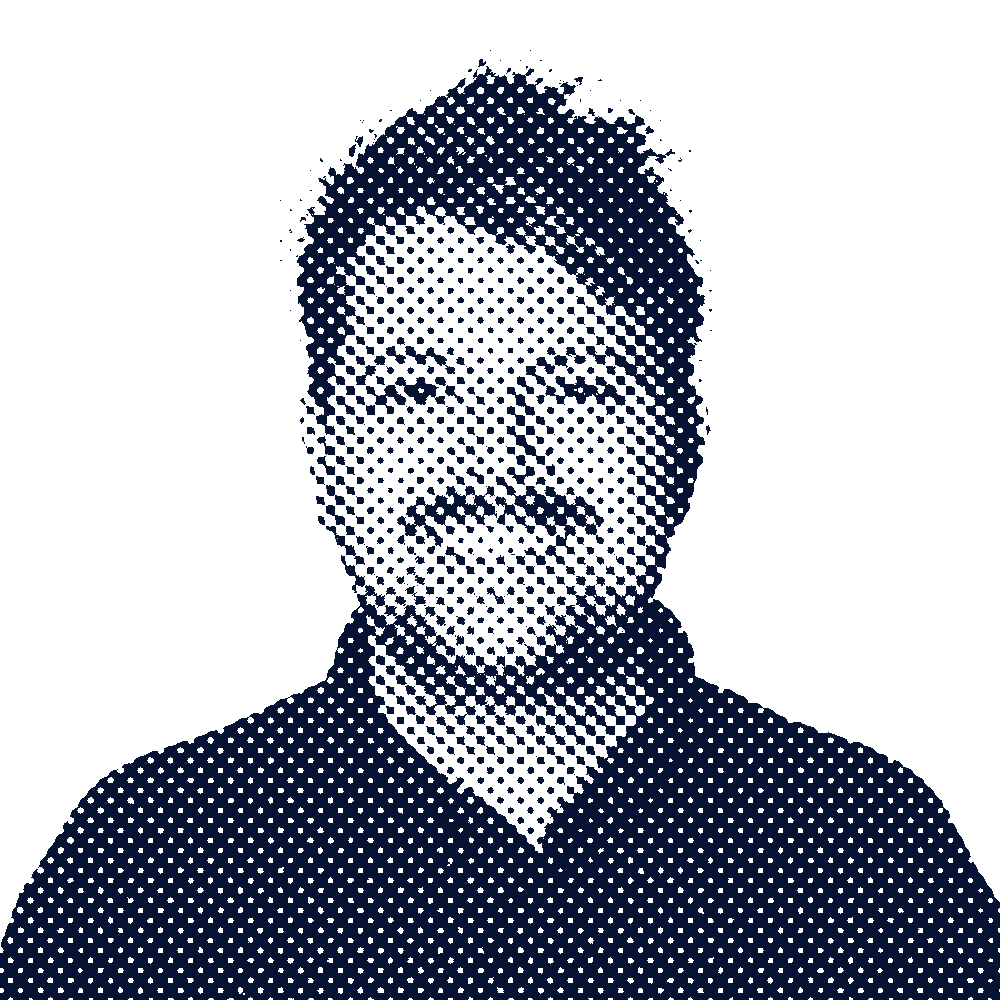
Ein Junge schleicht an seiner kleinen Schwester vorbei, barfuß zum grau-matten Mercedes seines Vaters. Er sagt: „Papa muss ich aufwecken.“ Der Wagen steht auf der Auffahrt, die Scheiben sind beschlagen, der Junge drückt seinen Kopf dagegen, seine Hände dunkeln links und rechts das Sichtfeld ab, damit er hineingucken kann. Da liegt sein Vater. Er hat die Nacht im Auto gepennt. Seine Frau klopft gegen die Scheiben. Sagt: „Halloo. Sag mal, geht´s eigentlich noch?“
Der Vater kommt raus, ins Haus, kann kaum alleine stehen. Seine Frau trägt Koffer durchs Haus, die Familie will in den Urlaub fliegen. In ein paar Stunden geht der Flieger.
In der Küche stützt sich der Familienvater auf der Kücheninsel ab, mit beiden Armen. Dazwischen sitzt jetzt sein Sohn, auf seinen Schultern der schwere Kopf seines völlig zugedröhnten Papas.
Der Familienvater, um den es hier geht, heißt Aykut Anhan. Millionen Menschen kennen ihn als den Rapper Haftbefehl. Er ist einer der, wenn nicht der erfolgreichste Deutschrapper der letzten zehn Jahre, hat unzählige Preise gewonnen. Nahezu alle Jugendlichen (und Ex-Jugendlichen) kennen seine Lines: Chabos wissen, wer der Babo ist.

Der Rapper kann kaum noch stehen, als er seinen Sohn umarmt. Die Verpixelung des Jungen stammt von uns. | Netflix.
Auf Netflix erschien vor ein paar Tagen eine Doku über sein Leben. Oder eher: über seinen Zerfall. Denn nach seinem Aufstieg (aus dem Offenbacher Plattenbau auf die größten Bühnen der Republik) kokste er sich mehrfach fast bis in den Tod.
Die Dokumentarfilmer durften für „Babo - Die Haftbefehl-Story“ überall dabei sein. Auch seine Tochter und sein Sohn tauchen immer wieder auf, unverpixelt. Nur: Was es mit ihnen macht, dass ihr Vater nicht nur kaum da ist, sondern auch noch regelmäßig zugekokst zuhause rumgeistert, spielt in der Doku keine Rolle. Haftbefehl selbst sagt, er liebe seine Kinder. Aber auch: „Ich bin ein schlechter Vater. Ich bin Dreck.“
Mehr als drei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland haben laut Bundesgesundheitsministerium mindestens eine suchtkranke Mutter oder einen suchtkranken Vater. Das heißt: Etwa jedes fünfte Kind lebt in einer Familie mit Suchtproblemen. Jedes fünfte. Was zur Hölle? Ehrlich: Ich wusste das nicht.
In der Doku kommt das persönliche Umfeld von Haftbefehl zu Wort. Seine Frau spricht offen über ihre Beziehung. Sie wisse nicht mehr weiter. Habe sich bereits getrennt, ihm auch schon die Kinder entzogen. Es half alles nichts. Das Koks bestimmt über sein Leben. Aber auch sie: Kein Satz dazu, dass hier zwei Kinder mit einem Vater aufwachsen, der täglich Drogen missbraucht.
Dabei erzählt die Doku eigentlich die Geschichte von zwei Kindheiten. Nein, sie erzählt die eine Kindheit, die von Haftbefehl selbst. Und sie zeigt die seiner Kinder. Die Parallelen sind frappierend. Haftbefehl selbst wuchs als mittlerer von drei Brüdern in einer kleinen Wohnung im siebten Stock eines Plattenbaus in Offenbach auf. Sein Vater hatte immer viel Geld, nur nie lange.
Der Vater von Haftbefehl war spielsüchtig, verzockte alles, was reinkam am nächsten Tag wieder. Der Vater wurde depressiv, nahm Drogen. Eines Tages, als Haftbefehl 13 Jahre alt war, kam er nach Hause, hörte jemanden ersticken, und sah, wie sein Vater versuchte, sich mit einem Schal umzubringen. Er stoppte ihn, saß die komplette Nacht vor dem Zimmer, aus Angst, sein Vater würde sterben. Im Jahr darauf suizidierte der Vater sich schließlich.
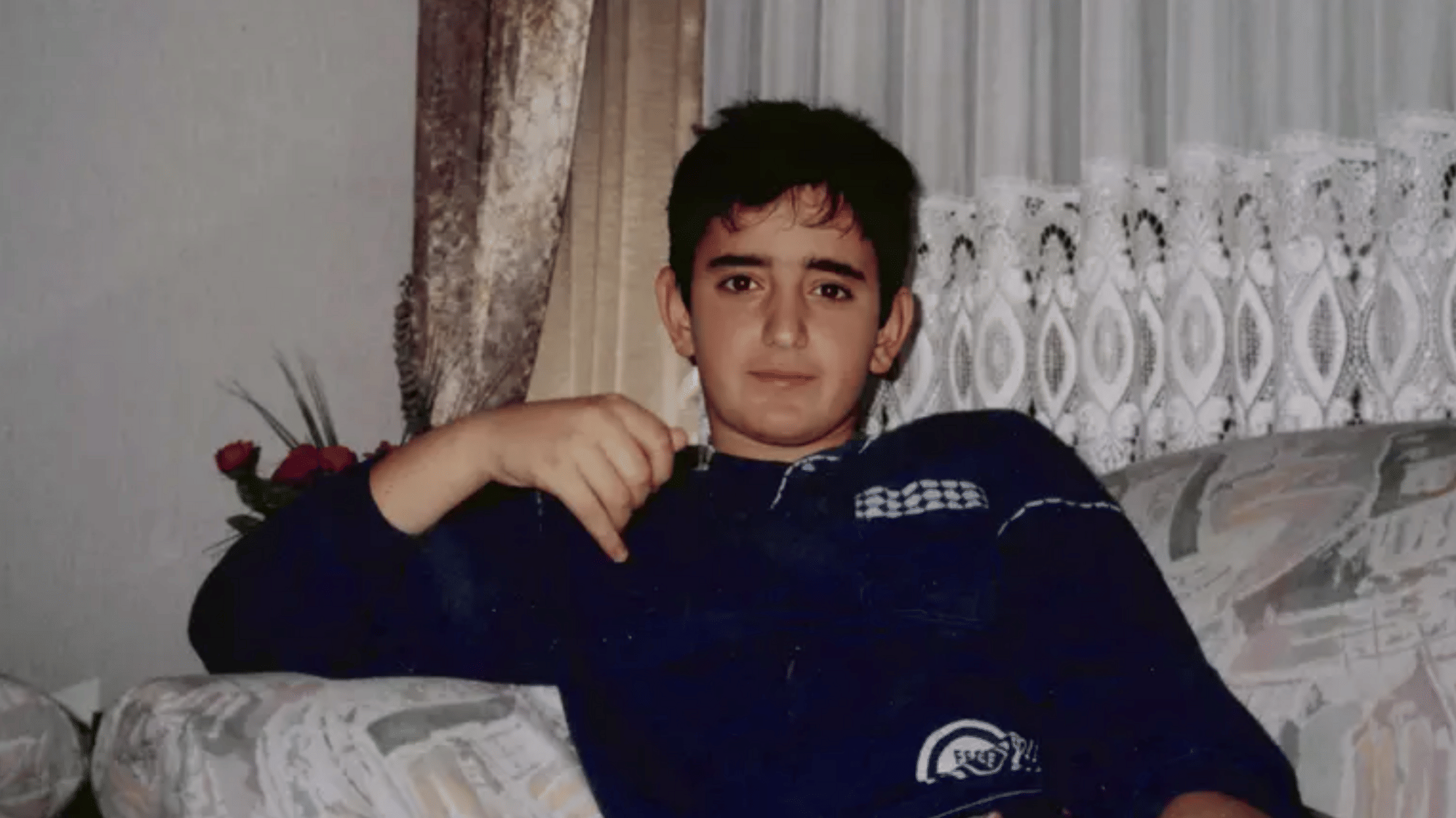
Der Rapper Haftbefehl als Kind.
Mit 13 begann der Rapper zu koksen und hörte über 25 Jahre lang nicht damit auf. 2024 musste er nach einer Überdosis Koks reanimiert werden. Als er in der Notaufnahme erwachte, riss er sich los – um weiter zu koksen. Seine Kinder sind heute einige Jahre jünger als der Rapper es war, als sein Vater erst fast und schließlich starb.
Die Geschichte wiederholt sich, nicht eins zu eins, natürlich nicht, aber: Sie wiederholt sich. Es ist das eigentliche Thema der Doku, finde ich: Wie ein Trauma von einer zur nächsten Generation weitergegeben wird. Es ist so offensichtlich, aber niemand spricht es in der Doku aus. So wirkt es fast wie eine Zwangsläufigkeit, als würde niemand die Verantwortung tragen für das, was passiert.
Kinder, deren Eltern drogenabhängig sind, bekommen oftmals nicht die emotionale Zuwendung, die sie brauchen. Sie erfahren öfter Gewalt, werden öfter missbraucht. Die Kinder von Haftbefehl bekommen Zuwendung, sie wachsen vergleichsweise geborgen in einem Haus bei Stuttgart auf, weil die Mutter sich für sie zerreißt.
Trotzdem: Kinder, deren Eltern drogenabhängig sind, haben ein hohes Risiko, später selbst abhängig zu werden. Wie hoch? Das können Expert:innen nur schätzen: etwa ein Drittel dieser Kinder entwickelt vermutlich Süchte, ein weiteres Drittel psychische oder soziale Störungen. Natürlich habe ich mir nach der Doku gewünscht, dass Haftbefehl langfristig dem Drogensog entkommt. Aber noch viel mehr wünsche ich seinen Kindern, dass sie es irgendwie schaffen, gar nicht erst hinein zu geraten. Dass die Weitergabe dieser Geschichte eben keine Zwangsläufigkeit ist.
Was wir diese Woche gucken⬆ nach oben
Um das Wohl der Kinder geht es in der Doku nicht, ihr Leid wird ausgestellt, angedeutet, fast unkommentiert hingenommen. Neben dem Leid von Haftbefehl ist dafür kein Platz mehr. Deshalb drehen sich unsere Lese- und Gucktipps heute um Berichte, die die Perspektive der Kinder suchtkranker Eltern thematisieren:
🎥 In der Doku „Vergiftete Kindheit: Wenn Alkohol Familien belastet“ begleitet das ZDF drei erwachsene Kinder aus suchtkranken Familien. Tanja, Mandy und Nicolas reden darüber, wie sie heute noch darunter leiden.
🎥 In dieser zehnminütigen ARD-Doku kommen die Kinder suchtkranker Eltern selbst zu Wort, nicht erst als Erwachsene, sondern noch während ihrer Kindheit.
🎞️ Und der 30-minütige Kurzfilm „Erinnerungen einer vergessenen Kindheit“ zeigt den 11-jährigen Niklas, der mit einer alkoholkranken Mutter und einem spielsüchtigen Vater aufwächst und zwischen Pflichtgefühl und dem Drang zu fliehen zerrieben wird. Aus der konsequenten Kinderperspektive macht der Film das oft verborgene Leid und die Loyalitätskonflikte von Kindern in suchtbelasteten Familien sichtbar. Es gibt auch eine Seite zur Suchtprävention rund um den Film.
Redaktion und Schlussredaktion: Lea Schönborn.