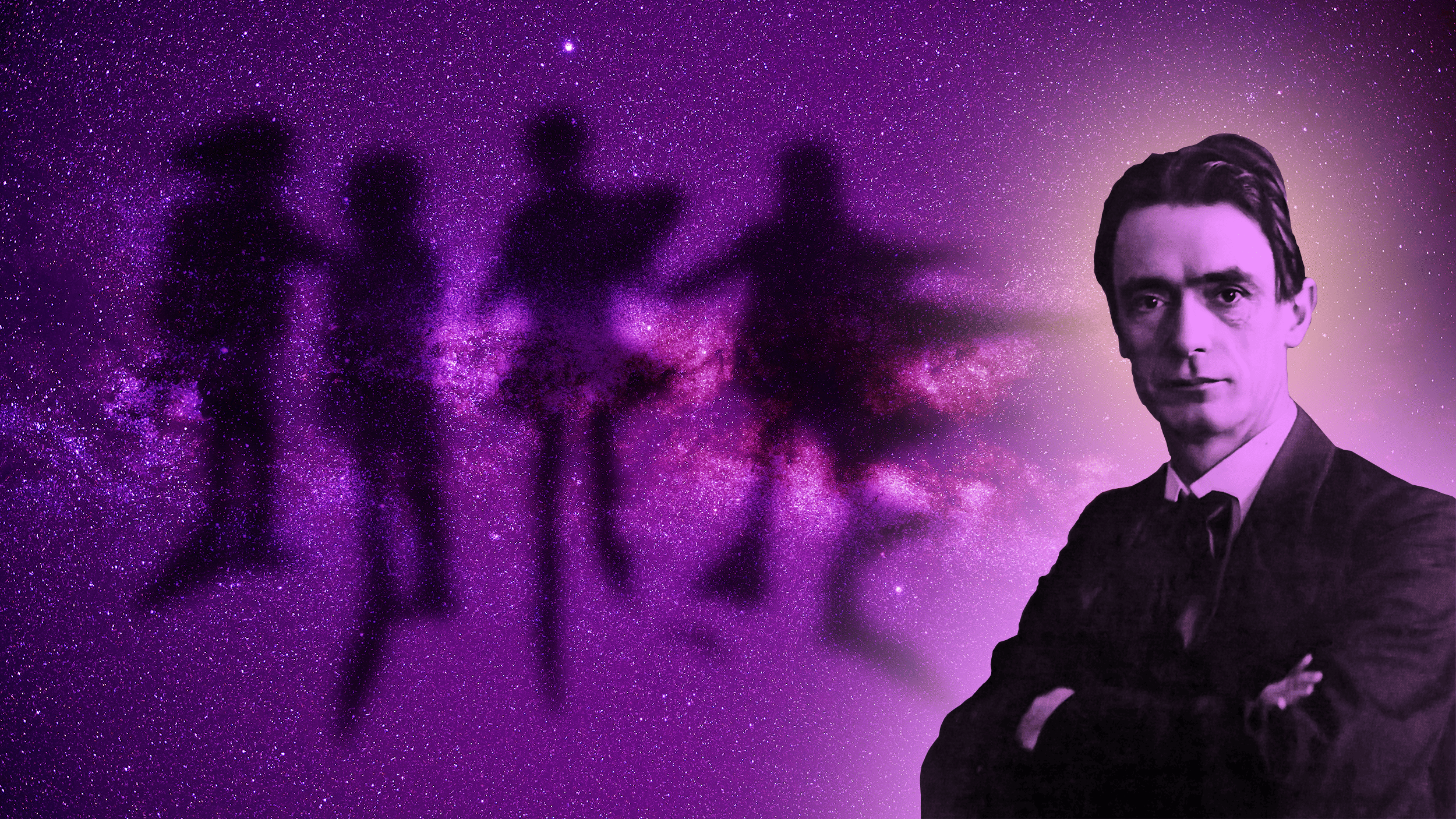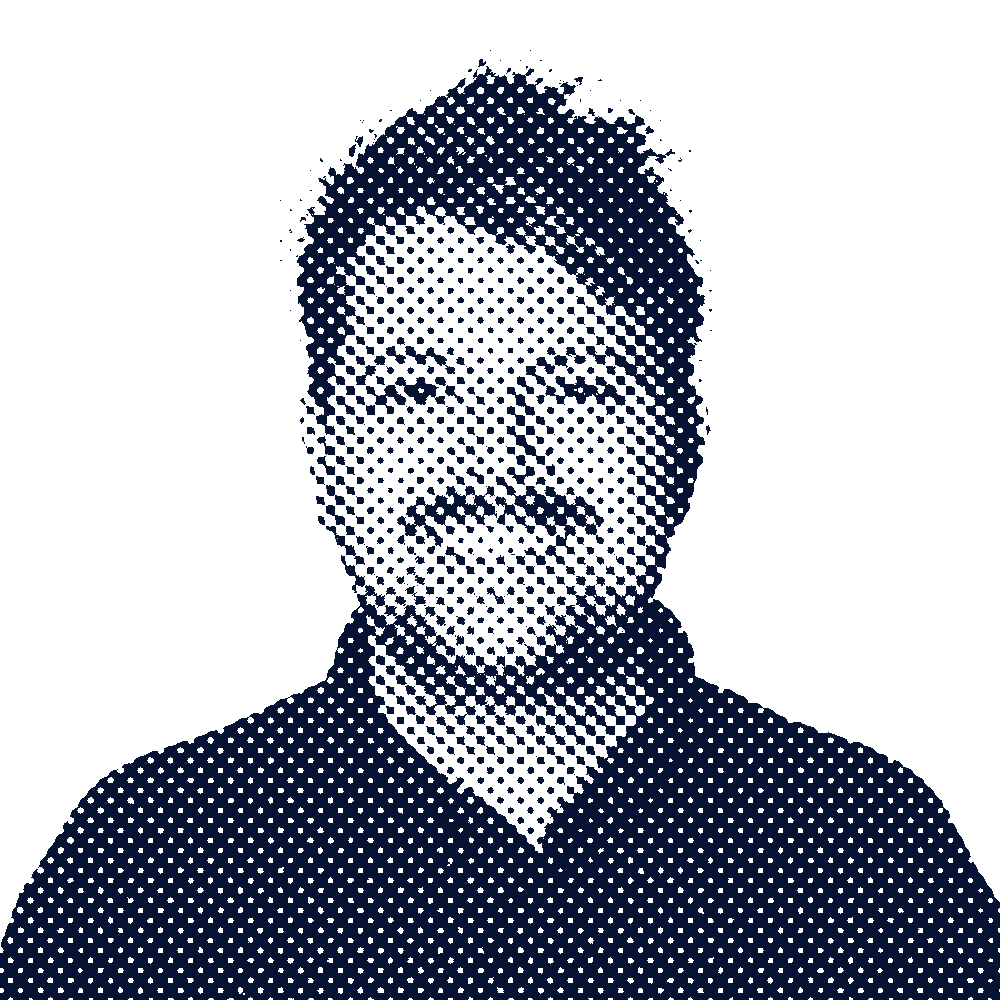Als die Freie Waldorfschule Überlingen im Oktober 2022 ein Fest feiert, entdecken die Besucher:innen ein Foto, das sie sehr aufregt. Die Schule am nördlichen Ufer des Bodensees feiert ihren 50. Jahrestag, zur Feier kommen Eltern, Kinder und ehemalige Schüler:innen. In einer Ausstellung über die Geschichte der Schule sehen sie ein Foto des ehemaligen Lehrers Konrad Z. Ein Elternteil, dessen Kinder die Schule noch heute besuchen, fordert die Schule auf, das Foto sofort zu entfernen.
Konrad Z. wurde 1994 dafür verurteilt, einem Zwillingspaar in die Unterhose gegriffen und die Genitalien der Kinder berührt zu haben. Darüber hinaus soll Z. einen Schüler aus dem Fenster im Erdgeschoss und mindestens zwei Schüler über Tische und Bänke geworfen haben. Er soll einen Schüler über dem Knie vor der ganzen Klasse verprügelt und Schüler:innen auf die Hände geschlagen haben, wobei er manchmal Reißzwecken oder Nadeln zwischen seine Finger geklemmt haben soll. Dafür soll Z. Schüler:innen in einer Reihe aufgestellt haben, um sie nacheinander zu bestrafen. Er soll regelmäßig laut rumgeschrien, Mädchen ihre Zöpfe abgeschnitten und Kindern befohlen haben, sich in den Papierkorb zu stellen, damit sie sich„als Müll fühlen“. Für all das wurde Z. nicht verurteilt.
Bei der Jubiläumsfeier der Schule stellt sich heraus: Seine Taten wurden nie aufgearbeitet. Die Waldorfschule Überlingen lädt die ehemaligen Schüler:innen, die von 1990 bis 1993 von Konrad Z. unterrichtet wurden, deshalb zu einem Treffen ein. Der Austausch im Mai 2023 zeigt schnell: Der Unterricht von Konrad Z. war brutal und unberechenbar. Seine damaligen Schüler:innen waren ihm jahrelang schutzlos ausgesetzt.
Die Schulleitung und die ehemaligen Schüler:innen einigten sich darauf, die Vorgänge wissenschaftlich rekonstruieren zu lassen und beauftragten das Institut für Praxisforschung und Projektberatung (IPP) in München, das auf das Thema Gewalt gegen Kinder und Jugendliche spezialisiert ist. Die Wissenschaftler:innen führten 42 Interviews mit 38 Personen, analysierten Protokolle von Schulkonferenzen und die Inhalte der Personalakte von Konrad. Z., Gerichtsunterlagen, schulinterne und externe Korrespondenzen, wie etwa Presseerklärungen, und behördliche Dokumente, um ein Bild der Vorfälle zu zeichnen. Die Studie ist mehr als 200 Seiten lang und liefert erstmals eine ausführliche wissenschaftliche Aufarbeitung eines Missbrauchsfalles an einer deutschen Waldorfschule.
Im November 2022 hatten wir gemeinsam mit dem ZDF Magazin Royale zu Waldorfschulen recherchiert. Damals schrieben wir in einem unserer Artikel: „Unsere Recherche zeigt: Das System Waldorfschule kann es Täter:innen offenbar erleichtern, unentdeckt zu bleiben.“ Diejenigen, die Waldorfschulen verteidigten, schockierte das. Sie warfen uns vor, dass solche Taten genauso auch an jeder öffentlichen Schule vorkommen können.
Die Studie zu Konrad Z. stellt nun erneut die Systemfrage. Und sie macht deutlich: So ein Fall hätte wahrscheinlich nicht an jeder anderen öffentlichen Schule genauso passieren können. Die Eigenheiten des Systems Waldorf haben die Tat begünstigt. Vier strukturelle Probleme stechen dabei heraus.
1. Viele Waldorfschulen sind ein geschlossenes System⬆ nach oben
Im Dezember 1993 berichtete ein Zwillingspaar von sexualisierten Übergriffen gegen sie. Konrad Z. griff in die Hose der Kinder und berührte ihre Genitalien. Nachdem die Mutter des Zwillingspaares die Anschuldigungen öffentlich gemacht hatte, erhielt sie Morddrohungen. Eltern warfen ihr vor, den sexuellen Missbrauch an ihren Kindern „an die große Glocke gehängt“ und dadurch die Existenz des Familienvaters Konrad Z. gefährdet zu haben. Sie wurde unter Druck gesetzt, Konrad Z. nicht anzuzeigen. Nachdem der Fall aufgedeckt worden war, wurde sie damit bedroht, dass ihre Tochter entführt und ermordet werden könnte. Von wem die Drohungen stammen, ist bis heute nicht bekannt. Weil der Druck der Eltern nicht nachließ und sich Konrad Z. weiterhin in der Nähe der Schule aufgehalten hat, zog die Familie schließlich weg. Das geht aus Gerichtsunterlagen und Akten hervor, die die Studienautor:innen eingesehen haben.
Die Waldorfschule Überlingen funktionierte als Teil eines stark geschlossenen anthroposophischen Netzwerks. Schüler:innen beschrieben die Schule rückblickend als „Esoterik-Blase“. Dieses Umfeld, zu dem auch ein Demeterhof, Arztpraxen und das gegenüberliegende Altersheim gehörten, grenzte sich von der „Außenwelt“ ab. Die Menschen in diesem System fühlten sich als Gemeinschaft, mit einer gemeinsamen Identität. Es führte jedoch auch dazu, dass es keine kritische Selbstreflexion gab und Gewalt nicht thematisiert wurde. Die Schüler:innen und Lehrkräfte lebten „in einer anthroposophischen Märchenwelt“, wie die Studie eine Person zitiert, die damals die Schule besucht hat.
Die enge soziale Verflechtung, geprägt von Freundschaften, Loyalitäten und einer positiven Grundhaltung gegenüber der Anthroposophie bewirkte, dass das Wissen über Gefährdungen und Z.s Vorgeschichte ins Leere lief. Über die Vorfälle in Konrad Z.s Klasse sprachen die Lehrkräfte auf inoffiziellem Wege, zum Beispiel in „Parkplatzgesprächen“. Was Konrad Z. in seinem Unterricht alles getan hat, wurde deshalb nie wirklich zusammengetragen.
Selbst als Konrad Z. die Übergriffe gegen das Zwillingspaar zugab, durfte er seine Klasse noch zwei Tage lang unterrichten. Z. nutzte diese Gelegenheit, um seinen Schüler:innen zu sagen, er müsse gehen, weil er sie „zu sehr liebe“.
2. An der Waldorfschule sind Lehrer:innen unanfechtbare Autoritäten⬆ nach oben
Konrad Z. schüchterte seine Schüler:innen ein, verängstigte sie, setzte sie herab und manipulierte sie emotional, so erzählen es die Schüler:innen den Forschenden. Sie beschreiben ihn als autoritär, streng, unberechenbar und emotional distanziert. Gleichzeitig bewunderten viele seine künstlerischen Fähigkeiten, vor allem seine bunten Tafelbilder, und sein anthroposophisches Wissen.
Die Rolle des Klassenlehrers in der Waldorfpädagogik ist die einer Autoritätsfigur, die das Kind über viele Jahre begleitet. Dieses Ideal, so schreiben es die Wissenschaftler:innen, berge das Risiko mangelnder professioneller Distanz und führe zu einer Idealisierung der Lehrkraft durch Eltern und Kolleg:innen. Im anthroposophischen Verständnis orientiert sich das Kind am „Ich des Erwachsenen“, was dazu führe, dass die Klassenlehrkraft als unanfechtbare Instanz und „Seelenführer“ inszeniert werde. Kinder werden in dieser Logik als Objekte betrachtet, deren Wesen die Lehrkraft mithilfe anthroposophischer Methoden, zum Beispiel Temperamentszuordnungen erkennt.
Waldorfschulen haben den Ruf, antiautoritär zu sein. Dabei ist es genau entgegengesetzt: Die Grundstrukturen sind autoritär. Wenn Lehrkräfte wie Z. überhöht werden, ermöglicht es Menschen wie ihm, ein Gewaltregime aufzubauen, ohne dass ihr Handeln grundsätzlich hinterfragt wird. Die Idealisierung und die hohe Stellung des Lehrers führten dazu, dass Z.s Kolleg:innen seine Taten so interpretiert haben, dass sie den Idealen der Waldorfpädagogik entsprachen.
3. Auch Schicksal, Karma und Strafe spielen bei den Taten eine Rolle⬆ nach oben
Die anthroposophische Weltanschauung war in der Waldorfschule Überlingen stark präsent. Die Vorstellung, dass das Aufeinandertreffen von Lehrkraft und Kind eine „Schicksalsbeziehung“ sei, habe die Autorität der Lehrkraft erheblich verstärkt, da diese eine „schicksalshafte Funktion“ für die Entwicklung der Kinder erfülle, schreiben die Autor:innen. In der Studie heißt es: „Die Kinder in der Klasse von Konrad Z. fanden sich in einem manipulativen Setting wieder, in dem Gewaltausübung quasi karmisch begründet wurde.“
Wie sowas im Alltag aussah? Bei einem besonders brutalen Schlag soll Konrad Z. der Klasse erklärt haben, er habe den beliebtesten Schüler ausgewählt, damit die stellvertretende Bestrafung „möglichst allen weh tun sollte.“ Z. soll sich oft ausgiebig am Ende der Unterrichtsstunde für seine Gewaltausbrüche entschuldigt haben. Er soll an die Empathie der Kinder appelliert und vermittelt haben, dass er sich zwar gewaltvoll verhalten musste, aber eigentlich reuig war.
Selbst als Konrad Z. Schüler:innen in den Papierkorb hineingestellt haben soll, damit sie sich „als Müll fühlten“, sahen Kolleg:innen dies in anthroposophischer Logik als wirksames Instrument der Bestrafung an, da es auf den Willen des Kindes wirke und zur Weiterentwicklung diene. Selbst wenn sich Kinder beschwerten, wie etwa die beiden Mädchen, deren Zöpfe Z. abgeschnitten haben soll, waren sich die Erwachsenen einig, dass Z. den Kindern etwas Gutes getan hatte.
4. Das Kollegium verwaltet sich selbst und arbeitet intransparent⬆ nach oben
Konrad Z. war Schweizer Staatsbürger. Bevor ihn die Waldorfschule Überlingen 1990 einstellte, war er bereits in seiner Heimatstadt als Klassenlehrer tätig. Z. absolvierte eine anthroposophische Lehrerausbildung am Goetheanum, eine Art Tempel der Anthroposophen und Sitz der Anthroposophischen Gesellschaft.
Bevor er an der Schule in Überlingen anfing, informierte Z. den Vorstand der Schule über einen Vorfall in der Schweiz, bei dem er eine Schülerin seiner Klasse gestreichelt und ihr an die Genitalien gefasst hatte. Z. stellte dies als eine „Rufmord-Kampagne“ aufgrund eines Konflikts im Kollegium dar. Tatsächlich lief gegen Z. zu diesem Zeitpunkt bereits ein Verfahren, das er während der Einstellungsgespräche verschwieg. Im August 1990 wurde Z. in der Schweiz wegen „Unzucht mit einem Kind“ rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Z. hatte seine Verurteilung allerdings verschwiegen.
Der Vorstand und mindestens zwei weitere Schulverantwortliche wussten zwar nichts von der Verurteilung, aber von den Tatvorwürfen. Sie entschlossen sich aber, diese Vorwürfe zu verschweigen und Z. trotzdem einzustellen.
Wie genau Waldorfschulen verwaltet werden, unterscheidet sich im Detail von Schule zu Schule. Üblicherweise gibt es eine Geschäftsführung und einen Vorstand des Schulvereins. Eine Schulleitung, die in öffentlichen Schulen gesetzlich vorgeschriebene Dienstaufgaben übernimmt, existiert an Waldorfschulen üblicherweise nicht.
Diese kollegiale Selbstverwaltung beinhaltete auch in Überlingen, dass das Lehrerkollegium über alle relevanten Fragen entschied. Die Folge war, dass die Lehrkräfte viel Zeit mit solchen Entscheidungen verbrachten und deshalb häufig überfordert waren. Die Entscheidungsmacht war diffus, was zu einem „Verantwortungs-Nirvana“ führte.
Im Fall Z. wurde diese Struktur zum Risiko: In den Abendkonferenzen ging es mehr darum, den Ruf der Schule nicht zu gefährden, als darum, die Taten von Z. aufzuklären.
Sein Arbeitsverhältnis wurde letztlich zum 31. Dezember 1993 durch einen Auflösungsvertrag beendet. Obwohl die Schule auf eine Strafanzeige verzichtete, wurde Z. von unbekannten Dritten angezeigt. Im Mai 1994 wurde er für das Anfassen des Zwillingspaar verurteilt, wieder auf Bewährung.
Die Schule ist heute besser aufgestellt⬆ nach oben
Die Waldorfschule Überlingen hat seit dem Fall Konrad Z. in den 1990er Jahren ihre Gewaltpräventions- und Aufklärungsstrukturen verbessert. Allerdings erst nach Druck von Außen. Im Jahr 2022 drängte der Dachverband alle Waldorfschulen dazu, ein Schutzkonzept auszuarbeiten, wenn sie im Verband bleiben wollten. Die wissenschaftliche Untersuchung des IPP gab die Schule zwar selbst in Auftrag, aber erst, nachdem ehemalige Schüler:innen die Aufarbeitung in Gang gesetzt hatten.
In einer Pressemitteilung nach der Veröffentlichung der Studie zeigen sich die heutigen Verantwortlichen erschüttert. Mittlerweile gibt es ein vorläufiges Schutzteam, zwei neue Schulsozialarbeiterinnen sowie Interventionspläne für verschiedene Gefährdungen. Um klare Verhaltensstandards zu schaffen, führte die Schule eine Verhaltensampel und eine obligatorische Selbstverpflichtungserklärung zum grenzachtenden Verhalten ein, die Teil des Arbeitsvertrags jeder Lehrkraft ist.
Jede Waldorfschule ist anders und in jeder Waldorfschule spielt Anthroposophie eine unterschiedlich große Rolle. Auch in der Studie heißt es: „Die […] Risikofaktoren dürften je nach Waldorfschule unterschiedlich stark ausgeprägt sein.“ Die Autor:innen der Studie schreiben aber auch: „Im Fall der Waldorfschule Überlingen wird deutlich, dass ihre traditionsreiche anthroposophische Prägung und Orientierung zumindest bis Anfang der 2020er Jahre gewaltbegünstigende Strukturen […] stabilisierte.“ Und in den Interviews spiegele sich bis heute die Wirkung der anthroposophischen Lehre im pädagogischen Selbstverständnis mancher interviewten Lehrkräfte und Eltern wider.
Die Selbstverwaltung, die Autorität der Klassenlehrkraft, das geschlossene System und anthroposophische Lehren wie Karma und Strafe sind keine Besonderheiten dieser einen Schule, sondern in vielen Waldorfschulen verankert. Das zeigt unsere Berichterstattung über aktuellere Missbrauchsfälle. Diese Eigenheiten führen nicht zwangsläufig dazu, dass Lehrkräfte übergriffig werden oder Taten verschleiert werden. Aber, und das ist nun auch wissenschaftlich hergeleitet: Sie scheinen beides zu begünstigen.
Redaktion: Isolde Ruhdorfer, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Gabriel Schaefer, Audioversion: Iris Hochberger