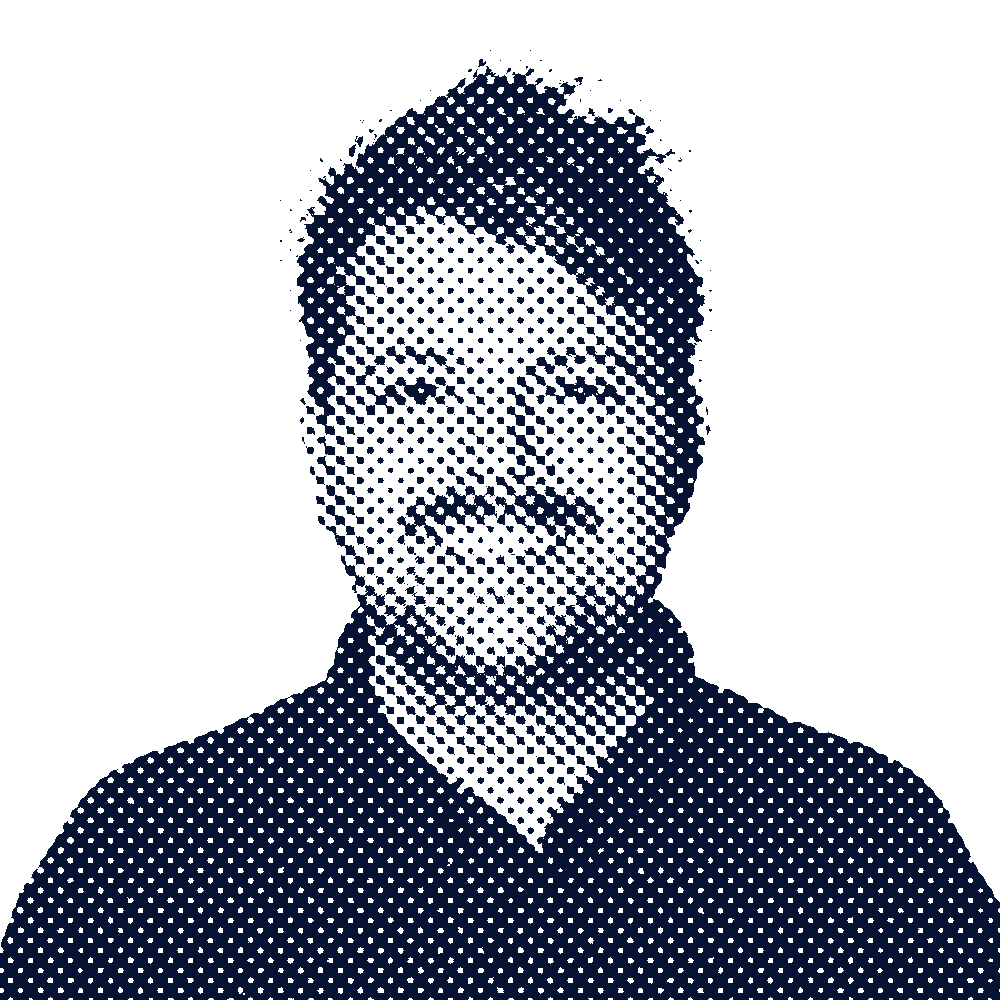Du machst bei einem Experiment mit. Die Wissenschaftlerin zeigt dir ganz viele Farben hintereinander. Deine Aufgabe ist es, die Farben zu benennen. Dafür musst du entscheiden: Wann ist das Rot kein Rot mehr und wird zu Lila? Oder wann ist das Gelb kein rötliches Gelb mehr, sondern schon Orange? Also: Wann hört die eine Farbe auf und wann beginnt die nächste?
Dieser Test war einer von vielen, den die Wissenschaftlerin Else Frenkel-Brunswik durchgeführt hat. Du kennst sie nicht? So geht es den meisten. Frenkel-Brunswik verfasste allerdings 1950 mit niemand geringerem als Adorno zusammen „The Authoritarian Personality“, die bis heute vielleicht wichtigste Studie zu autoritären Charakterzügen.
Die Tests zur Farbwahrnehmung machte Frenkel-Brunswik an Kindern. Entscheidend war nicht die richtige Antwort, sondern, wie sicher oder unsicher die Kinder waren, und ob sie bereit waren zu sagen: „Ich weiß es nicht genau“. Das Ergebnis: Kinder, die mehr Vorurteile hatten, beispielsweise gegenüber Minderheiten, kamen am schlechtesten mit Farbübergängen zurecht. Mehrdeutigkeit verwirrte sie.
Damals setzte sie die Grundlage für eine Erkenntnis, die sich erst jetzt so richtig durchsetzt: Ideologisches, vorurteibehaftetes Denken ist weniger politische Einstellung als eine Art, die Welt wahrzunehmen. Und Kinder und Jugendliche sind dafür besonders anfällig.
Was ist Ideologie überhaupt und warum ist sie faszinierend?⬆ nach oben
Jemanden als Ideologen zu bezeichnen, ist heute eine gängige Herabstufung in der politischen Debatte. Oft benutzen Rechte und Konservative den Begriff, um die eher Linken zu diffamieren. Robert Habeck und die Grünen mit ihren Windrädern? Alles Ideologen! Die Linke, die eine Erbschaftssteuer einführen will? Pure Ideologie!
Eigentlich hatte der Begriff eine andere Bedeutung. Ideologie war bis ins 19. Jahrhundert die Wissenschaft, die sich mit der Entstehung von Ideen beschäftigt hat, aus philosophischer und gesellschaftlicher Sicht. Heute steht der Begriff für ein geschlossenes Weltbild aus Überzeugungen, Werten und Emotionen, das gesellschaftliche Entwicklungen erklärt und politische Handlungen rechtfertigt. Und wenn man den Eindruck hat, jemand vertritt eine Idee oder einen Lösungsansatz nicht deshalb, weil er sie für praktikabel oder sinnvoll hält, sondern nur, weil sie in sein Weltbild passen, nennt man ihn: einen Ideologen.
Die Kognitionswissenschaftlerin Leor Zmigrod geht noch weiter. Sie beschreibt Ideologie als eine Art „Denkstil“. Zmigrod gilt als die Begründerin eines neuen Wissenschaftsfelds: der politischen Neurobiologie. In ihrem Buch „Das ideologische Gehirn“ schreibt sie: Ideologie ist eine tief verankerte Struktur, die beeinflusst, wie Menschen Informationen bewerten, interpretieren und moralisch einordnen. Anders als einzelne politische Ansichten, die sich im Alltag wandeln können, sind Ideologien resistenter gegen Widerspruch und äußern sich oft in einer starken emotionalen Identifikation, zum Beispiel mit einer rechtsextremen Gruppe.
Wenn Ideologie ein Denkstil ist, lohnt sich der Blick in das Organ, das fürs Denken zuständig ist: das Gehirn. Und das funktioniert bei Jugendlichen anders als bei Erwachsenen.
Das jugendliche Gehirn ist besonders sensibel⬆ nach oben
Pubertät ist ein hormonelles Feuerwerk, aber nicht nur. Auch das Gehirn selbst wird komplett neu organisiert. Es wird aber nicht einfach „fertiggestellt“, es wird eher optimiert. Mit zwei Haupttechniken, von denen wahrscheinlich die wenigsten schon gehört haben, die aber einen großen Anteil an den Veränderungen während dieser Zeit haben: Synaptic Pruning und Myelinisierung.
Kurz gesagt: Synaptic Pruning macht aus einem chaotischen Netzwerk aus Nervenzellen und Synapsen ein schlankes, schnelles System. Es schmeißt die Synapsen weg, die nicht gebraucht werden. So kann unser Denken komplexer und effizienter werden.
Während das Gehirn sich entschlackt, passiert noch etwas. Die Nervenzellen bekommen eine Art Superkraft: Myelin. Das ist eine fettige, weiße Substanz, die sich wie eine schützende Hülle um die langen Fortsätze der Nervenzellen legt, die sogenannten Axone. Diese Hülle macht die Signalübertragung schneller. Myelinisierung ist der Grund, warum Jugendliche deutlich besser darin werden, abstrakt zu denken, verschiedene Perspektiven einzunehmen und irgendwann, wenn alles gut läuft, ethische Entscheidungen in komplexen Situationen zu treffen.
Das Ding ist: Synaptic Pruning und die Myelinisierung folgen keinem linearen Fahrplan. Die Veränderungen beginnen meistens ab einem Alter von elf Jahren und ziehen sich oftmals bis in die Zwanziger hinein. Manche Regionen sind schneller fertig (zum Beispiel motorische Areale), andere, wie der präfrontale Kortex, brauchen Jahre. Das ist der Teil des Gehirns, der enorm wichtig ist für Planung, Impulskontrolle, langfristiges Denken, Abwägen von Risiken, kurz: für vernünftige Entscheidungen. Und genau dieser Teil ist einer der letzten, der fertig wird.
Dagegen sind Regionen, die für Emotionen, Belohnung und schnelle Impulse essentiell sind, geradezu frühreif. Sie funken schon in der Pubertät auf Hochtouren, besonders wenn Dopamin ins Spiel kommt, also beim Kick, bei Anerkennung und bei Neuem. Eine etwas unglückliche Kombination.
Die Pubertät führt zu einem systematischen Ungleichgewicht⬆ nach oben
Studien zeigen, dass Jugendliche sich den Risiken ihres Verhaltens zwar oftmals bewusst sind, aber trotzdem ihren Impulsen nachgehen. Sarah-Jayne Blakemore, eine der wichtigsten Forscherinnen zum pubertierenden Gehirn, beschreibt das so: Der emotionale Motor ist voll aufgedreht, aber die Bremse ist noch nicht vollständig installiert. Entscheidungen werden oft aus dem Bauch heraus getroffen, weil das Belohnungssystem überaktiv ist, während das System zur Impulskontrolle noch in der Entwicklung steckt.
Die Bildungsforscherin Nina Kolleck untersucht die Radikalisierung von Kindern und Jugendlichen. Sie sagt: „In der Pubertät ist das Gehirn sehr formbar. Politische Einstellungen festigen sich dann sehr stark. Das heißt aber nicht: einmal Nazi, immer Nazi.“ Trotzdem suchen sich Jugendliche, die in eine bestimmte Richtung denken, oftmals Gleichgesinnte. Sie bleiben also schnell unter denen, die ein ähnliches Weltbild haben.
Und auch das kann man neurobiologisch erklären: Wenn Gleichaltrige zuschauen, bekommt das Gehirn einen zusätzlichen Dopaminschub. Risiko wird plötzlich doppelt belohnt: durch den potenziellen Erfolg und durch soziale Anerkennung. In einer Studie wurde 2014 gezeigt, dass bei riskanten Entscheidungen die Aktivität im Belohnungssystem deutlich höher ist, wenn Jugendliche glauben, dass Gleichaltrige sie beobachten. Gleichzeitig zeigte sich weniger Aktivität im präfrontalen Kortex, der eigentlich für die Kontrolle zuständig wäre.
Andere Jugendliche wirken dabei wie ein Verstärker: Sie machen Risiken attraktiver, weil sie das Gefühl vermitteln, gesehen zu werden. Und in der Pubertät ist gesehen werden nicht nur angenehm, es ist existenziell. Soziale Zugehörigkeit wird über das Verhalten ausgehandelt: Wer mutig ist, wird gemocht, wer mitzieht, gehört dazu. Für Ideologien mit ihrer „Wir gegen die anderen“-Perspektive, also extremer Ingroup-Outgroup-Orientierung, ist das der perfekte Nährboden. Fallstudien zeigen, dass Radikalisierung fast immer im Kollektiv passiert, selten komplett allein zuhause.
Je mehr Vorurteile, desto starrer das Denken⬆ nach oben
Gerade für Jugendliche sind ideologische Weltbilder deshalb faszinierend. Sie bieten Halt in einer Lebensphase, in der vieles unsicher ist: Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Was ist richtig, was falsch? Eine Ideologie liefert sichere Antworten in unsicheren Situationen. Sie gibt das Gefühl von Klarheit, Zugehörigkeit und moralischer Überlegenheit. Psychologisch betrachtet übt sie also eine doppelte Anziehung aus: Sie ordnet die Welt und stärkt das Selbst. Und sie verändert, wie wir denken.
Die Psychologin Else Frenkel-Brunswik war eine der ersten Wissenschaftler:innen, die das nachweisen konnte: Bestimmte Einstellungen in politischen Fragen kann man in unserer kompletten Wahrnehmung wiederfinden. Und das auch bei Kindern und Jugendlichen. Frenkel-Brunswik forschte zu einer Zeit, in der sie selbst von einer der tödlichsten Ideologien betroffen war, die sich jemals verbreitete.
Als Professorin in Wien war sie schon vor 1938 verbalen Angriffen als Jüdin ausgesetzt; Studenten beschwerten sich darüber, Kurse bei „der Jüdin Else Frenkel“ besuchen zu müssen. 1938 floh sie mit ihrem Mann in die USA, forschte dort weiter und war 1950 neben Theodor Adorno, Daniel Levinson und Nevitt Sanford Mitautorin der berühmten Studie „The Authoritarian Personality“.
Mit ihnen prägte sie nach dem Zweiten Weltkrieg den Begriff der „autoritären Persönlichkeit“, ein psychisches Profil, das durch frühe Prägungen entsteht: strenge Erziehung, Angst vor Kontrollverlust, Überidentifikation mit Autoritäten. Die Folge: intellektuelle Starrheit, Ambiguitätsintoleranz, übersteigerte Konformität. Ihre These: Wer in der Kindheit rigide Muster lernt, ist später anfälliger für ideologisches Denken.
Um diese These zu testen, untersuchte sie Kinder in den USA. Zunächst wollte sie wissen, welche Vorurteile die Kinder haben und ob diese Vorurteile Einzelfälle sind oder ein Denkmuster. Sie fand heraus, dass Kinder mit Vorurteilen besonders starr in ihrem Denken sind: Kinder mit Vorurteilen neigten dazu, die Welt in scharfe Kategorien zu spalten (gut/böse, stark/schwach, sauber/schmutzig) und versuchten, Mehrdeutigkeit zu vermeiden, indem sie frühzeitig zu Schlussfolgerungen kommen, oft unter Vernachlässigung der Realität.
Ideologisches Denken ist eine Art, die Welt wahrzunehmen⬆ nach oben
Laut Frenkel-Brunswik findet sich diese Art zu denken auch in der Wahrnehmung. Das belegten die Forschenden unter anderem damit, dass sie ihren Versuchspersonen viele Farben hintereinander zeigten und sie baten, die Farben zu benennen. Auch bei solchen Tests zeigte sich: Die Menschen mit den meisten Vorurteilen kamen am schlechtesten mit Farbübergängen zurecht, bevorzugten eindeutige Klassifikationen und taten bei Mehrdeutigkeit so, als gäbe es sie nicht oder als wäre sie unwichtig. Bei einem anderen Test mussten Versuchspersonen Zahlen erkennen, die aus der Unschärfe heraus auftauchten. Teilnehmer:innen mit mehr Vorurteilen brauchten länger, um die Zahlen zu erkennen. Und sie hielten länger an ihrem ersten Eindruck fest, selbst wenn dieser fehlerhaft war.
Die Kognitionswissenschaftlerin Leor Zmigrod entwickelte ein Modell, das Ideologien als Ergebnis bestimmter kognitiver Voraussetzungen versteht. Wer ideologisch denkt, hat eine geringe kognitive Flexibilität, hohe Ordnungs- und Kontrollbedürfnisse und eine rigide Aufmerksamkeitsverarbeitung. Das heißt: Man fixiert sich stark auf eine bestimmte Sichtweise oder Information und blendet andere, widersprüchliche Perspektiven aus.
Die zentrale These von Zmigrod: Menschen, deren Gehirne Reize besonders kategorisch verarbeiten, neigen eher zu ideologischen Welterklärungen. Aber auch: Menschen, die einer strikten Ideologie folgen, verarbeiten Reize besonders kategorisch. Wie so oft im Gehirn scheint der Pfeil in beide Richtungen zu zeigen. Zmigrod schreibt: „Unser Gehirn formt unsere politischen Einstellungen, und gleichzeitig formen unsere Ideologien die Funktionsweise unseres Gehirns.“ Das gilt über politische Richtungen hinweg, sowohl bei rechtsautoritären als auch bei extrem linken oder religiös fundamentalistischen Weltbildern.
Die Arbeit von Frenkel-Brunswik konnte bis heute immer wieder bestätigt werden. In einer aktuellen Studie mit über 500 Jugendlichen fand ein Team aus Belgien heraus, dass sowohl kognitive als auch emotionale Fähigkeiten eng mit ideologischen Einstellungen im Jugendalter verknüpft sind. Wer schlechter darin war, sich in andere hineinzuversetzen oder flexibel zu denken, zeigte häufiger autoritäre und dominanzorientierte Haltungen, etwa in Form von rechtem Autoritarismus. Und ging davon aus, dass manche Gruppen mehr wert sind als andere, bevorzugte Ungleichheit in Gruppenbeziehungen.
Die Studie kommt zu dem Schluss: Die bekannten Zusammenhänge zwischen Denkfähigkeiten und Ideologie, die man aus Erwachsenenstudien kennt, gelten auch bei Jugendlichen; möglicherweise sogar noch ausgeprägter.
Natürlich spielen die Eltern eine Rolle⬆ nach oben
Wer verstehen will, wie aus Kindern Ideologen werden, sollte sich also die kognitiven Fähigkeiten anschauen. Eltern geben nämlich nicht nur Meinungen weiter, sie vererben Denkstile. Studien zeigen, dass politische Einstellungen in Familien oft über Generationen weitergegeben werden. Kinder in extremistischen Familien werden oft systematisch indoktriniert: Eltern vermitteln ihre Ideologie mit allen Mitteln: Sie geben ihr Weltbild im Alltag weiter, schotten strikt von andersdenkenden Einflüssen ab und disziplinieren auch teilweise rigide.
Aber nicht alle ideologisch denkenden Kinder haben extremistische Eltern. Auch die Art der Erziehung beeinflusst, wie starr, unflexibel und streng Kinder später denken. Zum Beispiel, wenn elterliche Kontrolle eine deutlich größere Rolle spielt als elterliche Wärme. Kinder lernen in ihrer Familie: Welche Themen sind gefährlich? Worüber wird gesprochen, worüber geschwiegen? Wie wird mit Andersdenkenden umgegangen? In einer Langzeitstudie konnte ein internationales Forschungsteam zeigen, dass Kinder, deren Eltern schon im Kleinkindalter auf strikte Gehorsamkeit und Autorität pochten, mit höherer Wahrscheinlichkeit 18 Jahre später zu konservativen bzw. autoritätsgläubigen Jugendlichen wurden. Umgekehrt führten egalitär-demokratische Einstellungen der Eltern tendenziell zu liberaleren Haltungen bei den dann erwachsenen Kindern.
Ein zentrales Konzept, das auch von den Eltern abhängt, ist die Ambiguitätstoleranz: die Fähigkeit, Unsicherheit auszuhalten und Grautöne zu akzeptieren. Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, das Schwarz-Weiß-Denken kultiviert, übernehmen diese Muster. Auch der Kinderarzt Herbert Renz-Polster sagte mir 2020 in einem Interview, wie wichtig ein stabiles Elternhaus ist: „Wenn du diese guten Erfahrungen [im Kindesalter, Anm. d. Red.] nicht machst, bist du auf Sicherheit von außen angewiesen. Dafür braucht es aber eine stabile Welt, es braucht Ordnung und eine klare Rollenverteilung: Männer sind Männer, Frauen sind Frauen. Oben ist oben und unten ist unten.“ Wenn sich an dieser stabilen Welt etwas grundsätzlich verändere, greife das direkt dein Gefühl von Sicherheit an.
Und der Extremismusexperte Matthias Quent schreibt bei der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung: „Nicht selten sind Menschen, die religiös oder politisch motivierte Gewalttaten begehen, schon in gewisser Weise radikalisiert und gewaltbereit, bevor sie eine Ideologie finden. Diese Ideologie bietet einen Weg, Probleme psychologisch auf andere zu übertragen und Aggressionen einen höheren Sinn zu geben.“
Kann man beeinflussen, wie ideologisch Kinder denken?⬆ nach oben
Herbert Renz-Polster sagte mir damals auch, dass die Kindheit kein unabänderliches Schicksal sei. Nur weil man als Kind schlechte Erfahrungen mache, wähle man nicht automatisch später eine autoritäre Partei. „Weder wird aus einem schlecht behandelten Kind automatisch ein Problembär, noch wird aus einem gut behandelten Kind automatisch ein guter Mensch. Diese ersten Erfahrungen sind kein Schicksal, aber sie sind sehr mächtig.“
Für mich führen diese Ergebnisse zu einer Frage: Wenn Ideologie ein Denkstil ist, sollte politische Bildung dann nicht weniger als Wissensvermittlung, sondern mehr als Denkstiltraining gedacht werden? Wenn geringe kognitive Flexibilität, hohe Ordnungs- und Kontrollbedürfnisse und rigide Aufmerksamkeitsverarbeitung die Grundlage ideologischen Denkens sind, ist das Training genau dieser Fähigkeiten vielleicht die beste Prävention. Ein flexibles Gehirn tut sich schwer mit einer unflexiblen Ideologie.
Bildungspsycholog:innen fordern längst, dass kognitive Flexibilität ebenso geschult werden sollte wie Mathe oder Lesen. Schon im Grundschulalter lassen sich Übungen integrieren, die trainieren, die Perspektiv zu wechseln, Widersprüche auszuhalten und mit Mehrdeutigkeit umzugehen. Das mag banal klingen, aber genau diese Fähigkeiten sind eine Art Schutzwall gegen ideologisches Denken.
Gleichaltrige Kontakte außerhalb der Szene sind für ideologiegefährdete Kinder besonders wichtig, denn sie bieten häufig die einzige Korrekturmöglichkeit zur elterlichen Ideologie. Ob durch Familie, Peergroup oder Online-Algorithmen: Wenn ein junger Mensch keine Konfrontation mit abweichenden Meinungen erlebt, fehlen die Chancen, das eigene Denken zu relativieren. Und hat sich ideologisches Denken erstmal festgesetzt, ist es schwer, es wieder loszuwerden.
Transparenzhinweis: In meinem Newsletter „Das Leben des Brain”, der unabhängig von Krautreporter erscheint, hat der Verlag Suhrkamp in einer Ausgabe Werbung für das Buch von Leor Zmigrod geschaltet. Ich profitiere in keiner Weise finanziell davon, dass ich den Inhalt des Buches hier einbeziehe.
Wir haben die Einleitung nach der Veröffentlichung noch einmal verändert.
Redaktion: Lea Schönborn, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert