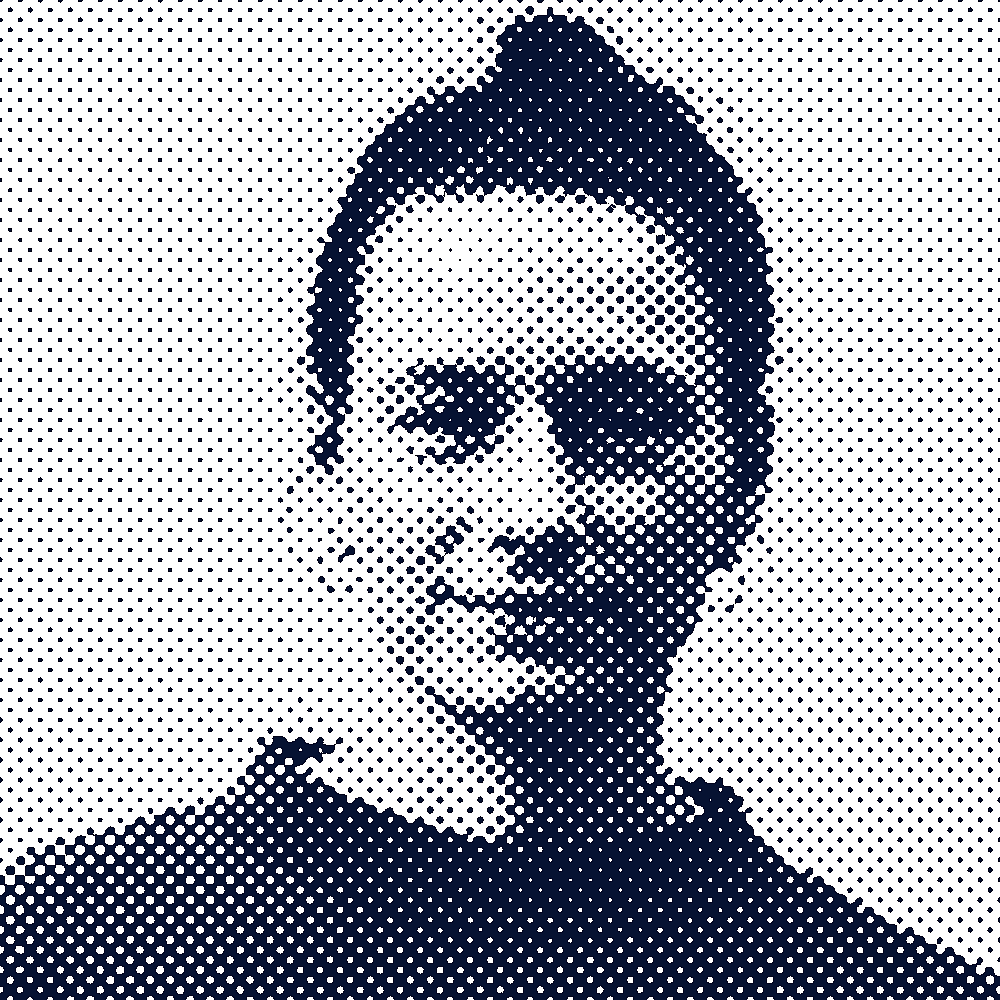Natürlich wusste ich, dass das Thema heiß war. Über Mütter wollte ich schreiben, die in einer Studie darüber Auskunft gegeben hatten, dass sie ihr Muttersein bereuten. Meine jüngere Schwester, damals noch im Psychologiestudium, hatte mir von dem Thema erzählt. Die Soziologin Orna Donath hatte für ihre Studie Interviews mit 23 Müttern in Israel geführt.
Journalist:innen suchen immer nach dem Neuen. Dem Unerhörten, dem Drama, über das vorher noch niemand berichtet hat. Donaths Ergebnisse über jene Frauen, die ihr in aller Direktheit erzählt hatten, sie würden sich nie wieder für ein eigenes Kind entscheiden, wenn sie noch einmal wählen könnten, waren in dieser Klarheit neu. Donath gab dem Phänomen einen Namen: regretting motherhood.
Noch nie zuvor hatte ich davon gehört oder gelesen. Eine Ahnung jedoch, dass es ein solches Phänomen vielleicht geben könnte, hatte ich lange Zeit stumm mit mir herumgetragen. In mir arbeiteten Fragen, die gleich zwei verbreitete Ideale infrage stellten: Die Vorstellung einer Mutterliebe, die immer alles erfüllt, und die Annahme, dass bei allen Frauen irgendwann zwangsläufig ein Kinderwunsch entsteht. Beide Erzählungen erschienen mir unschlüssig, fühlten sich falsch an. Deshalb ist dieser Text auch ein persönliches Fazit.
Mal fand ich den Gedanken an ein Kind schön, mal löste er Panik aus⬆ nach oben
Denn die Ahnung, mütterliche Reue könnte eventuell gar nicht so unmöglich sein, speiste sich aus meiner eigenen Ambivalenz. Zu dem Zeitpunkt, als ich Donaths Studie im Februar 2015 zum ersten Mal las, war ich 32 Jahre alt und kinderlos. Aber die äußeren Zeichen standen auf Familie: Ich war gesund und im besten gebährfähigen Alter; die vor mir liegenden Jahre galten als die Lebensdekade, in denen man eine Familie gründete; ich hatte einen Partner, der sich Nachwuchs wünschte und mit dem ich eine ernsthafte Beziehung führte; ich mochte Kinder, war geübt im Umgang mit ihnen, da ich seit meinem 13. Lebensjahr in verschiedenen Familien als Babysitterin gejobbt hatte – kurzum: Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis ich selbst schwanger werden würde. So zumindest diktierte es die Norm.
In mir aber tobte eine dunkle Ambivalenz. Ich wusste nicht, was ich wollte. Mal fand ich den Gedanken an ein eigenes Kind schön – dann wieder löste er größte Panik in mir aus. Mal sah ich mich selbst als Mutter – dann wieder erschien mir die Vorstellung grotesk, einfach unmöglich für mich. Diese Momente waren es, in denen ich mich fragte: Wenn jede Entscheidung im Leben einen möglichen Fehler impliziert, was wäre, wenn ich mich für ein Kind entscheiden und diesen Schritt später bereuen würde? Die Endgültigkeit der Entscheidung für ein Kind machte mir Angst.
Und regrettingmotherhood explodierte⬆ nach oben
Insofern fiel Donaths Studie bei mir auf fruchtbaren Boden. Ich fand das, was ihre Probandinnen sagten, mutig und unerhört. Aber nicht absurd. Die 57-jährige Tirtza etwa, die berichtete, Mutterschaft habe ihrem Leben nichts hinzugefügt außer Schwierigkeiten und ständige Sorge. Die 44-jährige Charlotte, die aussagte, sie ziehe aus ihrer Mutterrolle keinerlei emotionalen Gewinn. Oder Atalya, 55, die zu Protokoll gab, sie könne einfach nicht verstehen, wenn andere Mütter von Glückgefühlen sprächen.
All das fand ich höchstinteressant und plausibel. Doch welche Sprengkraft jene drei Aussagen und die der anderen 20 Frauen aus Donaths Studie haben würden, war mir im Vorhinein nicht klar gewesen.
Nachdem mein Text über Donaths Arbeit im Frühjahr 2015 erschienen war, entfachte sich unter dem Hashtag #regrettingmotherhood eine hitzige Debatte. Aus der Süddeutschen Zeitung wanderte das Thema zu Twitter, nur, um von dort in die Zeitungen, Magazine und Online-Portale zurückzuwandern. Genauso schnell kam es in den Sozialen Medien an.
Ein Vater kommentierte auf Facebook: „Alle jammern immer nur rum.“ Ein User twitterte: „#regrettingmotherhood = Egotrip.“ Das Magazin The European bezeichnete die Debatte unter der Überschrift „Werdet endlich erwachsen!“ als „Selbstmitleid in Perfektion.“ Spätestens, als Claus Kleber im ZDF heute journal sagte, das Thema habe einen Nerv getroffen, hatte ich es kapiert: #regrettingmotherhood hatte Gefühle zutage gefördert, die sehr viele Menschen anscheinend sehr lange für sich behalten hatten. Als hätte man den Deckel von einem Schnellkochtopf genommen. Der Überdruck musste raus.
Aber es waren nicht nur Gefühle der Ablehnung und Abwertung, die plötzlich überkochten – in den Kommentaren der Sozialen Medien „outeten” sich Mütter, die ebenfalls bereuten, andere bekundeten zumindest ihr Verständnis. Die Debatte lief weiter, als wolle sie sich nicht mehr beruhigen; es erschienen immer neue Beiträge in Zeitungen, Magazinen, im Radio und im Fernsehen.
2016 erschien mein Sachbuch zum Thema. Es war mein persönlicher Höhepunkt in der öffentlich geführten Auseinandersetzung rund um das Thema Mutterschaft und dem, was diese neben Glück und Erfüllung auch bedeuten kann. Orna Donath veröffentlichte im selben Jahr ein Buch rund um ihre Studie.
Die Veröffentlichung beider Bücher (und weiterer zum Thema) liegt mittlerweile zehn Jahre zurück. Was hat sich durch #regrettingmotherhood verändert? In dem Bild, das wir als Gesellschaft heute von Mutterschaft haben? Und in mir?
Zehn Jahre später: Was hat sich verändert?⬆ nach oben
Ich bin mittlerweile 42 Jahre alt, so gut wie raus aus dem gebärfähigen Alter – und kinderlos geblieben. War diese Entscheidung richtig?
Wenn ich heute bei Google den Begriff regrettingmotherhood eingebe, werden mir 2.310 Beiträge angezeigt. „regrettingmotherhood war ein super Anlass, um das Ideal des Mutterbildes einmal grundlegend infrage zu stellen“, sagt die Kommunikationswissenschaftlerin Natalie Berner von der Technischen Universität Chemnitz. Berner hat von 2015 bis 2018 für ihre Promotion untersucht, wie das Bild der Mutter in Politik, Wirtschaft, klassischen sowie Sozialen Medien konstruiert wurde.
Auch vor #regrettingmotherhood habe es zwar eine Diskussion im Zusammenhang mit Mutterschaft gegeben, sagt Berner. Diese habe sich aber um das Vereinbarkeitsproblem von Familie und Beruf gedreht, das hauptsächlich Frauen betrifft. „Damals gab es Diskussionen um die sogenannte Herdprämie“, sagt Berner. Die Herdprämie bezeichnete umgangssprachlich ein staatliches Betreuungsgeld, das 2013 eingeführt wurde für Familien, die ihren Nachwuchs selbst zuhause betreuen wollten. 2015 wurde sie wieder abgeschafft. „Aber durch #regrettingmotherhood kam eine ganz neue Ebene im öffentlichen Diskurs hinzu: die emotionale. Plötzlich durften Mütter das Negative und Abgründige rund um Mutterschaft ausdrücken und entsprechende Gefühle benennen. Das wurde sehr intensiv und umfassend ausgeleuchtet.“
Die mütterliche Reue stellte dabei lediglich die Extremposition dar. Wenn man so will: den äußersten negativen Rand von Mutterschaft, ein Nischenphänomen. Viel mehr Beiträge in den Medien, aber auch in Kunst und Kultur, leuchteten das Mittelfeld aus, berichteten aus feministischer Sicht von den Kosten, die Mutterschaft für eine Frau bedeutet.
In den vergangenen zehn Jahren gab es immer neue Ausstellungen, Filme, Dokumentationen und Bücher, die alle fragten, was Mutterschaft heute bedeutet. Ich freute mich in jenen Jahren still über jeden Beitrag. Und trug weiter meine Ambivalenz mit mir herum. Sie zerriss mich fast. Das mag dramatisch klingen, aber es fühlte sich wirklich so an.
Die Zerrissenheit bliebt jahrelang⬆ nach oben
Auf der Suche nach einer eindeutigen Antwort interviewte ich Mütter, die glücklich waren mit ihrer Wahl, sprach mit Menschen, die sich gegen eigene Kinder entschieden hatten und ebenso glücklich schienen, sprach mit Expertinnen, Künstlerinnen, meiner eigenen Mutter, beobachtete Freundinnen, die Mutter wurden, las unzählige Bücher; ich leuchtete die Frage, Kind ja oder nein, von allen erdenklichen intellektuellen und emotionalen Seiten aus, die mir einfielen.
Doch es half alles nichts. Die Ambivalenz wollte nicht weichen.
Schreiben half, manchmal. Aber nicht dauerhaft.
Im Rückblick waren es anstrengende, schwere Jahre. Mit Mitte 30 trennte ich mich von meinem Partner, während um mich herum gemeinsame Wohnungen bezogen und Babys geboren wurden. Meist lief ich durch mein Leben und fühlte mich falsch. Weil ich nicht das fühlte – ein eindeutiges Ja zu einem eigenen Kind – was ich laut gesellschaftlicher Norm als Frau im besten gebährfähigen Alter doch fühlen sollte. Was von mir erwartet wurde. Was mein Ex-Partner sich von mir gewünscht hatte. Es war sogar noch schlimmer: Ich fühlte noch nicht mal ein eindeutiges Nein!
Was für ein Loser ich doch war, dachte ich. Oft.
Die Kommentare, die manchmal von verschiedenen Seiten an mich herangetragen wurden, wenn ich sagte, ich hätte starke Zweifel und wisse nicht, ob ich ein eigenes Kind wolle, vielleicht eher nicht, waren keine Hilfe. Im Gegenteil: Sie machten mich einsam. Und sie taten mir weh.
Meine damalige Frauenärztin sagte, ohne eigene Kinder hätte ich auf lange Sicht niemanden, um den ich mich kümmern könne. Und auch niemanden, der sich um mich kümmern würde.
Eine gute Freundin meinte, es sei die gesellschaftliche Pflicht einer jeden Frau, ein Kind zu gebären.
Die Mutter einer entfernten Bekannten sagte mir ins Gesicht, keine eigenen Kinder, das würde gar nicht gehen. So als sei die selbst gewählte Kinderlosigkeit eine absolut unmögliche Vorstellung, ein Witz. Was das mit mir gemacht hat, habe ich hier beschrieben.
In jedem dieser Momente begann ich, mich zu rechtfertigen. Zu erklären, wo meine Zweifel herkamen. Dass ich Kinder durchaus mochte – dass ich sogar eine Kinder-Person war. Alle meine Babysitter-Kinder hatten mich gemocht, hörte ich mich sagen. Es muss verzweifelt geklungen haben.
Erst viel später habe ich begriffen: Ich hätte mich nicht rechtfertigen müssen. In keinem einzigen dieser Momente. Nicht für meine Zweifel. Nicht für meine Angst. Nicht für weltweit sinkende Geburtenraten. Nicht dafür, dass ich frei entscheiden wollte. Wieso auch?
Ich wollte nur das, was Männern im Übrigen längst zugestanden wird: eine Wahl haben. Ohne, dass irgendwer mich bewertet.
Doch ich musste über die Jahre erst lernen, mir ein eigenes Narrativ zu bauen. Eines, das sich authentisch anfühlte. Das zu mir passte. Ich musste lernen, die Ambivalenz als solche zu akzeptieren, sie nicht lösen zu wollen. Mir selbst zu vertrauen. In meinem Gefühl und in der Wahl meines Lebensmodells.
Und heute?
Mehr Freiheit, mehr Gelassenheit⬆ nach oben
Natalie Berner, die Expertin von der Uni Chemnitz, die den Diskurs rund um Mutterschaft über die Jahre weiterverfolgt hat, sagt: „Die negativen Seiten von Mutterschaft sind im Mainstream angekommen, in das Thema integriert. Und es gibt heute auch im medialen Diskurs ein Problembewusstsein dafür, dass Care-Arbeit zu wenig gewertschätzt wird.“ Das sei vor #regrettingmotherhood nicht der Fall gewesen. Auch die Pandemie habe dazu geführt, dass Care-Arbeit sichtbarer geworden sei. „Das hat sich auf jeden Fall gedreht“, sagt sie.
Berner findet, dass Mütter heute tatsächlich freier darin sind, ihre Gefühle zu äußern – auch und insbesondere negative –, als dies noch vor zehn Jahren der Fall war. Sie glaubt, dass dieser Effekt sich nicht nur auf den medialen Raum beschränkt, „das ist runtergeschwappt bis ins Private.“ Und sie sagt: „Wir haben heute eine größere Wahlfreiheit im Lebensmodell einer Frau, das auf jeden Fall.“
Der letzte Satz gefällt mir sehr. So soll es sein, denke ich. Das ist es, was ich mir für jede Frau wünsche.
Wenn ich heute auf mein damaliges Ich von 2016 schaue, das so verloren war in der eigenen Ambivalenz, würde ich ihm gern folgendes sagen, was ich damals noch nicht wusste:
Such dir Vorbilder. Frauen, die einen Lebenssinn abseits der Mutterrolle gefunden haben.
Such dir Gleichgesinnte. Das Leben fühlt sich „normaler“ an, wenn du nicht die Einzige in deinem Freundeskreis bist, die mit dem klassischen Weg hadert und nach einem eigenen sucht.
Such dir Gemeinschaft. Wer als Erwachsene:r nicht in der klassischen Familienkonstellation lebt, muss deswegen nicht allein sein oder allein leben.
Vertrau deinem Gefühl. Du bist nicht seltsam, auch nicht falsch.
Es ist okay, wenn du alles Mögliche sein willst, aber keine Mutter. Oder wenn du nicht weiß, ob du jemals eine sein möchtest.
All das ist mir heute klar. Deswegen hat sich meine Ambivalenz nicht in Luft aufgelöst; ab und zu klopft sie noch an meine Tür und stellt die alte Frage: Was wäre, wenn? Aber die Frage macht mir keine Angst mehr. An ihre Stelle ist eine gewisse Gelassenheit getreten. Vielleicht ist diese auch eine Frage des Alterns. Denn irgendwann stehen wir alle vor der Erkenntnis: Nicht jede Tür im Leben, die ich hätte öffnen können, habe ich geöffnet.
Die Entscheidung, kein eigenes Kind bekommen zu haben, war für mich die richtige. Wenn ich heute auf mein Leben schaue, finde ich es bunt, reich und warm. An den meisten Tagen bin ich zufrieden. Genauso, wie es ist.
Redaktion: Theresa Bäuerlein, Schlussredaktion: Leon Fryszer, Bildredaktion: Gabriel Schäfer, Audioversion: Iris Hochberger