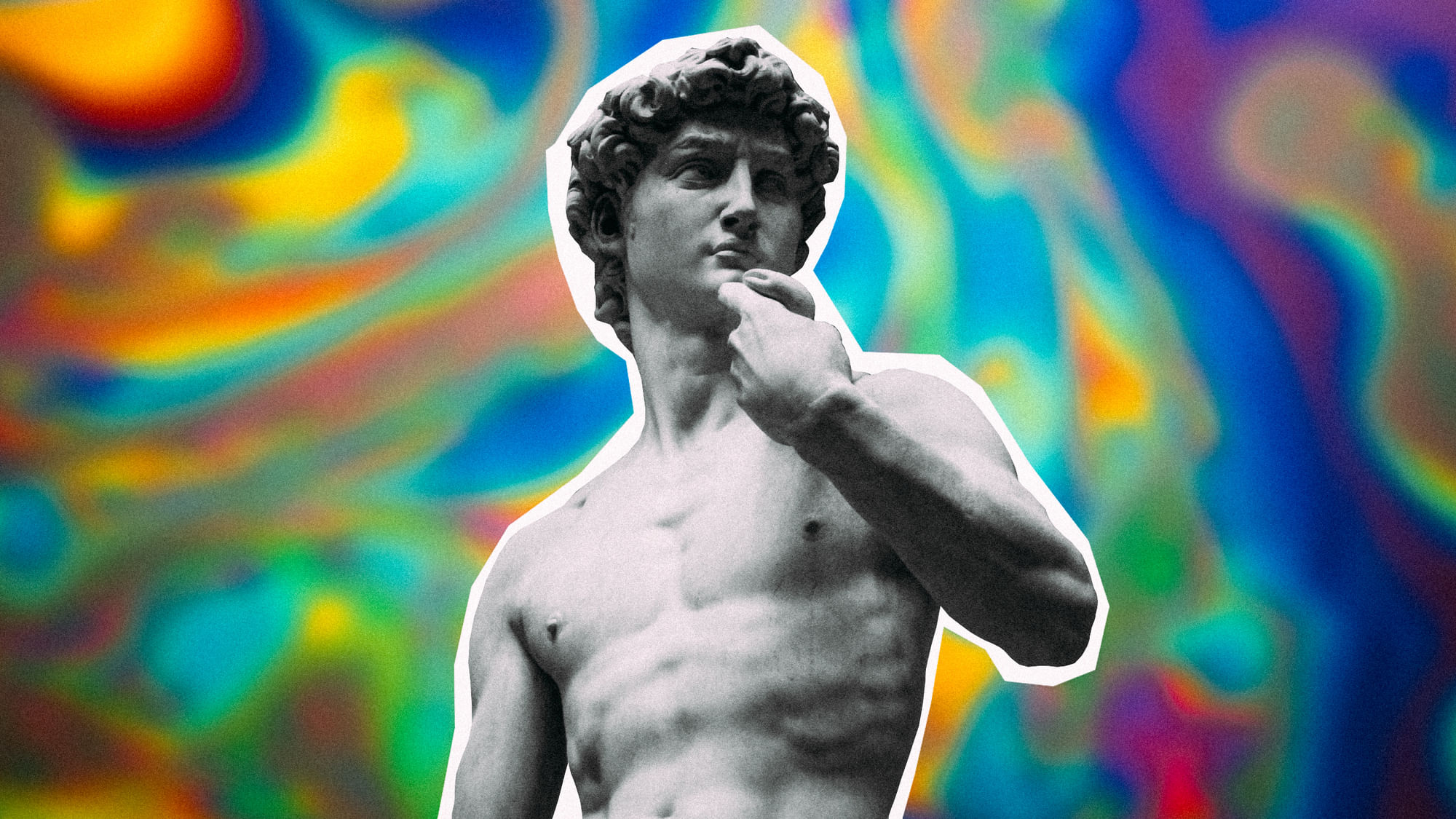Kann man (noch) mit Männern leben? Diese Frage stellt sich die Philosophin Manon Garcia, nachdem sie den Prozess um Dominique Pélicot in Avignon verfolgte. Ihr Buch dazu ist am 15. September bei Suhrkamp erschienen.
Statistisch gesehen ist ein Mann das größte Risiko für seine Frau, Gewalt zu erfahren. Kann man da eigentlich noch mit ihnen zusammenleben? Und wenn ja, wie?
Manon Garcia hat die Frage für sich mit ja beantwortet. Während wir das Interview in ihrem Wohnzimmer führen, spielt ihr Mann mit dem jüngeren Kind im Zimmer nebenan.
Wir sind gerade in Berlin Kreuzberg. Viele Männer hier halten sich für ziemlich feministisch. Müssen die wirklich noch so viel dazulernen?
Selbst dem queer-feministischsten Kreuzberger würde ich sagen: Denke nicht, dass dich das nichts angeht. Frage auch du dich, was du mit den 50 Tätern rund um Pélicot gemeinsam hast. Ich bin mir sicher, dass auch du schon mindestens Zeuge von inakzeptablen Szenen gewesen bist. Bist du bereit, dich dem zu stellen? Das ist dein Beitrag zu einer Welt, in der so etwas nicht mehr vorkommt.
Was wünscht du dir von den Männern?
Zunächst einmal, dass sie sich eine simple arithmetische Frage stellen: Wie kann es sein, dass alle Frauen andere Frauen kennen, die bereits sexuelle Übergriffe erlebt haben, aber die allermeisten Männer sagen: Niemand meiner Freunde würde so etwas tun? Der Fall Pélicot ist eine Analogie dazu. Frauen identifizieren sich mit Gisèle und halten bei Demonstrationen „Wir sind alle Gisèle“-Plakate hoch. Aber kein Mann denkt, dass es vielleicht Dinge gibt, die ihn mit Dominique Pélicot verbinden. Ich verstehe natürlich, dass es schwer ist, sich mit einem Verbrecher zu identifizieren. So wie es den Deutschen schwerfiel, sich mit dem NS-Verbrecher Eichmann zu identifizieren. Aber so wie die Deutschen sich fragen mussten, was sie mit Eichmann zu tun haben, müssen sich alle Männer fragen, was sie mit Dominique Pélicot gemein haben. Hannah Arendt schreibt über den Eichmann-Prozess, dass die Gleichgültigkeit der deutschen Gesellschaft Eichmanns Verbrechen erst möglich gemacht hat. So wie die Deutschen sich ihrem Rassismus und Antisemitismus stellen müssen, müssen sich Männer mit ihrem sexistischen Denken auseinandersetzen.
Wie kann das konkret aussehen?
Männer, denkt darüber nach, ob ihr sexuell jemals etwas bekommen habt, das die Frau nicht wirklich wollte. Kann es vielleicht sogar sein, dass ihr euren Kumpels damit imponieren wolltet? Hat einer eurer Freunde etwas gemacht oder gesagt, was nicht ok war, und ihr habt nicht darauf reagiert? Habt ihr mitgelacht, als jemand einen sexistischen Witz gemacht hat? Und falls ihr euch nicht sicher seid, ob der Spruch sexistisch war oder nicht: Ersetzt „Frau“ mit „Jude“ oder „Ausländer“. Wäre es dann ok, das zu sagen? Das frage ich mich manchmal, wenn ich beobachte, wie Frauen auf der Straße belästigt werden. Wenn anderen benachteiligten Gruppen genauso oft Dinge hinterhergerufen werden würden, wären die Meinungsseiten voll damit.

Manon Garcia
Manon Garcia ist nach Stationen in Harvard und Yale Professorin für Praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Sie forscht insbesondere zu den Themengebieten feministische Philosophie, politische Philosophie und Moralphilosophie. Ihre Bücher über weibliche Unterwerfung und sexuelle Zustimmung wurden in mehrere Sprachen übersetzt. „Mit Männern leben: Überlegungen zum Pélicot-Prozess“ erschien am 15. September 2025 bei Suhrkamp. Foto: © Heike Steinweg/Suhrkamp Verlag
Was noch?
Alltagssexismus als solchen erkennen. Wir alle kennen doch Paare, bei denen sie am Wochenende mit den Kindern aufsteht, aber er dreht sich um und schläft weiter. Das geht einfach gar nicht! Mütter richten morgens die Brotdose, haben alles auf dem Schirm, während manche Männer sich einfach aus der Verantwortung ziehen und auch noch denken, das sei cool. Wie kann Verantwortungslosigkeit denn cool sein? Wie kann es cool sein, sich als erwachsener Mann wie ein Baby zu benehmen?
Du kommst zu einem überraschenden Schluss, denn du sagst, der Pélicot-Prozess „ist der Prozess, der zeigt, dass Prozesse niemals ausreichen werden.“ Dabei haben die Täter schwere Strafen bekommen. Aber du sagst: Das reicht nicht?
In Frankreich gibt es mehr als 40.000 Vergewaltigungen im Jahr. Knapp 80.000 Menschen sind dort gerade im Gefängnis. Mal angenommen, man würde alle Vergewaltiger zu Gefängnisstrafen verurteilen, dann müsste man jede Menge neue Gefängnisse bauen. Dazu kommt: Wir wissen, dass Gefängnisstrafen keinen Einfluss darauf haben, ob die Täter erneut vergewaltigen. Man schützt die Gesellschaft also nur für die Zeit, in der sie im Gefängnis sitzen. Außerdem ist es sehr schwer, Vergewaltiger überhaupt ins Gefängnis zu bringen, weil die Richter:innen und Anwält:innen dieselben sexistischen Einstellungen haben wie die Angeklagten, wenn auch weniger ausgeprägt. Gefängnisstrafen werden Männer nicht vom Vergewaltigen abbringen. Es ist, wie wenn man versucht, das Meer mit einem kleinen Löffel zu leeren. Die Justiz ist lediglich der kleine Löffel.
Wie können wir als Gesellschaft stattdessen gegen Vergewaltigungen vorgehen?
Zum Beispiel indem man Väter dazu bringt, längere Elternzeiten zu nehmen. Wir müssen zu einem Konsens darüber kommen, dass Sexismus und sexuelle Gewalt auf einem Kontinuum stattfinden. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Männern, die vergewaltigen und Männern, die keine Wäsche waschen. Wir wissen, dass Kinder, deren Väter ihren fairen Anteil im Haushalt übernehmen, ein gleichberechtigteres Rollenverständnis haben. Und ein gleichberechtigtes Rollenverständnis schützt Jungen davor, später Männer zu werden, die vergewaltigen. Gesetze darüber, wie viel Elternzeit Väter nehmen, haben also einen Einfluss auf die Statistik sexueller Gewalt.
Der Zusammenhang zwischen der Frage, wie viel Männer im Haushalt übernehmen und dem Pay Gap leuchtet den meisten wahrscheinlich noch ein. Sexuelle Gewalt wird dagegen eher nicht mehr als Teil dieses Kontinuums gesehen.
Sex wird oft als Blackbox gesehen, als etwas, das vom Rest unseres Lebens separiert ist. Etwas zutiefst Intimes, das nicht von der Gesellschaft geformt ist. Eben hier liegt der Fehler: Unsere sexuellen Vorlieben sind genauso von der Gesellschaft geprägt wie die Frage, ob wir lieber Tee oder Kaffee mögen. Auch hier könnte man davon ausgehen, dass das eine ganz individuelle Entscheidung ist. Aber die meisten Brit:innen wählen Tee, Italiener:innen eher Kaffee. Und so wird Mädchen schon früh der Geschmack für Unterwerfung antrainiert. Mit meinen Kindern habe ich mir in letzter Zeit die ganzen Disney-Märchen wieder angesehen. Egal ob Schneewittchen, Aschenputtel oder Aladdin: Bei den Frauenfiguren wird belohnt, wer passiv und bescheiden ist.
Wenn Kultur unsere sexuellen Vorlieben prägt, heißt das: Frauen romantisieren Unterwerfung?
Ja, aber genau hier können wir ansetzen. Descartes (Anm. d. Red.: ein französischer Philosoph der Aufklärung) sagt, es ist leichter seine Wünsche als die Weltordnung zu verändern. Es ist ein Unterschied zu sagen: Du kannst dir deine Vorlieben nicht aussuchen und du musst auch nach diesen Vorlieben handeln. Man kann seine eigenen sexistischen Einstellungen überwinden. Es gibt Frauen, die keine Lust mehr haben, mit Männern zusammenzuleben und stattdessen Beziehungen mit Frauen führen (wenn sie bisexuell sind) oder alleine bleiben. Oder eben Frauen, die sich entscheiden, Gleichheit statt Dominanz zu erotisieren.
Ein Genre, das die Erotisierung von weiblicher Unterwerfung und männlicher Dominanz auf die Spitze treibt, sind die Dark-Romance-Romane. Findest du es verwerflich, die zu lesen?
Nein. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leserinnen Dark Romance dazu nutzen, sich auch kritisch mit ihren Begierden auseinanderzusetzen. Man kann sich sagen: Das sind meine Begierden, aber ich möchte nicht danach handeln, daher lebe ich das als Leserin aus. Ich glaube schon, dass viele Frauen das sehr bewusst lesen. Das kann auch befreiend sein.
Ist es dasselbe wie die Ästhetisierung von Gewalt in Filmen, etwa beim amerikanischen Regisseur Quentin Tarantino? Können Dominanz-Begierden auch so ausgelebt werden?
Im Idealfall ja. So ähnlich argumentiere ich in „Das Gespräch der Geschlechter“ am Beispiel von BDSM (Anm. d. Red.: Bondage & Discipline / Fesseln und Züchtigung, Dominance & Submission / Dominanz und Unterwerfung und Sadismus & Masochismus). Schwules und lesbisches BDSM kann so funktionieren. Es kann Machtverhältnisse umkehren und parodieren, aber dafür müssen die Rollen gebrochen werden. Wenn beispielsweise Hetereosexuelle BDSM leben in herkömmlichen Rollen, also Mann dominant und Frau unterwürfig, dann ist es zu nah an der Realität, um noch befreiend zu sein. Ich glaube, Tarantino ist zwischen den beiden Polen: Ist es eine Katharsis oder einfach nur die Lust an Gewalt?
In Dark Romance gibt es auch das Erzählmuster, dass die Frau den bösen, missbräuchlichen Mann von seinen Dämonen rettet. Das hat mich an dein Buch erinnert: Du schreibst, wie du einen der Angeklagten sexy findest.
Bei Suhrkamp wollten sie, dass ich nicht „sexy“ schreibe. Aber ich habe darauf bestanden. Es war so ein Typ, der sofort den Beschützerinstinkt in uns weckt. Und so sind wir Frauen sozialisiert. Die Frau ist die Krankenschwester für den Mann.
Du nennst in „Das Gespräch der Geschlechter“ auch Positivbeispiele aus der Populärkultur, etwa die Serie „Normal People“ (auf Grundlage des Buches von Sally Rooney) oder die Serie „Sex Education“. Kannst du dich erinnern, wie es war, als du beim Streamen das erste Mal das Gefühl hattest: Ja, genau, das meine ich.
Es war tatsächlich andersrum. Lange Zeit war mein Guilty Pleasure die US-amerikanische Arztserie „Grey’s Anatomy“ zu schauen. Dort sah ich zum ersten Mal Szenen, in denen immer wieder nach Zustimmung gefragt wird und die wirklich heiß sind. Das zeigt doch, wie Kultur unsere Vorlieben prägen kann. Das Frankreich, in dem ich aufgewachsen bin, war geprägt vom „Charme des Baiser Volés“, also der Sexyness der „gestohlenen Küsse“. Wenn man sich alte Filme wie Jean-Luc Godards „Außer Atem“ ansieht, findet man dort wenig Konsens.
Du sagst, Sexismus ist ein Kontinuum: Zu wenig im Haushalt zu tun, ist am einen Ende des Spektrums, Vergewaltigung am anderen. Ähnlich argumentierst du auch, dass chemische Unterwerfung nicht erst damit anfängt, dass jemand seine Frau unter Betäubung vergewaltigt.
K.o.-Tropfen in Clubs zählen natürlich dazu. Aber es fängt schon viel früher an, bei den „Ladies‘ Nights“, bei denen Frauen Freigetränke bekommen. Oder dass Frauen in Clubs zuerst bedient werden. Warum lieben Männer Clubs, in denen Frauen kostenlos trinken können? Weil Frauen dann weniger Kontrolle über sich selbst haben und leichtere Opfer sind.
Man könnte auch sagen: Frauen gehen ja freiwillig dorthin und beschließen selbst, wie viel sie trinken. Wir sind alle bis zu einem gewissen Niveau frei in unseren Entscheidungen. Aber wir alle unterwerfen uns auch sozialen Normen. Diese Partys sind die großen Studierendenpartys. Wenn du nicht hingehst, bist du nicht cool. Wenn du nicht trinkst, bist du nicht cool. Wenn du nicht richtig viel trinkst, bist du nicht cool. Es gibt soziale Sanktionen, wenn du da nicht mitspielst. Genauso ist es mit den klassischen Schönheitsnormen: Keiner zwingt uns, unsere Beine zu rasieren oder uns sexy zu kleiden. Aber es nicht zu tun, geht mit sozialen Kosten einher.
Du stellst in deinem Buch eine Frage, über die ich noch lange nachgedacht habe: Im Prozess wird untersucht, ob die Täter im Pelicot-Prozess unter „paraphilen Störungen“ leiden. Darunter fallen sexuelle Vorlieben, die anderen schaden, etwa Voyeurismus, Fetischismus, Pädophilie oder Sadismus. Zu vergewaltigen zählt nicht dazu. Wer vergewaltigt, begeht zwar ein Verbrechen, ist aber psychologisch gesehen „normal“. Wie kann das sein?
Das ist ein blinder Fleck. Vergewaltigung sollte als Abweichung betrachtet werden. Ein Voyeur zu sein oder von feiner Wäsche besessen zu sein, ist eine sexuelle Abweichung. Zu vergewaltigen, aber nicht. Trotzdem denkt natürlich keiner ernsthaft, dass Vergewaltigen normal ist. Aber für viele Männer ist der Unterschied zwischen Sex und Vergewaltigung eben doch kein so großer. Auch die gesellschaftliche Wahrnehmung allgemein ist hier verzerrt.
So erklärst du dir, warum einige der Täter argumentierten, sie hätten Gisèle Pelicot vergewaltigt, weil ihre Frauen gerade keinen Sex mit ihnen haben wollten. Auch ihre Anwälte nutzen dieses Argument in der Verteidigung.
Genau. Die Erfahrung von Sex oder Vergewaltigung ist für viele Männer dieselbe. Der einzige Unterschied sind die rechtlichen Konsequenzen. Das ist tatsächlich von Studien gedeckt. Es erklärt auch, warum viele Inzesttäter gar keine Pädophilen sind, sondern nur Männer, die hier, mit diesem Kind eine gute Gelegenheit hatten, um zu bekommen, was sie wollten. Für die Partnerinnen der Täter heißt das: Es war ihren Partnern egal, ob sie Sex mit ihnen hatten oder mit dem regungslosen Körper von Gisèle Pelicot. Die Täter sagten im Gerichtssaal selbst immer wieder, dass sie wie tot aussah. Ich fand diese Erkenntnis persönlich erschütternd, aber auch intellektuell herausfordernd. Denn in meinem letzten Buch „Das Gespräch der Geschlechter“ argumentiere ich, dass es ein Fehler ist zu sagen: „Vergewaltigung ist Sex ohne Zustimmung.“
Das musst du genauer erklären.
Zu sagen, Vergewaltigung ist einfach nur Sex ohne Zustimmung, geht von der Vorstellung aus: Einer (in der Regel der Mann) sagt an, der oder meistens eben die andere gibt nach. So ist es aber nicht, Sex ist ein erotisches Gespräch, eine gemeinsame Aktivität. Aber es gibt eben zwei Diskurse über Sexualität, die im Konflikt und Wettbewerb um die Wahrheit sind, nämlich Sex als gemeinsame Aktivität, eine Erotisierung von Gleichheit, und Sex als Dominanz. Viele Männer sehen Sex als etwas, das sie tun, nicht die Frau. Das hat mir der Pelicot-Prozess sehr deutlich bewusst gemacht.
Redaktion: Rico Grimm, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Iris Hochberger und Christian Melchert