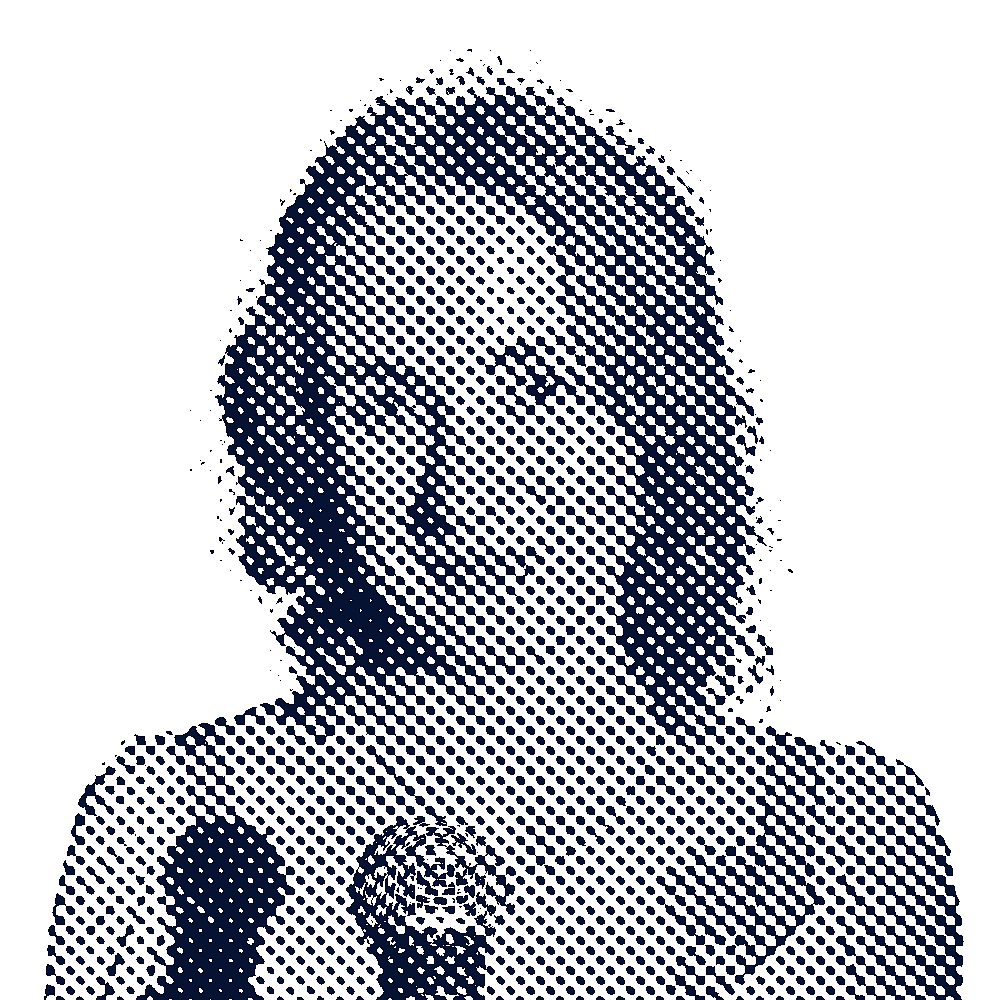Eigentlich brauchte Sam von seiner Therapeutin nur einen Zettel. Sam ist 24 Jahre alt, trans und heißt eigentlich anders.
Er hat Brüste, obwohl er ein Mann ist. Wie viele trans Männer fühlt er sich im eigenen Körper oft nicht wohl. Manchmal braucht Sam eine Stunde, um zu entscheiden, welches T-Shirt sich okay anfühlt, um aus dem Haus zu gehen. Denn unter Menschen fürchtet er, sie würden in ihm eine Frau sehen, weil er kurvig ist. Gerade im Sommer, wo er nicht so viele Schichten tragen kann, ist seine Angst besonders groß.
Sam suchte eine Psychotherapeutin, damit sie ihm ein Schreiben für die Krankenkasse ausstellt. Nur dann übernimmt die Kasse die operative Entfernung seiner Brüste, auch Mastektomie genannt. Diese Operation lindert die Ängste, die Sam jeden Tag erlebt.
Seine Hausärztin empfahl ihm eine Therapeutin, die besonders einfühlsam sein sollte. Gleich in der ersten Sitzung sagte sie Sam, sie könne ihm ein sogenanntes Indikationsschreiben geben, in dem sie der Krankenkasse erklärt, warum sie eine Brustamputation für notwendig erachtet. Sam hatte ein halbes Jahr lang nach einer Therapeutin gesucht, die ihn dabei unterstützt und war glücklich, endlich eine gefunden zu haben. Er vertraute sich ihr an, erzählte ihr, dass er in seiner Kindheit missbraucht worden sei. Sie hörte zu.
Im Interview erzählt er, wie sie ihm in der sechsten oder siebten Therapiesitzung eröffnete, dass er kein Indikationsschreiben von ihr bekommen würde. Sam war schockiert. „Es kam so plötzlich, dass sie ihre Meinung geändert hat“, sagt er heute, sechs Monate später. In der Sitzung sagte seine Therapeutin zu ihm, dass es ihm nicht schlecht genug gehe, um eine solche Operation zu rechtfertigen; dass er nicht trans genug wäre, weil er keinen Penis möchte. Und sie setzte noch einen drauf: Sam sei nur trans, weil er vergewaltigt wurde. Sie argumentierte anhand von Details seiner Vergewaltigung, dass er sich dieses Trauma nur einredete, trans zu sein. So schildert Sam es heute.
Sam weinte schon im Gespräch sehr stark. Am Anfang versuchte er noch zu widersprechen, dann schaltete er ab, um der Frau nicht weiter zuhören zu müssen, der er bis eben noch vertraut hatte. Nach der Sitzung fuhr er zu seiner besten Freundin, verkroch sich in deren Bett und weinte den restlichen Tag.
Trans Personen sind auf Psychtherapeut:innen angewiesen. Damit sie sich in ihrem Körper wohler fühlen, nehmen viele trans Personen Hormone, später wollen manche durch Operationen Körperteile angleichen, so wie Sam mit seiner Mastektomie. Damit sie diese Behandlung bekommen, brauchen sie Indikationsschreiben von Therapeut:innen.
Außerdem sind viele trans Personen psychisch krank, auch Sam hat Depressionen. Gleichzeitig müssen sie immer wieder erleben, dass Therapeut:innen sie nicht ernst nehmen oder ihnen ihr trans sein absprechen. Das ist oft besonders hart, weil sie bestimmen, ob und wann eine trans Person ihren Körper so anpassen darf, dass er weiblicher oder männlicher aussieht, also mehr ihrem wahren Geschlecht entspricht.
Es gibt keine verlässlichen Zahlen darüber, wie viele trans Personen schlechte Erfahrungen bei der Psychotherapie machen. Aber das Phänomen scheint verbreitet zu sein: Therapie hat in der trans Community einen schlechten Ruf. Für meine Recherche habe ich mit acht Betroffenen gesprochen. Sie alle waren auf der Suche nach therapeutischer Hilfe, wollten über ihre psychischen Erkrankungen sprechen oder begleitend zu ihrer Transition eine Therapie beginnen. Der sichere Hafen, der eine Therapie sein sollte, wurde für sie schnell zu einem unsicheren Ort. Sams Geschichte steht beispielhaft dafür, was das für trans Personen bedeuten kann.
Viele trans Menschen sind außerdem psychisch krank⬆ nach oben
Nur selten sagen Therapeut:innen ihren Patient:innen ins Gesicht, dass sie nicht trans seien, so wie es Sam passiert ist. Was dagegen oft passiert: Eine trans Person macht eine Therapie, weil sie eine Depression hat oder Selbstwertprobleme, Angst- und Zwangsstörungen, Schlafstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen oder suizidgefährdet ist.
All diese psychischen Erkrankungen können sich verstärken, wenn Therapeut:innen glauben, dass ihre Patient:innen nur deshalb eine Depression haben, weil sie als trans Person leben. Oder wie in Sams Fall, dass er nur trans sei, weil er traumatisierende Erfahrungen gemacht hat.
Dabei ist der Zusammenhang anders: Trans Personen müssen tagtäglich mit Anfeindungen kämpfen. Als Reaktion darauf werden viele psychisch krank. Trans Personen gehören einer Minderheit an, die besonders oft gedemütigt wird, sowohl wenn öffentlich darüber gestritten wird, welches Klo jemand wie Sam nun benutzen soll, als auch im Alltag. Wenn Sam konstant mit falschen Pronomen angesprochen wird, ist das für ihn mit einem Stress verbunden, den sich viele kaum vorstellen können. Sein Herz beginnt zu rasen, wenn die medizinische Fachangestellte im Wartezimmer eine Frau aufruft. Er hat Angst, dass sie seinen Nachnamen sagen wird. Sam geht auch deshalb nur noch dann zum Arzt, wenn es sich gar nicht mehr vermeiden lässt. Und er hat einen Notfallkontakt, den er danach anrufen kann, wenn es schlimm gelaufen ist. Bis zu 30 Prozent der trans Personen meiden aus Angst vor Diskriminierung Arztbesuche.
Aber es geht nicht nur um unangenehme Situationen im Alltag: Trans Personen werden besonders häufig sexuell missbraucht oder sogar vergewaltigt, wie Sam es erleben musste. Das sagt Lieselotte Mahler, Leiterin des Referats für sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN).
Sam wurde als Jugendlicher von seinem Sporttrainer missbraucht, weil er anders war, weil er verletzlich war, so schildert er es. Sam, der damals noch anders hieß, trug die Haare kurz und maskuline Klamotten. Er hat sich nirgendwo zugehörig gefühlt, noch kein Wort gefunden, das seine Identität beschreibt. „Mein Trainer hat gesehen, dass ich anders bin, vom Aussehen und von meiner Art her. Aber für ihn war ich trotzdem ein Mädchen, was mich damals sehr beruhigt hat. Heute weiß ich, dass er genau das wollte, ein unsicheres Mädchen. Ich konnte mich nicht schützen und das hat er schamlos ausgenutzt“, sagt Sam.
Nur wenige Therapeut:innen kennen sich mit Transidentitäten aus, das Thema wird bis heute kaum im Studium gelehrt⬆ nach oben
Woran aber liegt es, dass viele Therapeut:innen glauben, trans Personen wären deshalb psychisch krank, weil sie sich einredeten, trans zu sein? Die Ursachen gehen bis auf den Zweiten Weltkrieg zurück.
Während der Vater der Psychoanalyse Sigmund Freud noch 1935 in einem Brief an eine besorgte Mutter schrieb, dass Homosexualität „nichts ist, wofür man sich schämen müsste, kein Laster, keine Entwürdigung, auch keine Krankheit“, sah die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg ganz anders aus. Viele der jüdischen liberalen Analytiker:innen mussten fliehen, viele Arbeiten fortschrittlicher Sexualmediziner:innen wurden vernichtet.
„Es gab einen großen Rückschritt in der amerikanisch geprägten Psychoanalyse und das bis heute“, sagt Mahler. Psychoanalytiker:innen wie Colette Chiland sehen in Transgeschlechtlichkeit eine narzisstische Störung. Ihr Artikel über die „transgeschlechtliche Fantasie“ erschien 2000 im International Journal of Psychoanalysis.
Viele Therapeut:innen wären noch immer auf dem Stand, dass trans sein eine Erkrankung sei, sagt Mari Günther vom Bundesverband Trans*. Noch bis 2018 klassifizierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Transsexualität so. Nach lang anhaltender Kritik überarbeitete die WHO ihre Krankheitsklassifikation, erst 2022 trat die Änderung in Kraft.
Dazu kommt: „Ältere Kolleg:innen sind zu einer anderen Zeit sozialisiert worden, da wurden teilweise noch homo- und transfeindliche Theorien unhinterfragt in den Therapieausbildungen gelehrt“, sagt Sabine Maur von der Bundespsychotherapeutenkammer. Bis heute sind trans Identitäten kaum ein Teil des regulären Psychologiestudiums.
Weil Wissen fehlt, haben einige Therapeut:innen Angst, etwas Falsches zu sagen, manche lehnen trans Menschen deshalb ab. Dabei gibt es klare Regeln, wie Therapeut:innen mit trans Patient:innen umgehen sollten. Eigentlich sollen Patient:innen und Psychotherapeut:innen gemeinsam entscheiden, welche Schritte sie einleiten wollen, damit die Patient:in körperlich von einem Geschlecht in ein anderes wechseln kann.
Aber nur wenige Therapeut:innen kennen sich damit aus, was es rund um eine Transition für Möglichkeiten gibt. Sie haben sich noch nie mit Hormonbehandlungen, Pubertätshemmern, geschlechtsangleichenden Operationen oder Stimmtherapie beschäftigt. Dann werden also ihre Patient:innen zu Expert:innen, denen sie vertrauen müssen – für viele ein ungewohntes Gefühl. Gerade deshalb ist es wichtig, dass schon im Studium darüber informiert wird. Psychologiestudentin Emy ist selbst trans. Sie sagt: „Über Transidentitäten zu sprechen, muss fest im Lehrplan verankert werden. Und für approbierte Therapeut:innen braucht es verpflichtende Schulungen. Trans Personen haben ganz eigene Versorgungsbedarfe.“
Sam findet es entmündigend und einfach absurd, dass Therapeut:innen in dieser Machtposition sind, über die Körper anderer Menschen entscheiden zu dürfen. Dass sich daran so schnell etwas ändern wird, glaubt er nicht, deshalb wünscht er sich, dass Therapeut:innen sich ihrer Macht bewusst werden. Dass sie damit verantwortungsvoll umgehen, aber auch lernen, dass sie keine Verantwortung für die Entscheidungen übernehmen müssen, die ihre Patient:innen treffen.
Sam hat die Reaktion seiner Therapeutin schwer getroffen⬆ nach oben
Für viele ist es ein langer Prozess, sich einzugestehen, dass sie tatsächlich trans sind. Immerhin hängt daran die komplette Geschlechtsidentität. „Für eine besonders sichere Entscheidung muss es Raum für Unsicherheiten und Zweifel geben, die bei der Person vielleicht auch tatsächlich vorhanden sind“, sagt Lieselotte Mahler. Wenn Therapeut:innen aber mit solchen Identitäten wenig anfangen können, sehen sie Zweifel nicht als einen normalen Teil des Weges an. Sondern als eine Bestätigung, dass die Person sich ihr trans sein nur einredet.
Wäre Sam vor zwei Jahren bei seiner Therapeutin gewesen, hätte er sich nach dem einschneidenden Gespräch mit ihr wohl komplett hinterfragt, sagt er heute. „Wenn du noch keinen Namen dafür hast, ist Therapie kein sicherer Ort für dich.“
Nach dem Gespräch mit seiner Therapeutin konnte sich Sam morgens kaum aufraffen aufzustehen. Nichts ergab mehr einen Sinn.
Nie zuvor hatte er über seine Missbrauchserfahrungen in der Jugend gesprochen. Es hat ihn so viel Mut und Kraft gekostet, sich zu öffnen und dann der Schock: „Davor hatte ich immer am meisten Angst, dass Therapeut:innen mein trans sein als eine Flucht vor meinem Trauma verstehen und mir meine Identität absprechen“, sagt er. Seine Therapeutin habe in ihm eine verwirrte, verletzte Frau gesehen, die einen Ausweg aus einer schlimmen Situation suche.
Seine Mastektomie rutschte plötzlich in weite Ferne. Er hatte die Hoffnung verloren. Dass er nicht aufgegeben hat, hat Sam seinen Freund:innen zu verdanken, die ihn in der Zeit viel unterstützt haben. Um im Spiegel die Person zu sehen, die er von innen ist, traf Sam eine Entscheidung: Er wird die Operation selbst bezahlen.
Sich die Brust entfernen zu lassen, kostet in der Regel zwischen 5.500 und 7.000 Euro. Sam hat einen Termin im Herbst bekommen. Für die OP musste er sich Geld von seiner Familie leihen. Und er wird wohl auch länger Philosophie studieren müssen, da er nun auch mehr arbeiten muss, um die Summe zusammenzutragen.
Sam hat mittlerweile einen neuen Psychotherapeuten gefunden. Er macht eine Verhaltenstherapie mit Fokus auf Traumabewältigung begleitend zu seiner Transition. Direkt in der ersten Sitzung hat er erzählt, was ihm mit seiner alten Therapeutin passiert ist. Sams neuer Therapeut war schockiert. Das war transfeindlich, sagt er und dass es niemals in Ordnung sei, die Traumata eines Patienten, einer Patientin zu nutzen, um seine Identität zu relativieren. Sam hat das Gefühl, ihm vertrauen zu können. Er fühlt sich wieder sicher in der Therapie.
Redaktion: Rebecca Kelber, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert