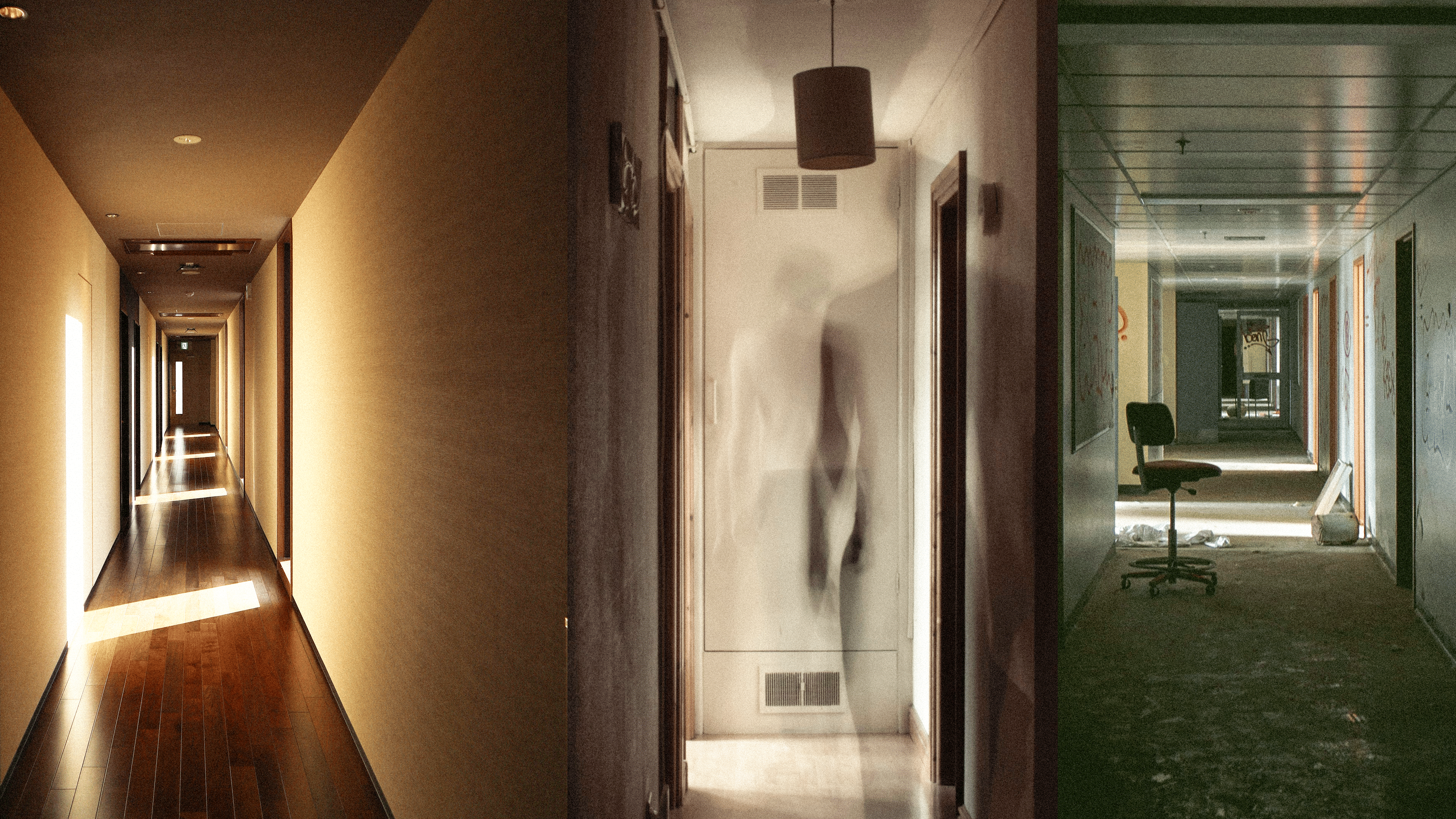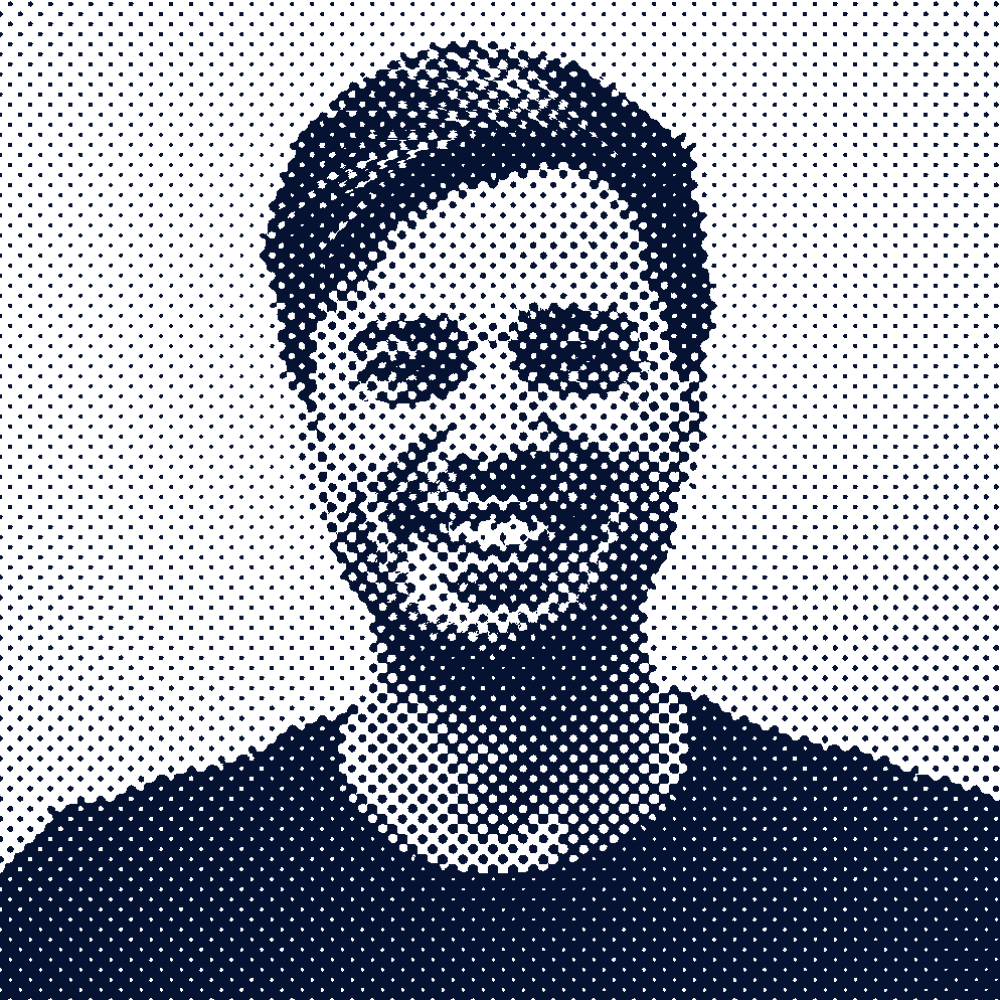Die Wohnungskrise ist das größte soziale Thema unserer Zeit. Könnte es sein, dass es sich von allein erledigt?
Ein erster, oberflächlicher Blick auf Statistiken legt diese Frage nahe.
- Keine andere Generation bewohnt so große Wohnungen und Häuser wie die sogenannten Babyboomer, die zwischen 1954 und 1969 geboren wurden. Jeder vierte alleinstehende Mensch über 65 Jahre wohnt auf mehr als 100 Quadratmetern.
- Die Boomer stellen die größte Generation dar: 19,5 Millionen Babyboomer gehen in den nächsten zehn Jahren in Rente. Der Arbeitsort bindet sie dann nicht mehr an ihre Wohnung.
- Diese Generation erreicht zunehmend das Alter, in dem Krankheit und Tod sie zum Auszug zwingen.
Wenn die geburtenstarken Jahrgänge ihre Wohnungen und Häuser verlassen, wird Wohnraum frei, der oft jahrzehntelang belegt war. Dieses zusätzliche Angebot müsste doch die Lage auf dem Wohnungsmarkt entspannen, oder?
Babyboomer ziehen nicht aus ihren Wohnungen aus⬆ nach oben
Immer mehr Babyboomer gehen in Rente. Sie könnten also unabhängig vom Arbeitsort umziehen. Aber die Umzugsbereitschaft nimmt mit dem Alter drastisch ab. Selbst wer umziehen will, findet kaum passenden Ersatz, der sich auch langfristig eignet: Deutschland fehlen über 2,2 Millionen barrierefreie Wohnungen laut Pestel Institut. Und wer einen alten Mietvertrag oder eine abbezahlte Immobilie hat, dürfte sich die aktuellen Marktpreise kaum antun wollen.
Die Wohnungen werden zum Großteil also erst frei, wenn ihre Bewohner sterben oder pflegebedürftig werden. Was passiert dann?
Neuvermietungen treiben aktuell die Preise. Die Angebotsmieten stiegen bundesweit von 6,60 Euro (2013) pro Quadratmeter auf 9,65 Euro aktuell. München (22 Euro) und Berlin (14 Euro) überbieten diesen Durchschnitt deutlich.
Frei werdende Boomer-Wohnungen landen also nicht automatisch als günstiger Wohnraum auf dem Markt. Was mit ihnen passiert, liegt im Ermessen der Vermietenden. Wenn sie sich dafür entscheiden, eine eigentlich bezahlbare Wohnung an die Marktmieten anzupassen, dann geht trotz allem günstiger Wohnraum verloren.
Die explodierenden Angebotsmieten zeigen ja: Auch Besitzer älterer Immobilien nutzen ihre Chance zur Mieterhöhung. Weder Inflation noch Baukrise erklären diesen Anstieg. Es geht um Gewinne.
Der Markt folgt zunehmend einer reinen Finanzlogik⬆ nach oben
Das wird anhand einer Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung deutlich. Diese zeigt, dass in großen Wohnungsbeständen 5,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter ausreichen, um kostendeckend zu vermieten.
Die NGO Finanzwende hat sich in einem Beitrag die Geschäftsberichte von vier großen Wohnungskonzernen angeschaut: Von einem Euro gezahlter Miete flossen 2021 durchschnittlich 41 Cent direkt an die Unternehmen und Investor:innen ab. Das ist eine wichtige Zahl, weil die Recherchen der NGO auch ergaben, dass immer größere Teile des deutschen Wohnungsmarktes in die Hand großer Unternehmen gelangen. Kauften diese im Jahr 2010 noch Wohnungen im Wert von knapp 15 Milliarden zu, waren es zehn Jahre später Immobilien im Wert von 63 Milliarden Euro.
Privatwirtschaftlichen und damit in der Regel gewinnorientierten Unternehmen gehörten 2022 etwa 14 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland. Der Großteil des Marktes, etwa zwei Drittel, wird offiziell von Privatpersonen vermietet. Mit etwas Glück können solche Vermietende auch vermieten, ohne auf die Gewinne zu schielen. Aber das ist reine Spekulation. Ein minimales Gegengewicht bilden im Markt die Wohnungsgenossenschaften, denen aber lediglich neun Prozent der Mietwohnungen gehören.
Der Wohnungsmarkt folgt also zunehmend der Finanzmarktlogik: Wohnraum dient in erster Linie nicht dem Wohnen, sondern dem Gewinn. Entsprechend werden Mieten erhöht und hohe Mieten locken Investor:innen an, die wiederum die Immobilienpreise treiben und höhere Mieten nötig machen – ein sich selbst verstärkender Kreislauf.
Es hängt an der privaten Entscheidung der Vermietenden⬆ nach oben
Diese Dynamik frisst bezahlbaren Wohnraum, wenn Wohnungen wieder auf den Markt kommen. An dieser Stelle soll theoretisch die Mietpreisbremse greifen. Doch die wirkt kaum, weil sie zum einen etliche legale Schlupflöcher bietet oder Vermietende sie einfach ignorieren. Mietende sind gleichzeitig zu schlecht informiert über ihre Rechte, und selbst wenn das nötige Wissen vorhanden ist, entscheiden sich nur die allerwenigsten für die juristische Auseinandersetzung mit den eigenen Vermietenden mitten in einer Wohnkrise.
Ob die Wohnungen der Babyboomer in den Städten als bezahlbarer Wohnraum wieder auf dem Markt landen, ist somit oft die individuelle Entscheidung der Vermietenden. Und da die Vermietenden zunehmend vor allem auf Gewinne schielen, anders als etwa Baugenossenschaften oder gemeinnützige Wohnungsbauunternehmen, wird bezahlbarer Wohnraum verschwinden.
Aber bringt nicht auch teurer Wohnraum Entlastung? Die Theorie dahinter: Beispielsweise Mittelschichtsfamilien ziehen ein und machen ihre bisherigen Wohnungen frei, in die dann ja andere einziehen könnten – der sogenannte „Sickereffekt“. Die Erzählung vom Sickerffekt ist aber mehr Glaube als Wirklichkeit. Wissenschaftler:innen betonen, dass er empirisch kaum nachzuweisen ist. Denn nur weil eine Wohnung frei wird, heißt das eben nicht, dass diese als bezahlbarer Wohnraum auf dem Markt landet.
Damit der Wohnraum der Boomer den Markt entspannt, müssten mehrere Faktoren zusammenkommen: Bezahlbarer Wohnraum müsste geschützt werden, Städte müssten an Beliebtheit und damit an Einwohnenden verlieren und spekulativer Leerstand müsste effektiv verhindert werden. Doch allein dass eine derartige Stadtflucht einsetzt, dass es in den Ballungsgebieten zeitnah zu Preisverfall bei den Mieten kommt, ist nicht absehbar. Die Umzugsstudie der Deutschen Post 2024 kommt zu dem Schluss: „Städter ziehen hauptsächlich in Städte, Dorfbewohner bleiben auf dem Land.“
Warum die Preise auf dem Land einbrechen könnten⬆ nach oben
In strukturschwachen, eher ländlichen Regionen wird sich allerdings als Erstes zeigen, was die Boomerwelle ebenfalls bedeutet: Wo Wohnraum frei wird und keine Nachfrage existiert, droht Preisverfall.
Der Ökonom und Autor Daniel Fuhrhop warnt: „2040 bzw. 2050 wird es einen Crash geben. Vor allem Einfamilienhäuser werden unverkäuflich sein.“
Bei fallenden Preisen wird man seine Immobilie schwieriger los. Gleichzeitig verlieren die Besitzenden Vermögen, weil die Immobilien im Wert sinken. Auf dem Land also wird die Babyboomer-Welle spürbare Folgen haben. Aber auch in den Städten ließe sich mehr Wohnraum schaffen – und zwar mit den Babyboomern zusammen.
Welche Sofortlösungen es für die Städte gibt⬆ nach oben
Ökonom Fuhrhop untersucht seit Jahren den sogenannten unsichtbaren Wohnraum und hat darüber auch seine Doktorarbeit verfasst. Damit meint er ungenutzte Flächen, wie leere Zimmer oder unvermietete Einliegerwohnungen, die insbesondere bei den Babyboomern zu finden sind.
Würde man all diesen Raum nutzen, könnte jährlich Wohnraum in der Größenordnung von etwa 100.000 Wohnungen mobilisiert werden.
Fuhrhop hat konkrete Vorschläge, die er unter der Formel 3U&VW bewirbt: Untermiete, Umzug, Umbau, Vermietung und gemeinschaftliches Wohnen.
Das Besondere an Fuhrhops Lösungsansätzen ist, dass er diejenigen mit überschüssigem Wohnraum nicht allein lassen will. Er empfiehlt kommunale oder durch freie Träger organisierte Strukturen, die beispielsweise „Wohnen für Hilfe“ vermitteln, Wohnungstauschprogramme organisieren und beim Umbau unterstützen.
Fuhrhop sieht keine böswillige Absicht darin, dass Menschen mehr Wohnraum besetzen, als sie brauchen: „Wenn jemand auf 120 oder 150 Quadratmetern allein wohnt, ist das in der Regel keine freiwillige Entscheidung. Dann ist da jemand ausgezogen oder vielleicht sogar verstorben oder man hat sich getrennt.“
Diejenigen, bei denen ganze Wohnungen leer stünden, scheuten sich oftmals vor Risiken und Komplikationen, die mit der Vermietung einhergingen. Nach Fuhrhop könnten Vermietende dabei von der Kommune abgesichert werden und so weniger Risiko beispielsweise für Mietausfälle tragen.
Fuhrhops Ansätze können den Mietenwahnsinn nicht stoppen und sie werden nicht verhindern, dass bezahlbarer Wohnraum verloren geht, weil Vermietende und Verkaufende Gewinne machen wollen. Doch mit dem Potenzial von 100.000 Wohnungen kann seine Idee sehr vielen Menschen auf Wohnungssuche helfen.
Kommunen könnten das jetzt angehen. Sofort. Auch ohne dass auf Bundesebene wirksame Gesetze gegen den Mietenwahnsinn verabschiedet werden.
So könnte der Wohnraum der Babyboomer schon heute eine Hilfe in der Wohnkrise sein – ohne dass die Jüngeren darauf geiern müssen, dass die Babyboomer ins Pflegeheim oder auf den Friedhof kommen.
Redaktion: Rico Grimm Schlussredaktion: Susan Mücke Fotoredaktion: Gabriel Schäfer, Audioversion: Iris Hochberger