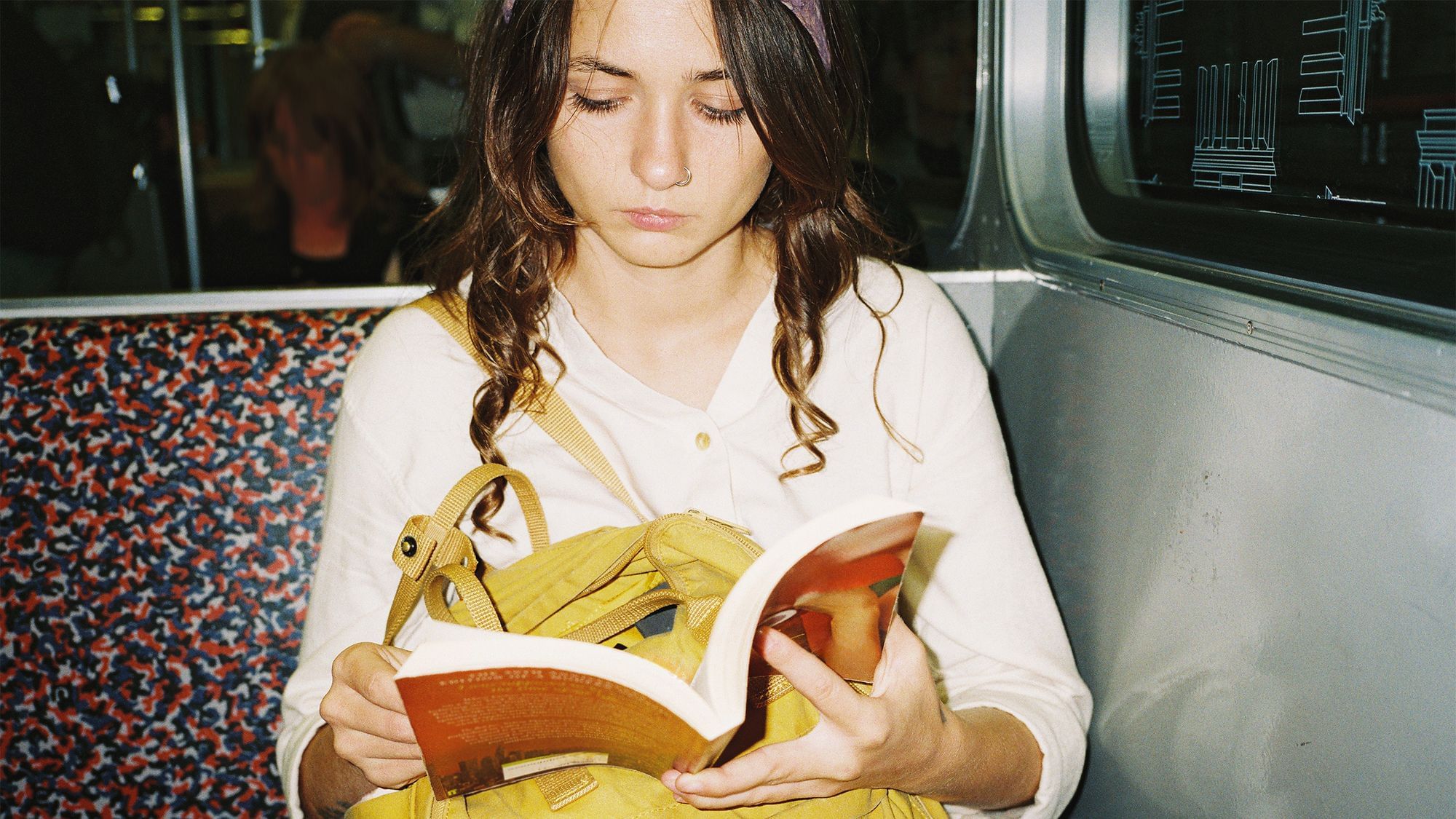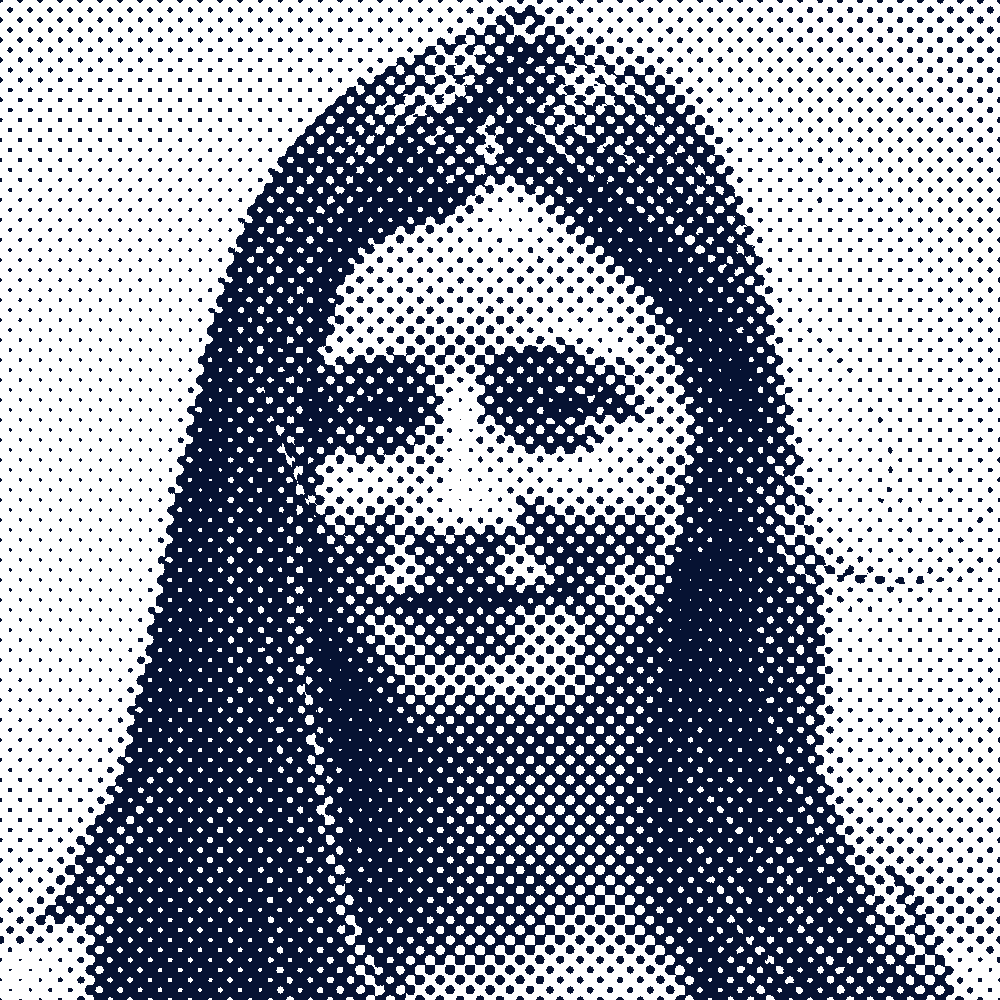Die Weltlage mag schon immer düster gewesen sein, aber gerade verfinstert sie sich besonders. Unsere Leser:innen fragen deshalb immer wieder nach Perspektiven, die ihnen Hoffnung machen. Wir haben in der Redaktion und der Krautreporter-Community Bücher gesammelt, die helfen, optimistischer nach vorne zu blicken.
Wenn du denkst, die Menschen sind schlecht
Im Grunde gut von Rutger Bregman
Rebecca Kelber
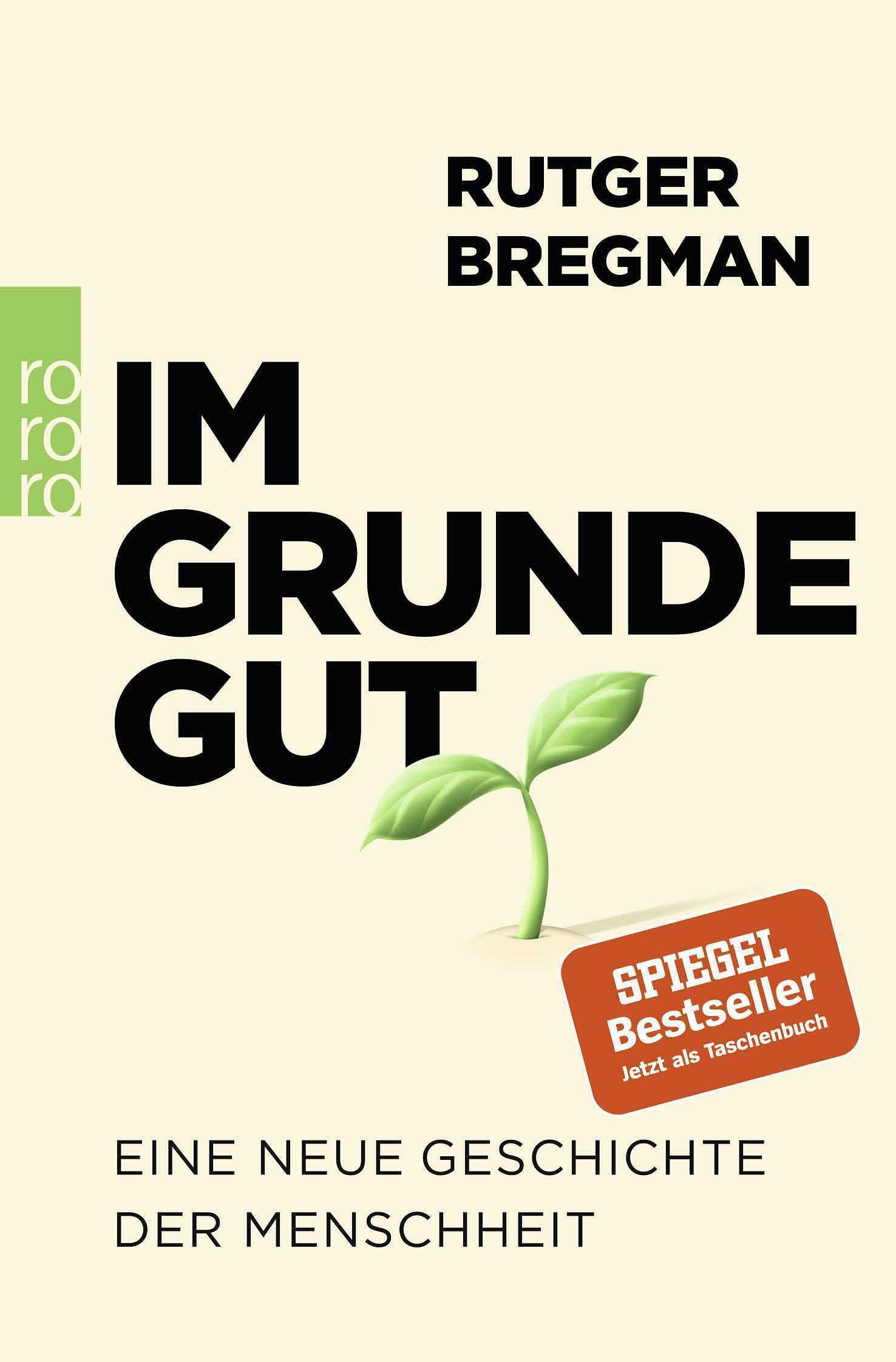
Schon lange hat mich kein Sachbuch so begeistert wie das von Bregman. Das scheint nicht nur mir so zu gehen: Kein anderes Buch wurde in meiner Umfrage so häufig genannt wie dieses. Ich hatte dort gefragt, welche Bücher den Krautreporter-Leser:innen Hoffnung gegeben haben.
Der Historiker Rutger Bregman argumentiert, warum der Mensch nicht unter einer dünnen Schicht von Zivilisation verdorben, sondern eben im Grunde gut ist. Mir fiel das beim Lesen immer wieder schwer zu glauben. Zum Glück nennt Bregman zahlreiche Beispiele und widerlegt dabei einige Geschichten, von denen ich auch schon gehört hatte. So schießen zum Beispiel gar nicht viele Soldaten auf ihren vermeintlichen Feind. Selbst die meisten Veteranen des Zweiten Weltkriegs haben nie jemanden getötet. Und das berühmte Stanford Prison Experiment von 1971, das vermeintlich zeigt, wie schnell aus normalen Menschen Sadist:innen werden? Da hat der Studienleiter mit unlauteren Mitteln die Teilnehmer:innen bedrängt, sadistisch zu handeln.
Die große Frage bleibt: Warum tut ein eigentlich gutes Tier wie der Mensch so unglaublich grausame Dinge? An der Stelle wurde Bregman herrschaftskritisch: Das Problem sei die moderne Zivilisation und unsere angeborene Fremdenfeindlichkeit. So richtig überzeugt hat er mich damit nicht, denn mir hat abgesehen von der strukturellen Antwort auch eine individuelle gefehlt: Sind Menschen unterschiedlich schlecht und wenn ja, warum? Trotzdem lässt mich das Buch optimistischer in die Zukunft blicken.
A Paradise Built in Hell von Rebecca Solnit
Isolde Ruhdorfer
Als Usman Farman, ein Mann aus Pakistan, aus dem World Trade Center floh, stolperte er und fiel hin. Es war der 11. September 2001, der Tag der Terroranschläge von Al-Qaida, bei denen fast 3.000 Menschen starben. Die Türme des World Trade Centers waren kurz davor einzustürzen. In diesem Moment nahm ein ultraorthodoxer Jude Farmans Hand und half ihm auf. Gemeinsam flohen sie aus dem Gebäude. „Er war die letzte Person, von der ich je gedacht hätte, sie würde mir helfen“, sagte Farman später. „Wenn er nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich von Glasscherben und Trümmern verschlungen worden.“ Das ist nur eines von unzähligen Beispielen, in denen Menschen sich in Extremsituationen gegenseitig geholfen haben.
Wenn Menschen in Lebensgefahr sind, werden sie egoistisch und unmenschlich. Das dachte ich lange, bis ich dieses Buch der US-amerikanischen Autorin Rebecca Solnit gelesen habe. Sie beschreibt darin verschiedene Katastrophen, vom Erdbeben in San Francisco 1906, über den Terroranschlag von 2001 bis zum Hurrikan Katrina 2005. Solnit beschreibt, wie Regierungen und Staatsgewalt immer wieder davon ausgingen, dass die Extremsituationen zu Plünderungen und Morden führen würden. Dabei war genau das Gegenteil der Fall: Jedes Mal bildeten sich Gemeinschaften und die Menschen halfen sich gegenseitig. Selbst dann, wenn sie zunächst keine besondere Beziehung zueinander hatten, wie etwa die Arbeitskolleg:innen im World Trade Center.
Dieses Buch hat grundlegend verändert, wie ich über das menschliche Wesen und über Extremsituationen denke. Menschen helfen einander. Selbst wenn sie dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen.
Besonders überraschend fand ich, dass sich manche Menschen sogar mit positiven Gefühlen an die Katastrophen zurückerinnern. Natürlich wünschen sie sich nicht ein Ereignis wie ein Erdbeben zurück, bei dem manchmal Tausende Menschen sterben. Aber sie sehnen sich nach der Gemeinschaft, der Hilfsbereitschaft und der Solidarität, die sie im normalen Alltag nicht spüren. Wer verstehen will, wie Menschen zusammenarbeiten und wie sich echte Gemeinschaften bilden, sollte dieses Buch lesen.
Das Buch ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen.
Wenn dir die Klimakrise Angst macht
The Wizard and the Prophet von Charles C. Mann
Rico Grimm
Dieses Buch erzählt die Geschichte zweier einflussreicher Menschen, die die Welt verändert haben – aber heute so gut wie vergessen sind.
Charles C. Mann erzählt die Lebensgeschichte der beiden Wissenschaftler Norman Borlaug und William Vogt als eine große, inspirierende Parabel, die immer wieder um eine Frage kreist: Wie kann die Menschheit ihr Überleben auf diesem Planeten sichern?
Für William Vogt war die Sachlage in den 1940er Jahren klar: Der Planet gelangt an seine Grenzen. Die Menschen rauben den Tieren immer mehr Lebensraum, laugen die Böden aus und vergiften die Gewässer. Darauf muss die Menschheit mit Zurückhaltung reagieren und eine neue Balance suchen. Vogt wurde zu einem der Begründer der modernen Umweltbewegung, der einzigen großen politischen Bewegung des 20. Jahrhunderts, die auch noch im 21. Jahrhundert wichtig ist.
Auch der Agrarwissenschaftler Norbert Borlaug sah in den 1940er Jahren natürliche Grenzen. Die Landwirtschaft konnte die wachsende Weltbevölkerung kaum noch ernähren. Also züchtete er in mühsamer Handarbeit eine Weizensorte, die ertragreich an vielen Standorten und vor allem resistent gegen einen Rostpilz war, der regelmäßig die Weizenernten minderte. Seine Forschung wurde zum Grundstein der Grünen Revolution, durch die in den 1960er Jahren auch Länder wie Indien ihre Bevölkerung mit Weizen und Reis versorgen konnten.
Die Ansätze beider Männer spiegeln eine Debatte, die heute schärfer ist denn je: Retten wir die Menschheit durch technologischen Fortschritt oder durch radikales Umdenken? In der Klimakrise brauchen wir genau diese beiden Perspektiven – den Erfindungsgeist eines Borlaug und den systemischen Blick eines Vogt. Und wir brauchen den Glauben beider Wissenschaftler, dass Veränderungen möglich sind.
Das Buch ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen.
Hoffnung für Verzweifelte von Hannah Ritchie
Rebecca Kelber
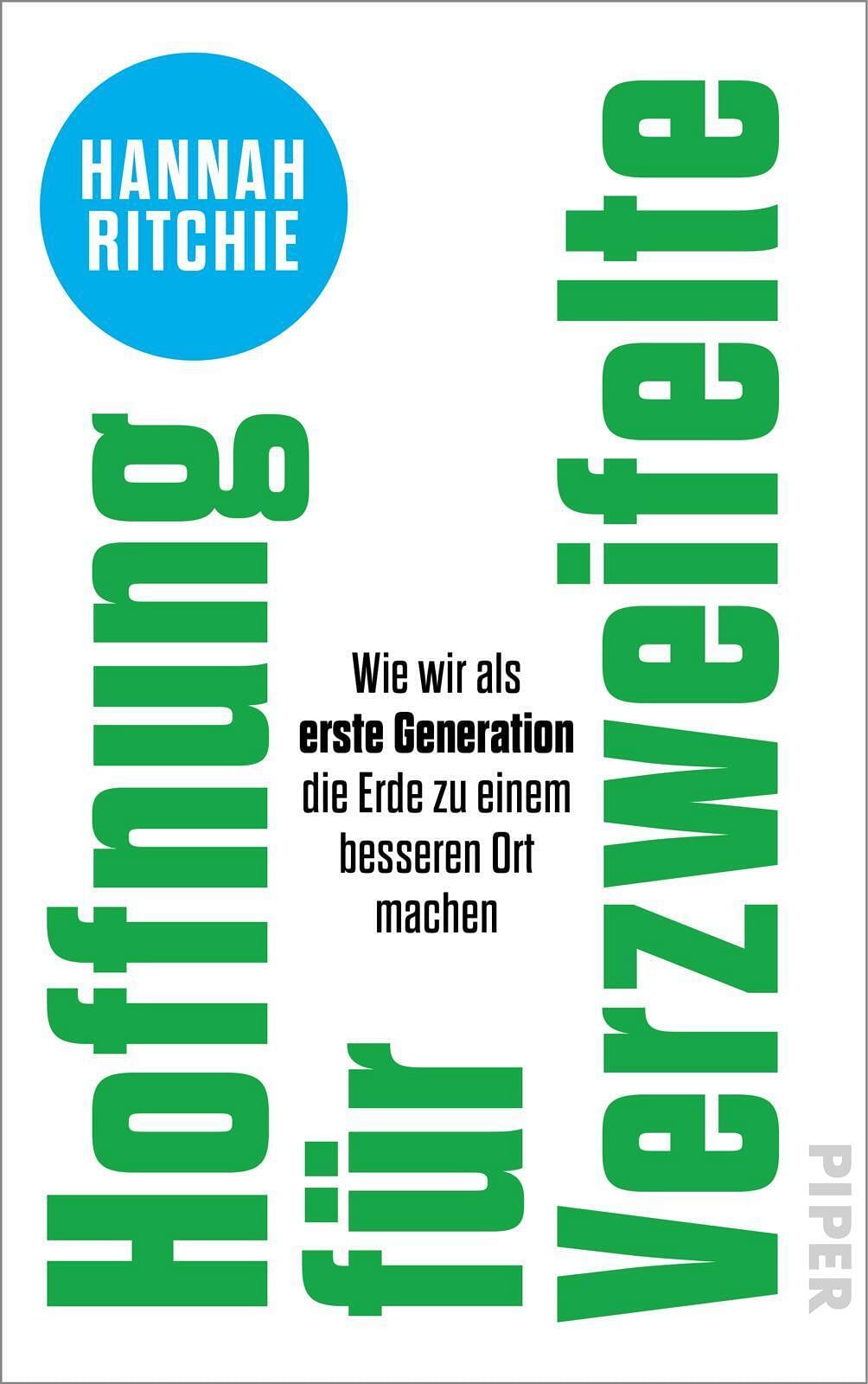
Von diesem Buch habe ich nur dank der Krautreporter-Community erfahren. Die Datenwissenschaftlerin Hannah Ritchie beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Klimakrise und war kurz davor aufzugeben, bis sie auf das Werk von Hans Rosling stieß, der mit Statistiken zeigt, dass die Welt gar nicht immer schlechter wird, sondern in vielen Bereichen besser. So hat sich die Kindersterblichkeit auf der Welt seit 1990 mehr als halbiert, genauso wie die Zahl derer, die in absoluter Armut leben. Das hat ihr den Mut gegeben, weiterzumachen und genau das will sie mit diesem Buch anderen vermitteln. Ritchie glaubt, dass die Einstellung von Aktivist:innen wie der Letzten Generation, die Welt stehe kurz vor dem Untergang, viele eher lähmt, statt ermutigt.
Dabei will sie die ökologische Krise nicht kleinreden, im Gegenteil: Im Buch beschreibt sie detailliert die Umweltprobleme, von Luftverschmutzung über Klimawandel bis zur Überfischung der Meere. Sie zeigt viele Statistiken, die verdeutlichen, wie groß die Probleme sind, aber auch, wie dramatische Schlagzeilen die Wirklichkeit verzerren. Das Buch ist lösungsorientiert, am Ende jedes Kapitels gibt es einen Überblick, welche Maßnahmen helfen würden. Es ist erleichternd, wie sie die abstrakte Gefahr der Klimakrise in kleinen Happen begreifbar macht und auch, dass sie auf Punkte hinweist, wegen derer man sich weniger stressen muss.
Weltuntergang fällt aus von Jan Hegenberg
Rico Grimm
Es gibt so viele Zweifel an der Energiewende, dass es schade ist, dass wir sie nicht in Strom umwandeln können. Denn dann hätten wir die Energiewende schon längst gemeistert.
Das wichtigste Bedenken: Viele Menschen, darunter auch einige Mitglieder von Krautreporter, können sich nur schwer vorstellen, dass wir eines Tages ein hoch industralisiertes Land wie Deutschland ausschließlich mit Energie aus CO₂-freien Quellen versorgen können.
Diese Skepsis ist gut, weil sie zeigt, wo Wissenschaft und Wirtschaft noch bessere Antworten liefern müssen. Diese Skepsis ist aber auch schlecht, weil sie verdeckt, wie weit wir eigentlich schon bei der Energiewende gekommen sind und was bald alles möglich sein wird. Selbst ich werde davon immer wieder überrascht – und bisher hat noch niemand in meinen Augen die gerade entstehende Energiewelt besser, unterhaltsamer und leichter verständlich auf den Punkt gebracht als Jan Hegenberg.
Auf Krautreporter findest du ein Kapitel aus dem Buch.
Wenn du an dir selbst verzweifelst
… trotzdem ja zum Leben sagen von Viktor Frankl
Rebecca Kelber
Man muss nur ein paar Stichpunkte über diesen österreichischen Psychologen wissen, um zu verstehen, wie beeindruckend und inspirierend sein Leben war. Viktor Frankl war Jude und in mehreren Konzentrationslagern inhaftiert, darunter im Vernichtungslager Auschwitz. Seine Eltern, sein Bruder und seine Frau überlebten den Holocaust nicht.
Wenn er im KZ nicht gerade darüber nachdachte, wo er bloß ein Stück Brot herbekommen sollte, stellte er sich vor, wie er später Vorträge darüber halten würde, was dieses Leben mit der Psyche der Menschen macht.
Darum geht es in diesem Buch: Wie die Inhaftierten nach dem ersten Schock des Ankommens abstumpfen, nach ein paar Tagen nichts spüren, selbst wenn sie sehen, wie ein SS-Kommandant einen Häftling verprügelt. Wie sie trotzdem Witze machen, sogar hin und wieder einen Kabarettabend veranstalten, um diesen Alltag auszuhalten. Vor allem aber, dass jene überlebten, die einen Sinn im Leben sahen, seien das nun die geliebten Menschen, die sie zurückgelassen hatten oder eine Arbeit, die ihrem Leben Bedeutung gab. Frankls Fazit: Nicht das Wie, sondern das Warum ist entscheidend. Und so hat er auch nach dem Holocaust weitergelebt, ein zweites Mal geheiratet, sich für Versöhnung eingesetzt, viele Bücher geschrieben und die Logotherapie begründet.
Die eigenen Sorgen erscheinen winzig im Vergleich zum Leben dieses Mannes und gerade deshalb hat es mir Hoffnung gemacht: Wenn jemand wie er ein gelungenes und sinnvolles Leben führen kann, warum sollten wir das nicht alle können?
Der Welt nicht mehr verbunden von Johann Hari
Rebecca Kelber
Es ist schon einige Jahre her, dass ich dieses Buch gelesen habe und trotzdem denke ich immer wieder daran. Es ist auch eines der Lieblingsbücher von Krautreporter-Mitglied Susie. Der Journalist Johann Hari war seit seiner Jugend depressiv, nahm schon früh Antidepressiva. Die Ärztin erklärte ihm damals, er habe einfach einen Serotoninmangel im Gehirn. Was für ein Quatsch das ist, fand er erst viele Jahre später heraus – und erklärt in diesem Buch, warum.
Hari redete mit vielen Forscher:innen, die ihm darlegten, wie Depressionen entstehen und warum Antidepressiva in vielen Fällen nicht wirken. Dabei beschreibt er ihre Forschung so packend, dass es richtig Spaß macht, über Studien zu lesen. Und er hat mich davon überzeugt, dass so viele Menschen auch deshalb unter Depressionen oder Angststörungen leiden, weil sie entfremdet sind: von anderen Menschen, bedeutungsvoller Arbeit, der Natur, ihren Werten. Natürlich spielen auch Genetik und traumatische Erlebnisse in der Kindheit eine Rolle. In der zweiten Hälfte des Buches geht es wie in so vielen modernen Sachbüchern um Lösungsansätze. An einen Ansatz versuche ich immer wieder zu denken: Wenn es dir selbst schlecht geht, helfe einer anderen Person. Denn das gibt ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und lenkt von den eigenen Problemen ab.
Wenn dich die Weltlage mutlos macht
Israel, eine Utopie von Omri Boehm
Ella Strübbe

Der 7. Oktober 2023 ist zu einer Chiffre geworden, für das Leid der Jüd:innen auf der einen und den Befreiungskampf der Palästinenser:innen auf der anderen Seite. Wie kann Frieden aussehen in einem Land, das seit der Staatsgründung Israels, die mit der Vertreibung Hunderttausender Palästinenser:innen einherging, so tief gespalten ist?
Das habe ich mich oft gefragt, und selten habe ich so eine gute Antwort gefunden wie in dem Buch „Israel – eine Utopie“ von Omri Boehm. Der israelisch-deutsche Philosoph plädiert für einen binationalen Staat, in dem Palästinenser:innen und Jüd:innen als gleichberechtigte Staatsbürger:innen nebeneinander leben.
Dafür müssen jedoch mindestens zwei Dinge gegeben sein: Erstens darf sich die Opposition in Israel nicht mehr in Schweigen hüllen, wenn im israelischen Parlament für Annexion und Vertreibung geworben wird.
Zweitens müssen wir den Holocaust vergessen, sagt Boehm. Ja, da sträubt sich auch in mir alles dagegen. Boehm meint jedoch nicht den hierzulande vor allem von Rechts herbeigesehnten Schlussstrich, sondern, dass wir neben dem Holocaust Platz schaffen, um an eine zweite schreckliche ethnische Säuberung zu erinnern: die Nabka, also die gewaltvolle Vertreibung der Palästinenser:innen im Israelischen Unabhängigkeitskrieg 1948. Denn erst, wenn wir das Leid der anderen erkannt haben, ist Frieden in Israel und Palästina mehr als nur eine Utopie.
Everyone Who is Gone is Here von Jonathan Blitzer
Benjamin Hindrichs
Migration ist das politische Megathema der Gegenwart. Flüchtlinge sind die perfekten Sündenböcke für sämtliche gesellschaftlichen Konflikte: Kriminalität, Wohnungsknappheit oder Jobmangel.
In den USA behauptete Donald Trump während des Wahlkampfes, haitianische Migranten würden Hunde essen und wurde erneut US-Präsident. Seither inszeniert er sich als Abschiebechef und ergötzt sich daran, unschuldige Menschen wie Zootiere in Käfige in El Salvador zu stecken. In einem solchen Moment ist „Everyone Who is Gone is Here“ von Jonathan Blitzer ein Buch, das Hoffnung macht. Nicht, weil der New-Yorker-Journalist darin nachzeichnet, wie die USA durch die Unterstützung grausamer Diktaturen jene Konflikte selbst geschürt haben, vor denen die Menschen jetzt fliehen. Sondern weil er die Entstehung der US-Flüchtlingskrise über Jahrzehnte anhand von unglaublich starken Protagonisten erzählt. Die Leute, die er begleitet, haben nie aufgegeben, für die Zukunft zu kämpfen – trotz ermordeter Familienmitglieder, sexualisierter Gewalt, Rassismus und einer Politik, die sie vor allem als Nummern sieht, die man loswerden muss. Blitzer erzählt, wie Menschen sich in diesem Netz aus Gewalt und Ablehnung trotz allem zusammenschließen, um gemeinsam die Menschlichkeit zu verteidigen.
Das Buch ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen.
Weil es sagbar ist: Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit von Carolin Emcke
Benjamin Hindrichs
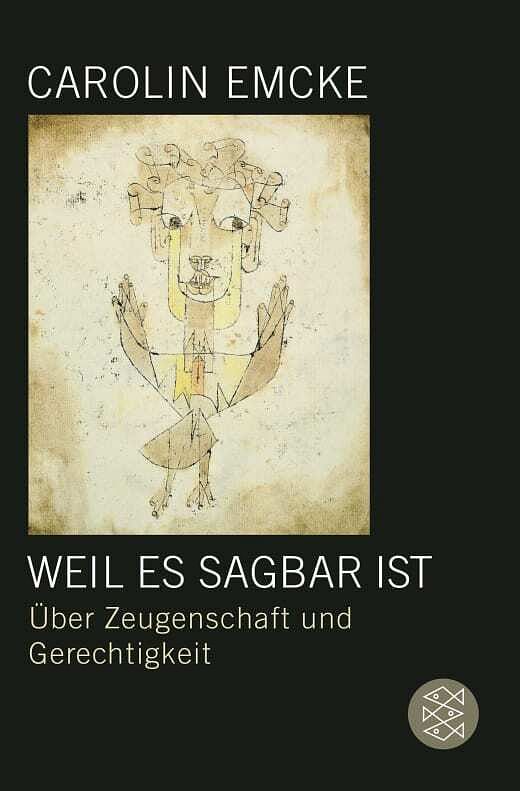
Der Schriftsteller Caleb Azumah Nelson sagt: Wir sollten nicht fragen, was unsere Lieblingsbücher sind, sondern zu welchen wir immer wieder zurückkehren. „Weil es sagbar ist“ von Carolin Emcke ist eines der Bücher. Die Philosophin geht darin der Frage nach, wie wir von Krieg und Gewalt erzählen können, ob es Grenzen des Sagbaren gibt und welche Verantwortung wir als Gesellschaft tragen, die Geschichten der Überlebenden zu erzählen.
Das erste Mal habe ich das Buch während meines Studiums gelesen, als ich für mehrere Monate auf der griechischen Insel Samos als Freiwilliger mit Geflüchteten arbeitete. Das zweite Mal, als ich als Journalist zu sexualisierten Demütigungen von Asylsuchenden an den EU-Außengrenzen recherchierte. Das dritte Mal, als ich einen Film drehte, in dem der Protagonist davon erzählt, wie Musik und Poesie ihm halfen, Folter und Gefangenschaft zu überleben.
Jedes Mal kehrte ich zu „Weil es sagbar ist“ zurück. Jedes Mal half es mir mit vier Dingen: erstens, die Mechanismen zu verstehen, mit denen Gewalt und Entrechtung Menschen durchdringen. Zweitens, meinem Gegenüber einfühlsam zu begegnen und zuzuhören. Drittens, Räume zu schaffen, in denen wir uns vertrauen und Menschen ihre Geschichte ohne Angst teilen können. Viertens, den Mut zu haben, den Überlebenden von Gewalt immer wieder zuzuhören.
Warum das wichtig ist? Weil Erzählen und Zuhören selbst eine Form des Widerstandes gegen die Entmenschlichung sind. In den Worten von Carolin Emcke: „Wenn Opfer von Gewalt das, was ihnen widerfahren war, nicht erzählen könnten, würden Diktatoren und Folterer obsiegen.“
Redaktion: Rebecca Kelber und Isolde Ruhdorfer, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert
Nachtrag, 16.06.2025: In einer vorherigen Version dieses Textes wurde der eine Wissenschaftler im Buch „The Wizard and the Prophet” Norbert Borlaug genannt. Tatsächlich hieß er Norman Borlaug.