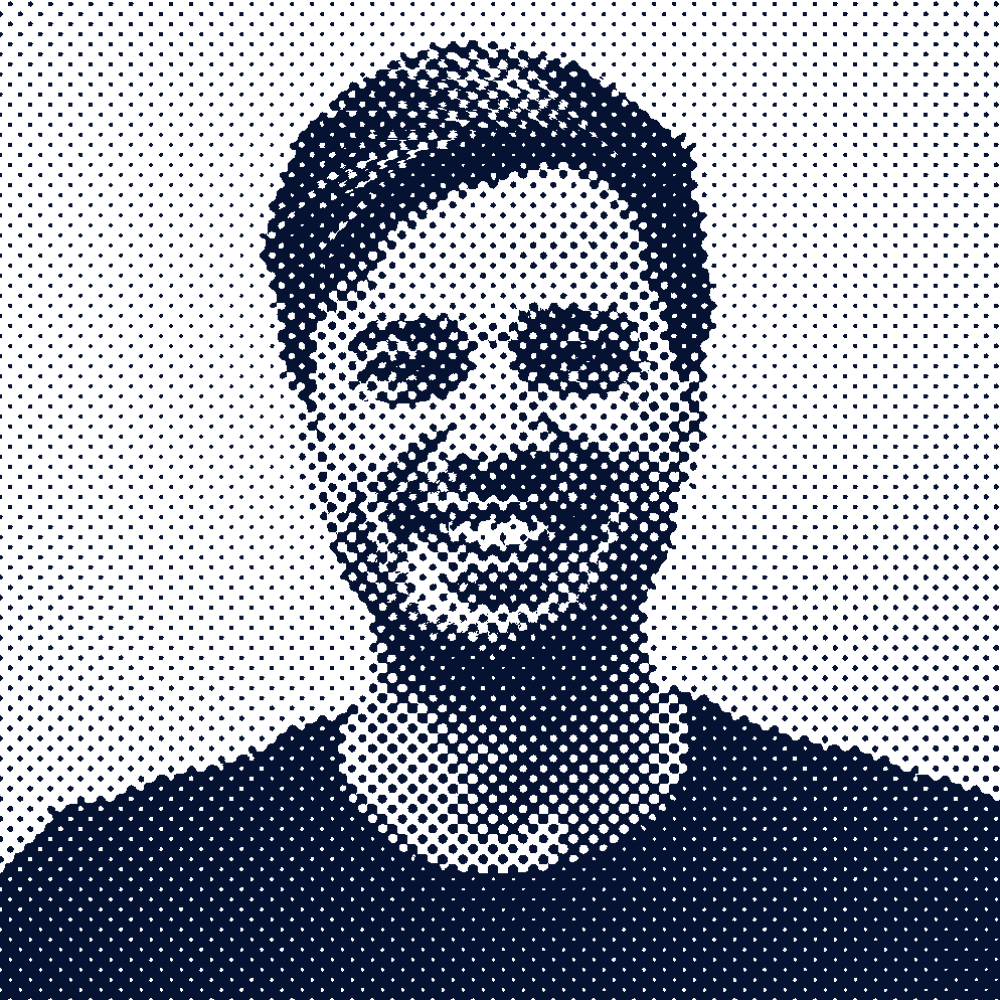Ist es sinnvoll, Parteien zu wählen, die vermutlich an der Fünfprozenthürde scheitern? Mitglieder solcher Kleinparteien werben damit, dass man sie reinen Gewissens wählen könne. Mitglieder großer Parteien behaupten, dass Stimmen für die Kleinen verschenkt seien.
Aus vielen Gesprächen mit euch, der Krautreporter-Community, weiß ich, dass ihr das Dilemma ähnlich seht. KR-Mitglied Alex hat es unter meinem Artikel über taktisches Wählen zur Bundestagswahl 2021 auf den Punkt gebracht: „Wenn ich ‚taktisch‘ gewählt habe, wusste ich, dass die Partei meine Stimme nicht verdient. Und wenn ich nach Inhalt gewählt habe, wusste ich, dass ich meine Stimme verschenkt habe.“
Was tun? Wahlen sind ein Nullsummenspiel. Entweder man wählt eine Partei oder man wählt sie nicht. Eine Entscheidung muss also her.
Ich habe die wichtigsten Argumente zusammengetragen, damit du zu einer Wahlentscheidung kommst – und zeige dir am Ende noch einen Ausweg aus dem Kleinparteien-Dilemma.
Was dafür spricht, eine Kleinpartei zu wählen⬆ nach oben
1. Parteien wirken, ohne im Parlament zu sein
Eine neue Partei tritt auf die Bühne: Sie hat neue Themen, einen interessanten Ansatz und immer mehr Erfolg. Die Presse ist fasziniert, die Wähler:innen sind es auch – und die alteingesessenen Parteien fragen sich, wie groß die Gefahr ist, die von dieser Partei ausgeht. Möglicherweise nehmen sie die Neuen ernst und beginnen, sie zu kopieren und ihre Themen zu kapern.
Das passierte bei den Piraten. Die zunächst als monothematische Digitalpartei gegründeten Piraten erzielten zwischen 2010 und 2012 beachtliche Wahlerfolge. Das motivierte auch die großen Parteien, sich die Themen der Piraten genauer anzusehen und Fachpolitiker:innen für das Thema einzusetzen. Die FDP baute sogar ihren Wahlkampf 2017 auf „Digitalisierung“ auf. Die Piraten setzten also Themen – obwohl sie zum Beispiel gar nicht im Bundestag saßen. Vor den Piraten war Digitalpolitik ein Orchideenthema, nach den Piraten nicht mehr. Das zeigt: Nicht nur auf die Größe kommt es an. Sondern auch auf die Lautstärke.
2. Kleine Parteien führen zur Gründung anderer kleiner Parteien, die vielleicht mal groß werden
Die Freien Wähler aus Bayern mit ihrem Parteichef Hubert Aiwanger sind inzwischen ein fester Bestandteil der Bundespolitik geworden.
Das wären sie beinahe schon vor zehn Jahren geworden. 2012 standen die Freien Wähler Umfragen zufolge kurz davor, in den Bundestag einzuziehen. Auf dem Höhepunkt der Eurokrise kritisierten sie damals die Rettungspolitik der Bundesregierung. Zwei Männer taten sich besonders hervor: Hans-Olaf Henkel und Bernd Lucke. Beide wurden danach in der frühen AfD zu prägenden Figuren. Der Umfragenerfolg der Freien Wähler hatte ihnen gezeigt, dass es eine Lücke in der politischen Landschaft gab, rechts von der Merkel-CDU. Die AfD hat sie geschlossen.
Kleine Parteien sind wie Labore für neue Themen, Parolen und politische Ideen. Manchmal entsteht daraus eine große, neue Partei. Das kann eine AfD sein, muss es aber nicht. Die Grünen starteten auch nicht als Kanzlerkandidaten-Partei.
Krautreporter – die besten Texte 🏅
Dieser Text erschien das erste Mal im Jahr 2021, ist aber bei jeder Wahl wieder relevant. Deswegen habe ich ihn zu den Bundestagswahlen aktualisiert.
3. Deine Stimme bringt Geld
Eine Partei, die mindestens 0,5 Prozent der Stimmen bei einer Bundestags- oder Europawahl oder mindestens ein Prozent bei einer Landtagswahl erlangt, hat Anspruch auf staatliche Parteienfinanzierung. Der Betrag schwankt und liegt bei ungefähr einem Euro pro Stimme. Alle Parteien bekommen diese Förderung, die gesamte Summe ist allerdings gedeckelt. Je mehr Stimmen auf kleine Parteien entfallen, desto weniger bekommen also die Großen.
Für kleine Parteien wiederum ist jeder zusätzliche Euro im Vergleich wichtiger als für die größeren. Sie können damit ihre Strukturen festigen und ausbauen – und so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, bei der nächsten Wahl noch besser abzuschneiden, noch mehr Geld zu bekommen, noch bekannter zu werden und vielleicht irgendwann über die fünf Prozent zu hüpfen.
4. Applaus für das Engagement ist motivierend
Es gibt Kleinparteien, bei denen man sich nicht sicher ist: Ist das Performance, Statement oder wirklich ernst gemeint? Das Interessante ist, dass die Antwort auf diese Frage völlig egal sein kann. Wenn es dir wichtig ist, einen ganz bestimmten Politikstil, eine Weltanschauung oder sogar nur eine einzelne Idee zu fördern, ist jede Stimme ein Signal. Denn was nicht zu unterschätzen ist: Eine Partei lebt von Freiwilligen.
Für diejenigen, die ehrenamtlich aktiv sind, ist eine Stimme Anerkennung für ihre Arbeit.
5. Kleine Parteien dienen als Hebel
Kleine Parteien kannst du auch missbrauchen: Wenn es ein Thema gibt, das bei einer großen Partei zwar vorkommt, aber vielleicht nicht so radikal, wie du es dir wünschst, wählst du den direkten Konkurrenten dieser großen Partei – in der Hoffnung, dass die große Partei selbst radikaler wird. Eine ähnliche Dynamik gab es immer wieder zwischen Linkspartei und SPD im Bundestag.
Niemand muss Memory-Meister sein, um noch ähnliche Paare zu finden, bei denen eine Kleinpartei wie der Punk-Zwilling der großen Partei funktionieren kann.
6. Warum einen Kompromiss machen?
Dieses Argument lässt sich einfach zusammenfassen: „Was solls!“ Wer sich nun einmal am besten mit dem Programm einer bestimmten Partei identifizieren kann, wählt sie einfach. Die Wahrscheinlichkeit, dass genau deine Stimme den Ausschlag geben könnte für die nächste Regierung, ist extrem klein. Du kannst deine Stimme „verschenken“, weil du dir sicher sein kannst, dass Millionen andere Menschen genau das nicht machen.
Was dagegen spricht⬆ nach oben
1. Zersplitterung verhindern
Manchmal kann es einem Thema schaden, wenn es zu viele Parteien aufgreifen, die alle keine Macht haben. Ein Sketch, der einem mehr über dieses Dilemma der Politik beibringt als manche Doktorarbeit, ist diese wunderbare Szene aus dem Film „Das Leben des Brian“:
https://www.youtube.com/watch?v=6pwmffpugRo
Darin wird gezeigt, dass die Judäaer im Kampf gegen die Römer nicht vereint, sondern getrennt sind: Die jüdäische Volksfront liegt sich mit der Volksfront von Judäa in den Haaren.
Und die Lehre daraus? Drei kleine Parteien mit je drei Prozent, haben zusammen weniger Einfluss als eine Partei mit neun Prozent der Stimmen.
2. Den eigenen Einfluss auf die nächste Regierung noch weiter verwässern
Du machst mit deiner Stimme vielleicht die Kleinparteien größer, aber dich selbst kleiner als du eigentlich bist. Die Wahlberechtigten wählen Vertreter:innen, die wiederum in ihrem Namen konkret Gesetzesvorlagen abstimmen oder in der Regierung bestimmte Vorhaben vorantreiben.
Der wirklich konkrete Einfluss, den du mit einer Stimme auf die Regierungsarbeit hast, ist gering. Er fällt aber auf nahe Null, sobald du eine Kleinpartei wählst, die an der politischen Arbeit im Bundestag oder Landtag gar nicht beteiligt sein wird.
3. Wer eine Kleinpartei wählt, wählt alle Parteien mit
Wer eine Kleinpartei wählt, die es nicht ins Parlament schafft, wählt indirekt zu gleichen Teilen die Parteien mit, die es über die Hürde geschafft haben. Sollte deine Partei bei der Wahl unter fünf Prozent bleiben, wird das relative Gewicht der Parteien, die es ins Parlament schaffen, größer.
Also: Was tun?⬆ nach oben
Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Aber es gibt einen guten Weg, das Nullsummenspiel einer Wahl aufzubrechen, wenn wir über Kleinparteien sprechen: indem du in mehreren Wahlen denkst.
Ein Beispiel: Im Juni 2024 wählten alle Deutschen das Europaparlament, im September 2024 waren Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Diese Wahlen sind unterschiedlich wichtig. Eine sinnvolle Strategie, um mit dem Kleinparteien-Dilemma umzugehen: bei der wichtigsten Wahl große Parteien wählen – und bei den weniger wichtigen kleine.
Redaktion: Thembi Wolf, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Till Rimmele, Audioversion: Iris Hochberger