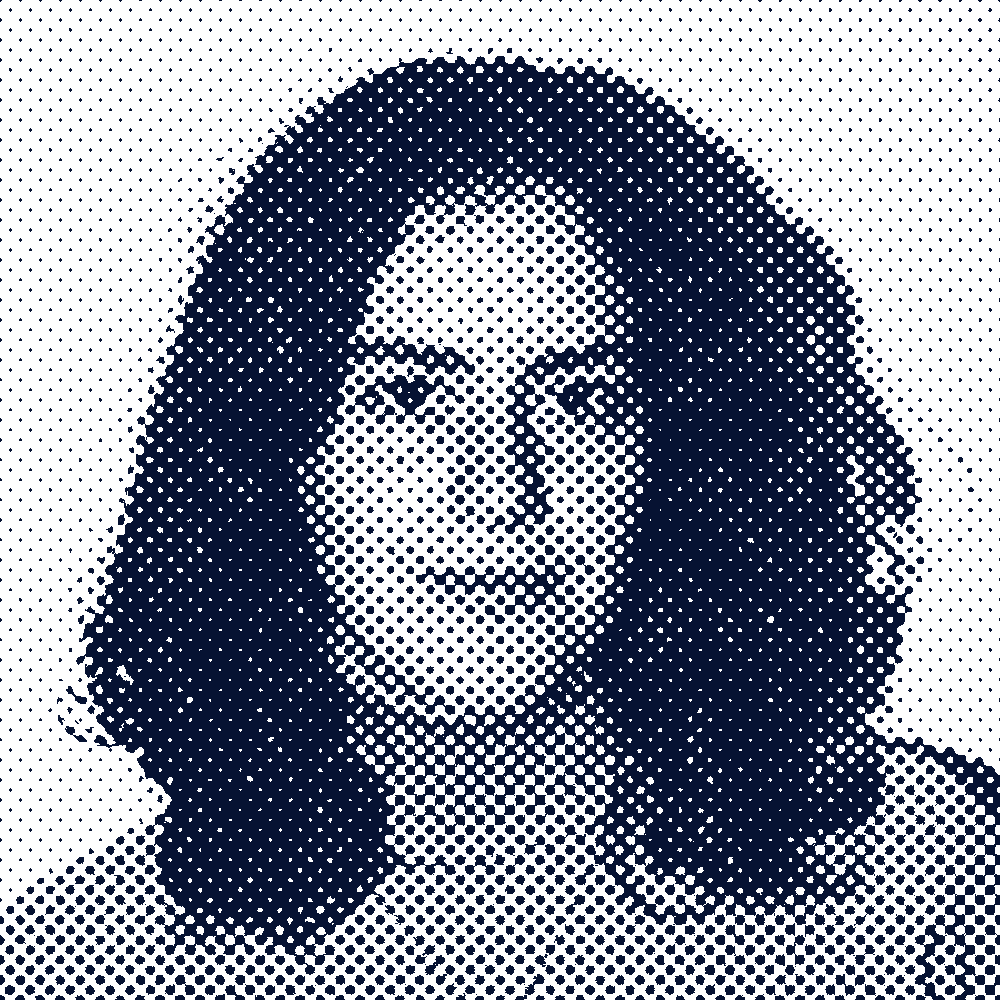Hätte Dagobert Duck eine Marketing-Abteilung, sie wäre entsetzt. Der reiche Comic-Enterich aus Entenhausen gilt als Inbegriff des Kapitalisten. Er bezahlt seine Angestellten schlecht und badet am liebsten in seinen Talern. Er lebt, um Geld zu scheffeln und jeder weiß das.
Wäre Dagobert Duck im Jahr 2020 erschaffen worden, dann würde er einen Teil seines Vermögens spenden, eine Petition starten und allen versichern, dass es ihm gar nicht ums Geldverdienen geht.
Denn heute sind die Ansprüche anders. Immer mehr Menschen sehen ihren Konsum kritisch, wollen aber trotzdem konsumieren. Sie wollen Geld ausgeben und mit jedem Euro die Welt ein bisschen besser machen. Sie wollen purpose, um dem ganzen Kram, den sie kaufen, einen Sinn zu verleihen.
Die meisten Unternehmen haben das verstanden. Das Problem ist: Anstatt wirklich etwas zu ändern, werfen sie die Marketing-Maschine an. Sie erzählen uns nicht mehr, wie toll ihre Produkte sind, sie erzählen uns, wie toll sie selbst sind. Dieses Phänomen nennt man „woke washing“. Eine gute deutsche Übersetzung gibt es nicht, das beste Wort dafür ist „Markenaktivismus“.
Gillette verkauft Rasierklingen – und kritisiert plötzlich toxische Männlichkeit⬆ nach oben
Ein Beispiel: Anfang 2019 sorgte ein Werbeclip von Gillette für Kontroversen. Das Video mit dem Titel „We believe: The Best Men Can Be“ kritisiert toxische Männlichkeit. Also das Phänomen, dass sich Männer ständig beweisen müssen und deshalb mobben, prügeln, belästigen. Das Video schließt mit einem Aufruf, sich selbst herauszufordern, um „näher an sein Bestes zu kommen“.
https://www.youtube.com/watch?v=UYaY2Kb_PKI
Im ganzen Werbeclip kommt kein einziger Rasierer vor, dafür sehr viele Männer, die zu besseren Menschen werden.
Auch Marketing-Agenturen wissen, dass vor allem Millennials (also Menschen, die zwischen den frühen 1980er bis zu den späten 1990er Jahren geboren wurden) auf das Firmen-Image achten und nutzen das für Werbe-Strategien. Die Agentur Tree Stones zum Beispiel findet woke washing gut: Unternehmen sollten bei sozialen und politischen Themen einen klaren Standpunkt vertreten, heißt es auf ihrer Internetseite. „Es wird nicht mehr länger ein Produkt oder ein Service verkauft, sondern eine Idee, zu welcher das Unternehmen steht.“ So bekämen Firmen einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten.
Deshalb rufen einen Unternehmen wie Gillette dazu auf, toxisch männliches Verhalten zu hinterfragen – obwohl Gillette eigentlich Rasierklingen verkauft und überhaupt nichts mit Aktivismus zu tun hat.
Richtig peinlich wird es aber erst, wenn Firmen das Gegenteil von dem tun, was sie der Öffentlichkeit erzählen. Das beste Beispiel ist Nike mit einer feministischen Kampagne von 2019. Der Werbeclip zeigt Aufnahmen erfolgreicher Sportlerinnen. Dazu hört man die Stimme der Tennisspielerin Serena Williams: „Wenn wir Emotionen zeigen, nennen sie uns dramatisch, wenn wir von Gleichberechtigung träumen, sind wir wahnwitzig und wenn wir zu gut sind, dann stimmt etwas nicht mit uns.“
Das klingt nach kämpferischem Feminismus. Doch wenige Monate nach dem Start der Kampagne machte die von Nike gesponserte Läuferin Alysia Montaño öffentlich, dass das Unternehmen ihr keinen Mutterschaftsurlaub bezahlen wollte.
Das, was ein Unternehmen wirklich moralisch macht, schafft es nicht in die Werbung und lässt sich nur schwer von außen überprüfen. Das ist ein Problem. Denn den Kund:innen da draußen, euch, sind keine woken Werbespots wichtig, sondern sehr konkrete Werte. Das jedenfalls kam in meiner kleinen Umfrage vor diesem Text heraus. Ich habe euch gefragt: Was ist für euch ein moralisches Unternehmen? Eure Antworten: Zum Beispiel ein fairer Umgang mit den Mitarbeitenden, darunter angemessene Bezahlung, flexible Arbeitszeiten oder ein Recht auf Homeoffice. Oder dass es keine Diskriminierung gibt und Menschenrechte einghalten werden. Am häufigsten genannt: Dass Gewinn nicht das oberste Ziel des Unternehmens ist.
Konsument:innen können kaum herausfinden, ob an den Werbebotschaften was dran ist⬆ nach oben
Aber welche Firma macht schon Werbung damit, dass sie kein Arschloch zu ihren Angestellten ist? „Wir haben einen Betriebsrat!“ klingt nicht sexy, „Wir pflanzen Bäume!“ dafür schon. Kein Unternehmen macht die Gehälter öffentlich, sie starten lieber eine Petition.
Eigentlich sollte dieser Text eine Anleitung werden, wie man die wirklich moralischen Unternehmen von den scheinbar moralischen Unternehmen unterscheidet. Bei der Recherche habe ich aber festgestellt: Das ist fast unmöglich. Denn wie sollen wir herausfinden, ob es bei der Firma mit 50.000 Angestellten, die unsere Waschmaschine herstellt, keine Diskriminierung gibt?
Der Wirtschaftsethiker Dominik Enste vom Institut der deutschen Wirtschaft sagt: „Für Konsumenten ist es nicht einfach, herauszufinden, was hinter den Werbebotschaften wirklich steckt.“ Genau deswegen sei investigativer Journalismus wichtig, der das Fehlverhalten einzelner Firmen aufdeckt.
Mit strengeren Gesetzen könne man Unternehmen zwar zur Verantwortung ziehen. „Aber man kann Gesetze nie so gut machen, dass alles abgedeckt ist“, sagt Enste. Unternehmen hielten sich dann ganz genau an diese Gesetze. „Dafür tun sie andere Dinge nicht, die auch sinnvoll wären.“
Folge der Spur des Geldes⬆ nach oben
Was also tun? Wirklich viel herausfinden können wir Konsument:innen nicht – bis auf zwei Dinge. Die sind dafür so grundlegend, dass sie im Zweifel mehr wert sind als jeder vom Firmenpersonal selbst verfasste Transparenzbericht. Die Regel ist einfach, und ein Klischee: der Spur des Geldes folgen. Wie es fließt, ob es fließt, an wen es fließt, ist entscheidend bei Unternehmen.
Es geht also darum, wem eine Firma gehört, und wie genau sie aufgebaut ist. Das Gute daran ist: Jede:r mit Internet und einer Suchmaschine kann überprüfen, wer Anteile einer Firma besitzt und welche Rechtsform sie hat. Das Schlechte ist: Es wird jetzt ein bisschen technisch.
Je nach Rechtsform hat ein Unternehmen bestimmte Rechte und Pflichten. Das kann beeinflussen, wie es buchführen muss, wie der Jahresabschluss aussieht und vor allem: wer Gewinn einstreichen darf. In Deutschland gängige Rechtsformen sind zum Beispiel die Aktiengesellschaft (AG), die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) oder die Kommanditgesellschaft (KG).
Die Rechtsform eines Unternehmens kann problematisch werden. Beispiel: Ein Investor übernimmt eine Aktiengesellschaft, indem er an der Börse so viele Anteile kauft, dass er irgendwann die Mehrheit hat. Dann trimmt er sein neues Eigentum rücksichtslos auf Ertrag (wozu er jedes Recht hat). Was wäre in diesem Fall die woke Attitüde noch wert?
Das passierte zum Beispiel einem Krankenhaus in Dachau, Bayern. Die Kommune hatte die Klinik an eine Aktiengesellschaft verkauft, 2014 übernahm Helios fast 95 Prozent der Aktien. Helios selbst gehört zum DAX-Konzern Fresenius. Seit die Klinik in den Händen von Helios ist, jagt ein Skandal den nächsten: dreckige OP-Säle, Materialknappheit auf der Babystation, hilflose Patient:innen. Dafür steigende Rendite. Bei einer Podiumsdiskussion sagte eine Angestellte: „Von Menschlichkeit ist doch nur in Helios-Werbesprüchen die Rede.“
Manche Unternehmen geben sich eine bessere Struktur⬆ nach oben
Die Gefahr liegt also schon in der Struktur des Unternehmens. Manche Gründer:innen entscheiden sich deshalb für Rechtsformen, die die Profitgier verhindern sollen.
In den USA gibt es Benefit Corporations, wie zum Beispiel die Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Die meisten Unternehmen werden zwar aus Marketing-Gründen zu Benefit Corporations. Aber immerhin verpflichten sie sich dazu, nicht nur auf Profit zu achten, sondern auch auf die Umwelt, Gesellschaft und ihre Mitarbeitenden.
In die gleiche Richtung gehen in Deutschland gemeinnützige GmbHs, kurz gGmbH. Sie dürfen keine Gewinne an Gesellschafter:innen ausschütten, das Vermögen der gGmbH und das der Gesellschafter:innen ist streng voneinander getrennt: So verhindert man, dass die gGmbH rein profitorientiert ist.
Und dann gibt es noch eine spezielle Variante: Eine Genossenschaft legt das Unternehmen in die Hände ihrer Mitglieder. Alle Genoss:innen haben das gleiche Gewicht bei Entscheidungen. So können sie sich auch davor schützen, von größeren Unternehmen übernommen zu werden. (Krautreporter ist übrigens eine Genossenschaft).
Genossenschaften, gGmbHs oder Benefit Corporations sind nicht automatisch lupenrein. Trotzdem kann die Rechtsform ein Hinweis darauf sein, ob Unternehmen auch leben, was sie predigen.
Wer Hafermilch von Oatly trinkt, unterstützt Trump und die Abholzung von Regenwald⬆ nach oben
Wir folgen weiter der Spur des Geldes. Eine GmbH ist ja nicht automatisch ein kapitalistisches Monster. Es kommt auch darauf an, wer die Firmen-Anteile besitzt. Wenn ein neuer Investor einsteigt, also Anteile kauft, dann veröffentlichen die Unternehmen das normalerweise auf ihrer Homepage.
An dieser Stelle müssen wir nun über Hafermilch reden. Genauer gesagt über den Hafermilchproduzenten Oatly. Oatly startet nicht nur Kampagnen, Oatly ist die Kampagne, jedenfalls will uns die Firma das glauben machen. Ein Unternehmen, das umweltfreundliche, CO2-sparende Hafermilch in der Welt verbreiten will. Es verdient zwar sein Geld durch den Verkauf von Hafermilch, aber der Gewinn ist zweitrangig. So steht es zumindest auf der Internetseite: „Wir versprechen, ein gutes Unternehmen zu sein. Das bedeutet, dass unser Bestreben, Menschen zu helfen und ihr Leben zu verbessern immer vor dem rücksichtslosen Streben nach Profit steht.“
Mitte Juli kaufte der US-Finanzinvestor Blackstone zehn Prozent der Oatly-Firma. Der Blackstone-CEO Steve Schwarzman ist ein Vertrauter von Trump und hat dessen Wahlkampf mit drei Millionen Dollar unterstützt. Und Blackstone ist Teilhaber einer Firma, die die Abholzung des brasilianischen Regenwaldes vorantreibt, wie The Intercept recherchierte.
Verkürzt gesagt: Wer seinen Kaffee mit Oatly-Hafermilch trinkt, der unterstützt Trump und die Abholzung des Regenwaldes.
Die öffentliche Empörung war groß, Oatly rechtfertigte sich. Die Argumentation: Oatly braucht Geld, um neue Fabriken zu bauen und noch mehr Hafermilch zu produzieren. Und wenn sogar Blackstone in ein nachhaltiges Unternehmen investiert und davon profitiert, dann machen das in Zukunft auch andere. Blackstone soll lieber mit Hafermilch Geld verdienen, als in einer umweltschädlichen Branche.
Dabei ist Blackstone nicht mal Oatlys einziger kritikwürdiger Investor. 2016 übernahm China Resources 40 Prozent, ein chinesischer Staatskonzern, der unter anderem in Kohle und Kernkraft investiert.
Im gleichen Jahr stieg Verlinvest ein, ein belgisches Familienunternehmen. Wobei Familienunternehmen etwas irreführend klingt, denn den Eigentümer:innen gehört auch der weltgrößte Braukonzern Anheuser-Busch InBev. Knapp die Hälfte des Bieres weltweit kommt aus ihrem Kessel, auch die deutschen Biere Beck´s, Fransziskaner und Hasseröder. Bierherstellung ist inzwischen aber Nebensache, den Managern geht es hauptsächlich um Profit.
Für viele Hafermilch-Trinker:innen ist deshalb klar: Oatly will genauso wenig die Welt retten wie Nestlé, sie haben einfach nur ein besseres Marketing-Konzept.
Eine Schoki rettet die Welt⬆ nach oben
In Oatlys Fall berichteten viele Medien über die fragwürdigen Übernahmen. Aber auch wenn ein Unternehmen nicht ganz so berühmt ist, lassen sich die Investoren meist ergoogeln.
So bin ich auch auf die Investoren von Tony’s Chocolonely gestoßen, eine niederländische Schokoladen-Firma. Das Unternehmen ist sozusagen ein Anti-Unternehmen, denn sie existieren nicht für Profit, sondern für Menschenrechte – zumindest behaupten sie das. Ihr erklärtes Ziel ist, dass nicht nur ihre eigene Schokolade, sondern die auf der ganzen Welt ohne Sklaven- und Kinderarbeit hergestellt wird. Schokolade produzieren und Geld verdienen sei dabei nur Mittel zum Zweck.
Im Februar stiegen dann zwei Investoren mit 36 Millionen Euro bei Tony’s Chocolonely ein: JamJar und Verlinvest (die mit dem Bier). Passt das noch mit dem Unternehmensziel zusammen?
Auf meine Anfrage schrieb Tony’s Chocolonely, das Investment helfe ihnen dabei, dem Ziel näherzukommen, dass weltweit Schokolade ohne Sklaverei produziert wird. „Sowohl Verlinvest als auch JamJar teilen die Mission und Ambitionen Tony’s.“ Außerdem hätten die Investoren nur einen Mindestanteil von 28 Prozent, an der Mission von Tony’s Chocolonely werde sich deshalb nichts ändern.
Alan Jope, der CEO von Unilever, warnte bei einer Rede, dass woke washing „das Vertrauen in die Industrie zerstört, obwohl es ohnehin schon knapp bemessen ist.“ Er beklagte, dass viele Marken purposeful marketing untergraben, indem sie in ihrem Kampagnen Dinge behaupten, die sie nicht tun.
Unilever, ein niederländisch-britisches Unternehmen, das sein Geld vor allem mit Nahrungsmitteln verdient, war selbst schon oft mit Greenwashing-Vorwürfen konfrontiert. Zum Beispiel verwendete das Unternehmen entgegen aller Beteuerungen umweltschädliches Palmöl. Trotzdem will Unilever als nachhaltiges und mitarbeiterfreundliches Unternehmen gesehen werden. In der Corona-Krise mobilisierte es 500 Millionen Euro für Lieferant:innen. Der Unilever-CEO hat jetzt anscheinend die Befürchtung, dass die eigenen Bemühungen nicht mehr ernst genommen werden.
Bei purposeful marketing gehe es nicht um „make them cry, make them buy“, sondern um echte Handlungen in der Welt, sagte Jope. „Purposeful marketing steht an einem Scheideweg“, sagte er und forderte Werbe-Agenturen auf, Aufträge von Marken abzulehnen, die woke washing betreiben wollen.
Ob Unternehmen echte Verantwortung übernehmen, hängt aber nicht nur von Werbe-Agenturen ab, sondern auch von uns Konsument:innen. Wenn wir Produkte von scheinbar sozialen und nachhaltigen Unternehmen kaufen, ohne sie wirklich zu hinterfragen, dann produzieren sie weiter Werbespots, mehr nicht. Wenn wir aber verstehen und anderen erzählen, mit welcher Masche uns Unternehmen etwas verkaufen wollen – dann finden sie diesen purpose vielleicht wirklich.
Redaktion: Rico Grimm, Schlussredaktion: Bent Freiwald, Fotoredaktion: Martin Gommel.