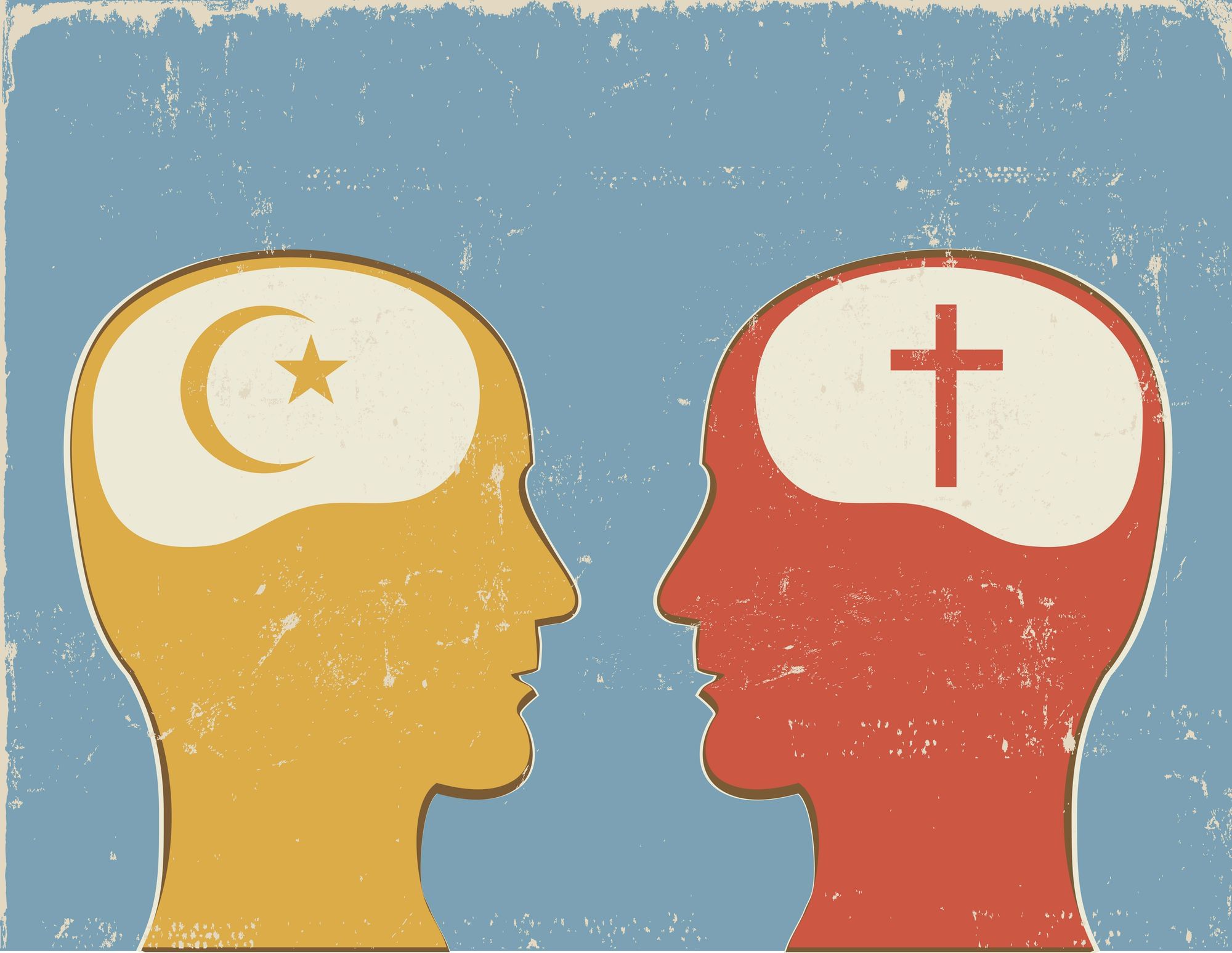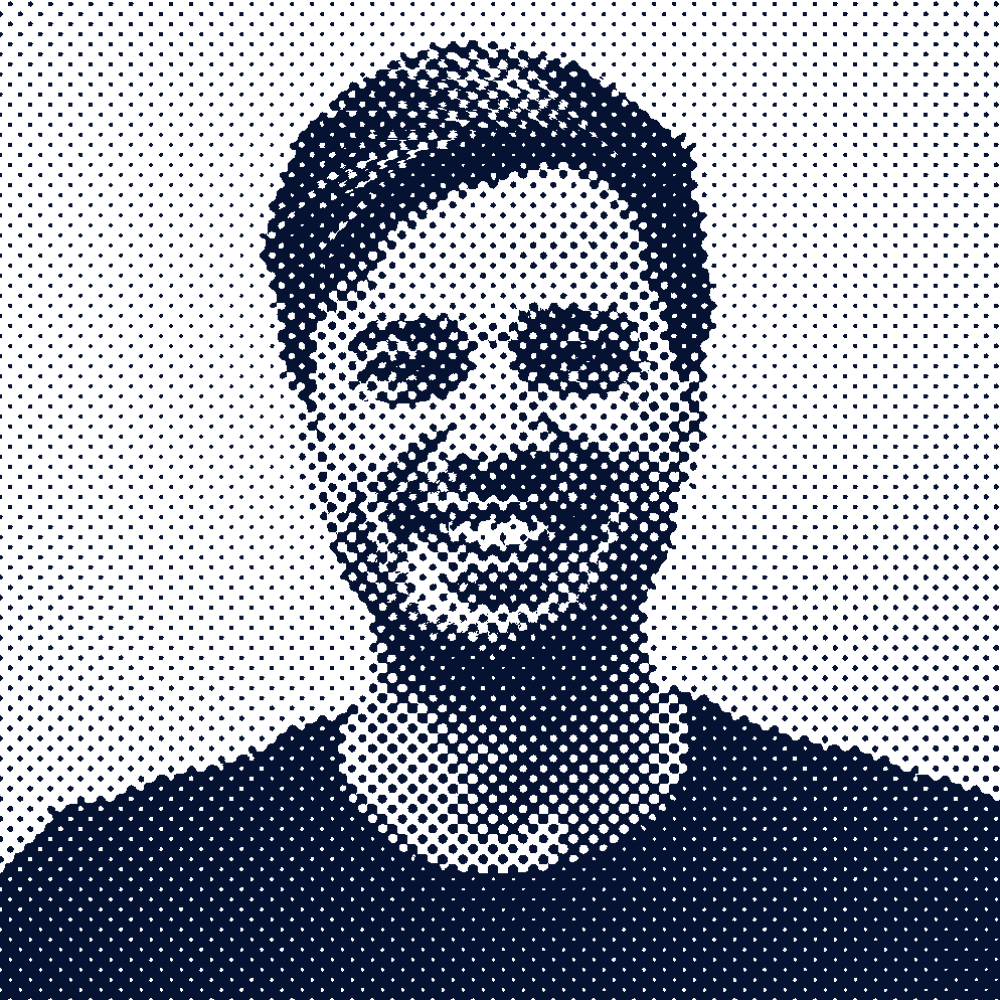Gibt es eine Debatte, die noch vergeblicher ist als jene über das komplette Burka-Verbot? Schließlich wusste schon Frank Henkel, Berliner CDU-Politiker, als er es gefordert hat: Wird nicht passieren. Ist nicht verfassungsgemäß. Dennoch gehen politische Gegner und Kommentatoren darauf ein, als ob es in der Debatte wirklich um den afghanischen Gesichtsschleier gehe.
Dabei geht es um mehr. Wir erleben in den letzten Jahren die Wiederkehr eines alten Konflikts über die Rolle von Religion in einem säkularen deutschen Staat. Eigentlich schien dieser längst befriedet zu sein; die Weltlichen haben den Sieg davongetragen, auch weil die Religiösen immer weniger werden. Jedenfalls jene Religiösen, die Jesus am Kreuze anbeten. Aber plötzlich wird dieser weltliche Staat wieder mit einer religiös verwurzelten Ideologie konfrontiert, mit dem Islamismus oder wie meine Gesprächspartnerin in diesem Interview sagt, mit „dem politischen Islam“.
Mina Ahadi (60) war eine junge, säkulare Frau, als sich ihr Geburtsland Iran 1980 in eine Theokratie verwandelte, in der die religiösen Gebote plötzlich Gesetzeskraft hatten. Sie floh, ließ sich erst in Wien, dann in Köln nieder, engagierte sich gegen Todesstrafe und Steinigung im Iran. 2007 gründete sie den Zentralrat der Ex-Muslime. Mit Mitgliedern dieses Zentralrates und Publizisten wie Hamed Abdel-Samad hat sie im August 2016 einen Appell verfasst, in dem sie die strikte, klare Trennung von Religion und Staat in Deutschland fordert. Dieser Appell liest sich streckenweise wie ein AfD-Positionspapier. Aber wenn die überzeugte Kommunistin Mina Ahadi etwas nicht ist, dann eine Rechtspopulistin. Sie hat eine komplett andere Sicht auf eine verfahrene Debatte.
Frau Ahadi, Sie wurden im Iran geboren, sind dort aufgewachsen. Sind Sie Muslima?
Nein, nur weil ich von dort komme, heißt das nicht automatisch, dass ich Muslima bin. Es gibt auch im Iran viele verschiedene Religionen und viele Atheisten. Ich bin zufällig in einer muslimischen Familie geboren, und da Religion eine Erbsache ist, war ich eben auch Muslima. Am Anfang habe ich gedacht, dass es normal ist, dass alle Menschen an Gott glauben. Als mir klarer wurde, dass die ganzen Verbote, die mich einschränken, auf den Koran zurückgehen, habe ich angefangen nachzudenken und den Koran auf Persisch gelesen, nicht Arabisch. Denn Arabisch ist sehr heilig und vor dieser Sprache habe ich Angst gehabt. Auf Persisch war die Heiligkeit fast verschwunden. Deswegen habe ich mit 15 Jahren aufgehört zu beten. Von da an war ich keine Muslima mehr. Ich bin ausgetreten.
Kann man als Moslem „austreten“? Ist das wie im Christentum?
Theoretisch kann man den Islam nicht verlassen. Man kann auch nicht in eine Moschee gehen und erklären, dass man kein Moslem mehr ist. Bevor die islamische Bewegung im Iran an die Macht kam, war es allerdings auch nicht wichtig. Es gab Menschen wie meinen Großvater, die den Islam oder Mohammed kritisiert haben, aber das wurde nicht thematisiert. Es war normal, keine Religion zu haben. Niemand hat deswegen Morddrohungen bekommen.
Die Situation im Iran in den 1970er Jahren war anders als im heutigen Deutschland. Im Jahr 2016 ist Religion in der Mitte Europas keine Privatsache mehr. Heftig und laut wird über die Rolle des Islam debattiert. Ich erinnere mich an die Diskussion über den Satz des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, der gesagt hat, dass der Islam zu Deutschland gehöre. Würden Sie denn sagen, dass der Islam zu Deutschland gehört?
Wenn man mit ja oder nein antworten sollte, dann würde ich sagen: Nein, er gehört nicht zu Deutschland. Aber ich denke, dass dieser Satz sehr problematisch ist. Er hört sich an, als würden wir – wie im Mittelalter – davon ausgehen, dass Religion eine Rolle in einem Staat zu spielen habe. Dabei geht es doch um die Menschen, sie sind gekommen, sie gehören zu Deutschland. Vier Millionen Menschen aus sogenannten islamischen Ländern haben einen Stempel bekommen und diese „Moslems“ leben hier – ganz egal, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wieso die Ausländer im Laufe der Zeit Moslems wurden bzw. diesen Stempel bekommen haben, wieso der Islam so wichtig geworden ist.
Haben Sie eine Antwort auf diese Frage?
Wir haben es mit einer politischen Bewegung zu tun. Und dieser politische Islam sollte nicht zu Deutschland gehören. Er ist frauenfeindlich, menschenfeindlich, terroristisch.
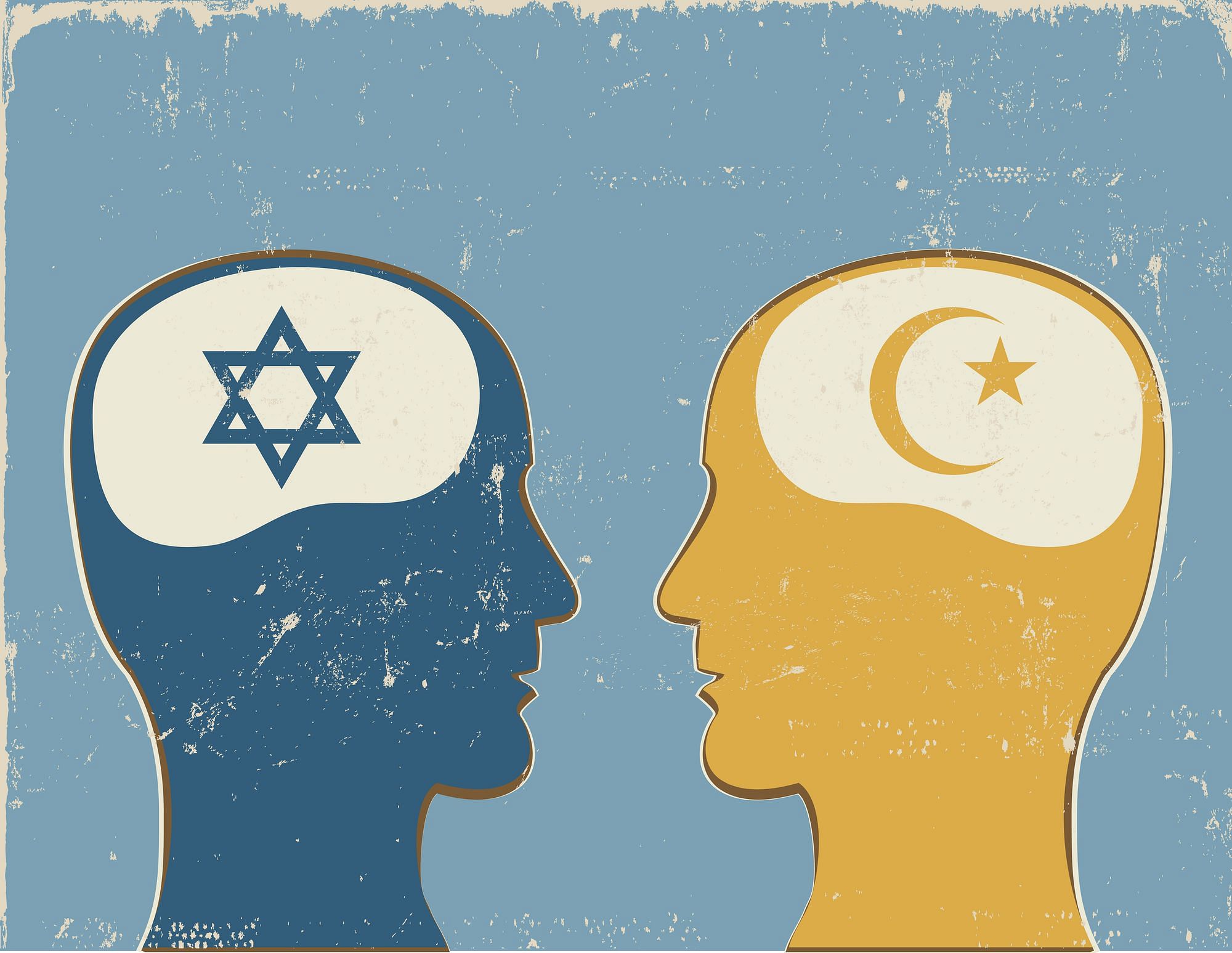
Was genau verstehen Sie denn unter dem „politischen Islam“?
Er ist eine Bewegung von Mullahs und Islamisten, die die Macht in sogenannten islamischen Ländern ergreifen will – und Ansprüche weltweit hat. Sie umfasst nicht unbedingt nur Radikale, sondern auch Gemäßigte und Liberale. Sie ist anti-westlich – und solange der Terror und die Morde nur in den Herkunftsländern stattfanden, haben die westlichen Regierungen geschwiegen. Heute ist die Bewegung in Europa angekommen und will auch hier etwas zu sagen haben. Alle diese Islamisten, von den Salafisten bis hin zu dem türkischen Religionsverband Ditib und den Erdogan-Anhängern, profitieren vom Angsteffekt des Terrors in Europa.
Aber wie viel Einfluss hat denn der politische Islam wirklich in Deutschland? Sie übertreiben in Ihrer Darstellung.
Ich denke, dass er im Laufe der Zeit an Einfluss gewonnen hat. Das ging los im Iran 1980, ging weiter in Afghanistan, später im Irak. Jetzt haben wir es mit ISIS zu tun. Und nun versuchen alle diese islamischen Bewegungen sich in Europa und besonders in unser Leben in Europa einzumischen.
Ich habe immer wieder gesagt: Einige islamische Organisationen haben Kontakt zu den Regierungen des Irans, der Türkei, von Saudi-Arabien. Sie versuchen, deren Interessen hier durchzusetzen. Ein Teil dieses Problems ist die Bundesregierung, denn sie hat diese Organisationen anerkannt, mit ihnen eine Integrationspolitik entwickelt, die Islamkonferenz organisiert und Schritt für Schritt nachgegeben. Zum Beispiel in der Frage des Kopftuchs für Lehrerinnen oder Kinder, auch, was den Streit um den Islamunterricht betrifft. Das ist eine gefährliche Politik. Die deutsche Regierung sollte nicht mit diesen islamischen Organisationen zusammenarbeiten.
Ist denn auch der Einfluss anderer Religionen gewachsen?
Der Aufstieg des politischen Islam hat dazu geführt, dass die Menschen glauben, jetzt auch ihr Christentum verteidigen zu müssen. Wenn zum Beispiel Salafisten in Köln den Koran verteilen, steht zwei Tage später ein noch größerer Infostand von Christen da. Auch sie versuchen, sich noch stärker zu verbreiten.
In Ihrem Appell fordern Sie unter anderem eine Trennung von Kirche und Staat. Gibt es die nicht schon längst in Deutschland?